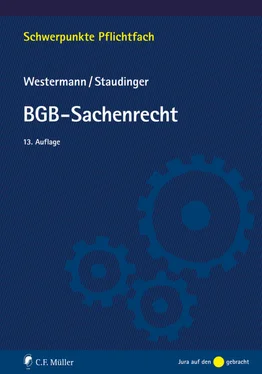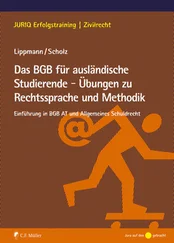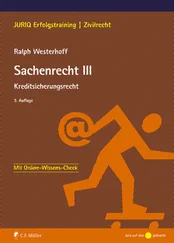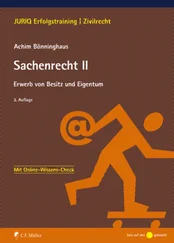Harm Peter Westermann - BGB-Sachenrecht
Здесь есть возможность читать онлайн «Harm Peter Westermann - BGB-Sachenrecht» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:BGB-Sachenrecht
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:4 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 80
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
BGB-Sachenrecht: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «BGB-Sachenrecht»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Das Lehrbuch behandelt die examensrelevanten Fragen des Sachenrechts in gründlich überarbeiteter und teils neu konzipierter Weise. Es trägt inhaltlich den ständig weiter differenzierten Positionen im Kreditsicherungsrecht, den Einflüssen des Umweltrechts und neuer technischer Gegebenheiten auf das Nachbarrecht sowie der zunehmenden Bedeutung des Mobiliarsachenrechts gegenüber dem Grundstücksrecht Rechnung. Das Ineinandergreifen von schuld- und sachenrechtlichen Fragestellungen wird anhand von Fällen mit Lösungen veranschaulicht.
BGB-Sachenrecht — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «BGB-Sachenrecht», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
54
Verfassungsrechtlichen Schutz in diesem Sinne genießt nicht nur Eigentum im Sinne der zivilrechtlichen Bestimmungen. Unter den verfassungsrechtlichen Eigentumsbegriff fallen vielmehr alle vermögenswerten Rechte, die ihrem Inhaber von der Rechtsordnung in der Weise zugeordnet sind, dass er die damit verbundenen Befugnisse nach eigenverantwortlicher Entscheidung zu seinem privaten Nutzen ausüben darf[11]. Vor einiger Zeit wurde dies auch für die – nach dem Zivilrecht nur schuldrechtlichen – Rechte eines Mietersbejaht, wodurch, da auch der vermietende Eigentümer den Schutz des Art. 14 GG genießt, die interessengerechte Ausgestaltung und Abgrenzung der Rechte von Vermieter und Mieter (auch) als eine von der Verfassung gestellte Aufgabe erscheint[12], so dass die Fachgerichte (in diesem Fall also die Zivilgerichte) bei der Anwendung des Mietrechts den beiderseitigen Eigentumsschutz beachten und unverhältnismäßige Eigentumsbeschränkungen vermeiden müssen. Ein Problem dabei ist auch, dass auf diese Weise viele auf den ersten Blick „einfach-gesetzlich“ zu beurteilende mietrechtliche Fragen zum Verfassungskonflikt werden können. Dasselbe ist für Immaterialgüterrechte angenommen worden[13], aber auch für Unternehmensbeteiligungen, auch verbriefte, die nicht unbedingt eine Unternehmerposition, sondern uU nur eine Geldanlage verkörpern[14]. Daraus folgt weiter, dass der Gesetzgeber eine zur individuellen Freiheitsverwirklichung notwendige vermögensrechtliche Position so ausgestalten kann, dass ohne Beschneidung ihres privatnützigen Kerns die Bindungen auch gegenüber anderen Privaten verwirklicht werden[15].
3. Enteignung und enteignungsgleicher Eingriff
55
Nach dem Vorigen begründet Art. 14 GG einen Schutz gegen Wegnahme des Eigentums im Einzelfall (Enteignung) und eine Schranke für die gesetzgeberische Gestaltung dessen, was unter „Eigentum“ zu verstehen ist. Wenn ein den Eigentumsinhalt verminderndes Gesetz oder eine Enteignung im Einzelfall wegen eines überwiegenden öffentlichen Interesses gerechtfertigt ist, so ist zu prüfen, ob das Gesetz, aufgrund dessen die hoheitliche Maßnahme geschieht, eine angemessene Entschädigungdes bisherigen Berechtigten vorsieht. Somit ist zwischen der Rechtfertigung des Eingriffs und der Frage nach der Entschädigung zu unterscheiden. Da die Gesetze diese Prüfung unterschiedlichen Gerichtsbarkeiten übertragen haben, hat sich bei der Bestimmung des Begriffs der Enteignung eine Verschiedenheit in der Judikatur des BGH und des BVerfG ergeben[16]; angesichts der Dominanz des BVerfG in dieser Frage ist von dem formellen Enteignungsbegriffauszugehen, der von einem zweckgerichteten staatlichen Zugriff auf das Eigentum zur vollständigen oder teilweisen Entziehung konkreter, dem Schutz des Art. 14 Abs. 1 S. 1 GG unterliegender Rechtspositionen eines Einzelnen ausgeht[17]. Eine solche Enteignung kann administrativ, also durch einen staatlichen Vollzugsakt, erfolgen, gegen den dann der Verwaltungsrechtsweg offen steht, aber auch durch eine gesetzgeberische Maßnahme, die dann allerdings in dem hierfür vorgesehenen Verfahren auf ihre Vereinbarkeit mit der verfassungsrechtlichen Gewährleistung zu prüfen ist. Dabei kommt es darauf an, ob es sich um eine Inhalts- und Schrankenbestimmung des Eigentums im Zuge einer Konkretisierung seiner Sozialpflichtigkeit oder um eine die Substanzgarantie des Rechts und seinen Wesensgehalt verletzende Regelung handelt[18]. Bei dieser Abgrenzung spielt dann das Erfordernis einer gegenüber den verfolgten öffentlichen Zwecken verhältnismäßigen, namentlich nicht den Gleichheitssatz verletzenden Vorgehensweise des Gesetzgebers eine Rolle[19].
56
Das Ganze hat praktische Auswirkungen besonders beim Grundeigentum gehabt, wobei hier weniger die Enteignung als die Frage nach Inhalt und Schranken des Eigentums im Mittelpunkt stand, dazu die Entschädigungspflicht, die besteht, wenn bei vorkonstitutionellem (also vor Inkrafttreten des GG entstandenen) Recht eine Enteignung ohne Entschädigung vorgesehen war, während bei nachkonstitutionellem Recht das Fehlen einer Entschädigungsregelung Verfassungswidrigkeit begründet[20]. Für die Bemessung einer Enteignungsentschädigung ist die Zivilgerichtsbarkeit berufen[21].
Ein Bild von den Gestaltungs- und Verteidigungsmöglichkeiten in der Praxis geben einige Leitentscheidungen. Einmal[22] bejahte der BGH eine Konkretisierung der Sozialpflichtigkeit, als dem Eigentümer eines mit jahrzehntealten Bäumen bestandenen Grundstücks aufgrund der Aufnahme dieses „Buchendoms“in die Liste der Naturdenkmäler entschädigungslos die Befugnis zum Schlagen der Bäume zwecks Bebauung verweigert worden war; ähnlich liegt es beim Denkmalschutz[23]. Anders liegen Beeinträchtigungen von Rechtspositionen durch die Notwendigkeiten neuzeitlicher Verkehrsplanung, so bei den Verkehrs- und Zugangsbeschränkungen durch die Frankfurter U-Bahn[24], die aufgrund der Situationsgebundenheit jedes Grundstücks entschädigungslos hingenommen werden musste.
57
Das geltende Schutzsystem beruht auf der Abgrenzung von rechtswidrigen und rechtmäßigen administrativen und legalen Maßnahmen. Es ist insofern nicht abschließend, als es sein kann, dass ein rechtswidriger Eingriff von hoher Hand, der an sich gemeinschaftsbezogen ist, dann aber vom Betroffenen ein sog. Sonderopferim Hinblick auf seine verfassungsrechtlich geschützten Positionen gefordert hat, von ihm aber nicht durch ein gerichtliches Vorgehen verhindert oder rückgängig gemacht werden konnte, ihm nicht ausgleichslos zugemutet werden kann. Hierbei ist an die unberechtigt verweigerte oder verzögerte Erteilung einer öffentlich-rechtlichen Genehmigung zu denken[25], ähnlich an eine faktische Bausperre über das Grundstück des Geschädigten[26], durch die jeweils ein Vermögensschaden verursacht wurde. Man spricht von einem enteignungsgleichen Eingriff, der zum Ersatz des dem Betroffenen zugemuteten Sonderopfers führt; dieser von der Zivilrechtsprechung entwickelte Anspruch soll dann neben die Amtshaftung nach § 839 iVm Art. 34 GG treten, setzt aber auf Seiten des handelnden Hoheitsträgers kein Verschulden voraus[27]. Eine zusätzliche Erweiterung des Schutzes bringt das Institut des enteignenden Eingriffsmit sich, das eingreift, wenn eine Maßnahme nicht zur Konkretisierung gesetzlicher Inhalts- und Schrankenbestimmungen dient und auch keine Enteignung darstellt, aber unbeabsichtigte Nebenfolgen in Gestalt schwerer Eigentumsbeeinträchtigungen nach sich zieht, ohne dass das diesen Zwecken dienende Verwaltungshandeln dadurch rechtswidrig würde. Beispiele sind etwa das Überlaufen eines offenen Regenrückhaltebeckens oder die Verschmutzung eines Gebäudes durch Vögel, die von einer gemeindlichen Mülldeponie angelockt wurden[28]. Auch für diese Realisierung des Aufopferungsgedankens, der auch im Nachbarrecht eine Rolle spielt ( Rn 58), sind die Zivilgerichte berufen, in allen Fällen handelt es sich um Entwicklungen des auf Privat- wie auf öffentlichem Recht beruhenden Staatshaftungsrechts, das dem Ausgleich erlittener Vermögensschäden dient, während im Nachbarrecht, soweit es Duldungspflichten gegenüber Einwirkungen von privater und hoheitlicher Seite begründet, wiederum der Gedanke des Ausgleichs für Aufopferung wirkt. Das betrifft heute auch Aspekte des Umweltschutzes.
Teil I Eigentum und Besitz› § 3 Privatnützigkeit und Sozialpflichtigkeit des Eigentums, Eigentumsschutz und Nachbarrecht› II. Eigentumsschutz und Nachbarrecht
1. Privatrechtlicher Schutz gegen Beeinträchtigungen
58
Die gesetzlichen Vorschriften, die den Inhalt des Sacheigentums bestimmen (§§ 903 ff, Rn 51, 52), geben dem Eigentümer gegen Beeinträchtigungen und Störungen seines Rechts keine Anspruchsgrundlage. Diese findet sich vielmehr in § 1004 Abs. 1, der einen Anspruch auf Beseitigung einer vorhandenen und Unterlassung künftiger Beeinträchtigungen gibt. Damit ist uU in den Fällen 4 und 5 auszukommen, während in den Fällen 4 bis 6 noch zusätzlich Schadensersatz verlangt wird. Das könnte aus dem Gesichtspunkt der unerlaubten Handlung begründet sein, die im Verstoß gegen eine Verkehrssicherungspflicht in Bezug auf eine auf ein benachbartes Grundstück einwirkende Anlage liegen könnte[29]. Während aber dieser Anspruch Verschulden des Schädigers voraussetzt, kommt es hierauf im Bereich des § 1004 nicht an, der aber in Abs. 2 die Ansprüche des Eigentümers auf Beseitigung und Unterlassung abschneidet, wenn der Eigentümer aus einem gesetzlichen oder vertraglichen Grunde zur Duldung verpflichtetist. Derartige Pflichten können sich aus § 906ergeben. Das kann aber – was dann als nächstes zu prüfen ist – nach § 906 Abs. 2 S. 2 Ausgleichsansprücheaus dem Gesichtspunkt der Aufopferungzur Folge haben. Bemerkenswert ist, dass der durch § 1004 gewährte negatorische Eigentumsschutz ähnlich konzipiert ist wie der Besitzschutz ( Rn 45 ff), und dazu passt auch, dass sowohl die Duldungspflichten bezüglich der auf eine Sache einwirkenden Beeinträchtigungen als auch etwaige aus einer Duldungspflicht resultierenden Ausgleichsansprüche auch für den bloßen Besitzer der Sache gelten[30].
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «BGB-Sachenrecht»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «BGB-Sachenrecht» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «BGB-Sachenrecht» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.