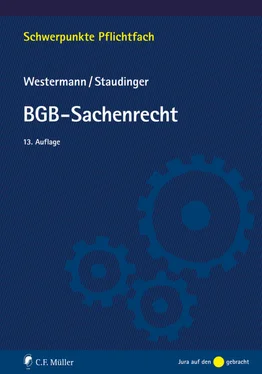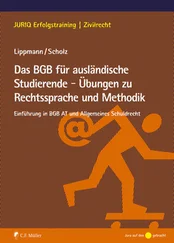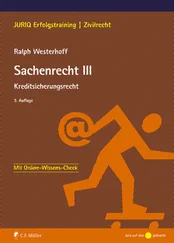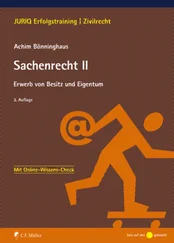48
Andere Ansprüche, die der Verteidigung des Besitzes dienen, knüpfen nicht an die bloße Sachherrschaft an, sondern an das relativ bessere Recht zum Besitz, so der Schutz des früheren Besitzers in der im Einzelnen sehr verwickelten Vorschrift des § 1007. Man spricht von petitorischemBesitzschutz aus früherem Besitz[29], wozu auch die soeben erwähnte Regelung des § 861 Abs. 2 gehört. Wenn aber auch das eigene Recht zum Besitz dem possessorischen Anspruch nicht entgegengehalten werden kann (s. hierzu § 863), so ist doch der obligatorische Anspruch auf Einräumung des Besitzes nicht von der rechtlichen Durchsetzung ausgeschlossen. Vielmehr kann der fehlerhafte Besitzer, nach § 861 auf Herausgabe in Anspruch genommen, sein Recht zum Besitz zum Gegenstand einer Widerklage (§ 33 ZPO) machen, sog. petitorische Widerklage.
Beispiel[30]:
Der wirksam gekündigte, aber mit unzulässigen Gewaltmaßnahmen des Vermieters „an die Luft gesetzte“ Mieter verlangt nach § 861 Wiedereinräumung des Besitzes an der Wohnung. Der Vermieter erhebt Widerklage mit dem Ziel, festzustellen, dass das Mietverhältnis beendet und er zum Besitz der Wohnung berechtigt ist. Wenn beide Klagen entscheidungsreif sind, würde es kaum einleuchten, nunmehr der possessorischen Klage stattzugeben, so dass der Vermieter die Sache zwar herausgeben, sie aber aufgrund der erfolgreichen petitorischen Widerklage sogleich wieder herausverlangen könnte. Besser ist daher die Lösung, dass der Herausgabeanspruch des früheren Besitzers, also des Mieters, aus § 861, hier analog § 864 Abs. 2 erlischt[31]. Unabhängig hiervon ist bei Falllösungen stets darauf zu achten, dass die Voraussetzungen der häufig im Vordergrund der Fragestellung stehenden Herausgabeansprüche, je nachdem ob sie aus Eigentum oder aus Besitz abgeleitet werden, unterschiedlichen Gegenrechten begegnen können.
[1]
Dazu OLG Stuttgart Urt. v. 28.10.2014 – 12 U 28/14.
[2]
Ausführlich hierzu Buschwitz , JuS 2016, 1067.
[3]
Westermann/ Gursky , § 7 Rn 1.
[4]
Zu den Funktionen des Besitzes s. Vieweg/Werner , § 2 Rn 2 ff.
[5]
Dazu Kegel , FS für v. Caemmerer, S. 150 ff.
[6]
Kollhosser , JuS 1992, 215, 216.
[7]
Der BGH (BGHZ 101, 186) hat dann allerdings weiter angenommen, inzwischen habe das Kaufhaus Besitz erworben, was im Hinblick auf den Besitzbegründungswillen zweifelhaft ist ( Rn 31), und der Kunde begehe durch die Wiederansichnahme verbotene Eigenmacht iSd. § 858; krit. dazu Ernst , JZ 1958, 357, 360; Westermann/ Gursky , § 12 Rn 4; ähnlich wie der BGH aber Baur/Stürner , § 7 Rn 16.
[8]
BGHZ 102, 186, 187 f; 27, 360, 362; HK-BGB/ Schulte-Nölke § 854 Rn 9; Soergel/ Stadler § 854 Rn 10; Vieweg/Werner , § 2 Rn 19.
[9]
So Westermann/ Gursky , § 112 Rn 4.
[10]
RG JW 1925, 784; anders für den Fund eines Geldscheins im Regal eines Großmarkts BGHZ 101, 186; zweifelnd Westermann/ Gursky ebenda.
[11]
Ähnliche Bedenken bei Wilhelm , Sachenrecht Rn 473.
[12]
BGH NJW 1979, 2308; zum Eigentumsvorbehalt und zur Sicherungsübereignung im Übrigen § 6 Rn 164 ff, 170 ff.
[13]
BGHZ 10, 71.
[14]
Baur/Stürner , § 7 Rn 47; HK-BGB/ Schulte-Nölke § 868 Rn 3; Vieweg/Werner, § 2 Rn 29; Westermann/Gursky , § 7 Rn 3; anders aber Soergel/ Stadler § 868 Rn 6.
[15]
BGH NJW 1955, 499; Baur/Stürner , § 7 Rn 45; MünchKomm /Joost § 868 Rn 16; HK-BGB/ Schulte-Nölke § 868 Rn 5; § Westermann/ Gursky , § 16 Rn 7.
[16]
BGH NJW 1999, 1239; 1979, 2037 f; Westermann/ Gursky , § 18 Rn 6; MünchKomm/ Joost § 868 Rn 30; HK-BGB/ Schulte-Nölke § 868 Rn 8.
[17]
Str. ist aber, ob es dabei noch auf den Willen des unmittelbaren Besitzers, also etwa des Gemeinschuldners ankommt, verneinend BGHZ 9, 73, 78.
[18]
Daran können Vollstreckungsmaßnahmen gegen den besitzenden Ehegatten oder die Eltern scheitern, BGH NJW 1989, 2542; MDR 1954, 95.
[19]
Manchmal ist von einem „sozialen Abhängigkeitsverhältnis“ die Rede, HK-BGB/ Schulte-Nölke § 855 Rn 3; Westermann/ Gursky , § 9 Rn 4; krit. aber MünchKomm/ Joost § 855 Rn 5.
[20]
Westermann/ Gursky , § 14 Rn 6.
[21]
Zu den weiteren Funktionen des Besitzes und den Grundlagen des Besitzschutzrechts s. Omlor/Gies , JuS 2013, 12.
[22]
Allgemein zum Besitzschutz s. Lorenz , JuS 2013, 776 und Omlor/Gies , JuS 2013, 12.
[23]
Eine Besitzstörung liegt bereits in einem Verhalten, das den Besitzer über den ungestörten Fortbestand seines Besitzes ernstlich beunruhigt, vgl. LG Berlin NZM 2013, 465 sowie LG Frankfurt BeckRS 2016, 17603.
[24]
Näher zum possesorischen Besitzschutz s. Vieweg/Werner , § 2 Rn 58 ff.
[25]
Zum Grundsatz BGH NJW 2009, 2530; zu dem dort behandelten Fall des Abschleppens rechtswidrig geparkter Fahrzeuge näher Rn 47.
[26]
Palandt/ Herrler § 859 Rn 2; abschwächend – keine Güterabwägung erforderlich – Erman/ A. Lorenz § 859 Rn 3; Vieweg/Werner , § 2 Rn 55.
[27]
Erman/ A. Lorenz § 858 Rn 6; HK-BGB/ Schulte-Nölke § 858 Rn 2.
[28]
BGH NJW 2009, 2530 und dazu Lorenz , NJW 2009, 2025; s. auch Paal/Guggenberger , NJW 2011, 1036.
[29]
Baur/Stürner , § 9 Rn 27; Westermann/ Gursky , § 23 Rn 7; zu den Einzelheiten auch Lipp , JuS 1997, 57, 60.
[30]
Beispiel von Kollhosser , JuS 1992, 569.
[31]
BGHZ 73, 355, 357; Fortführung durch BGH NJW 1979, 1359.
Teil I Eigentum und Besitz› § 3 Privatnützigkeit und Sozialpflichtigkeit des Eigentums, Eigentumsschutz und Nachbarrecht
§ 3 Privatnützigkeit und Sozialpflichtigkeit des Eigentums, Eigentumsschutz und Nachbarrecht
Inhaltsverzeichnis
I. Der Schutz des Eigentums als Aufgabe des Privatrechts und des Verfassungsrechts
II. Eigentumsschutz und Nachbarrecht
III. Das Verhältnis zu hoheitlichen Planungen
Teil I Eigentum und Besitz› § 3 Privatnützigkeit und Sozialpflichtigkeit des Eigentums, Eigentumsschutz und Nachbarrecht› I. Der Schutz des Eigentums als Aufgabe des Privatrechts und des Verfassungsrechts
I. Der Schutz des Eigentums als Aufgabe des Privatrechts und des Verfassungsrechts
1. Das Sacheigentum im BGB
49
Fall 4:
B ist Gemüsebauer und baut vorwiegend Bio-Gemüse an. Sein Gärtnereigrundstück liegt an einem Hang. Oberhalb des Grundstücks des B liegt ein Grundstück, auf dem D Silomais und Sommerweizen anbaut. Nach starken Regenfällen fließt vom Grundstück des D Oberflächenwasser auf das Grundstück des B ab. Kurze Zeit später stellt B schwere Schäden an den von ihm angebauten Pflanzen fest. Eine Untersuchung ergibt, dass die Schäden von Herbiziden herrühren, die mit dem vom Grundstück des D gekommenen Wasser in die Pflanzen des B gelangt waren. B verlangt von D, der seine Pflanzen mit diesem Mittel zu behandeln pflegt, Schadensersatz für die beschädigte oder zumindest nur noch eingeschränkt verkäufliche Ernte und will für die Zukunft, da starker Regen niemals ausgeschlossen werden könne, Unterlassung der Behandlung der auf dem Grundstück des D wachsenden Pflanzen mit Herbiziden. Lösung Rn 69, 75
Fall 5:
E ist Eigentümer eines Steinbruchs, den er in herkömmlicher Weise seit alters her betreibt. Auf einem in der Nachbarschaft gelegenen Grundstück errichtet F eine Fabrik, in der er Lackleder herstellt. Einige Zeit nach Errichtung der Fabrik geht E dazu über, den Steinbruch wesentlich intensiver mit modernen Maschinen auszunutzen. Dabei entsteht Staub, der auch auf das Grundstück des F gelangt und das frische, noch feuchte Lackleder beschädigt.
Читать дальше