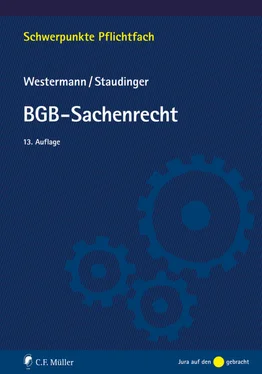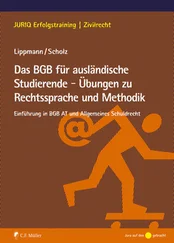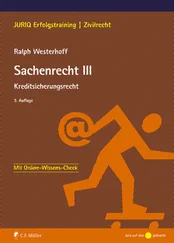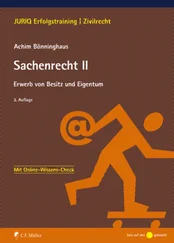Harm Peter Westermann - BGB-Sachenrecht
Здесь есть возможность читать онлайн «Harm Peter Westermann - BGB-Sachenrecht» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:BGB-Sachenrecht
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:4 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 80
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
BGB-Sachenrecht: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «BGB-Sachenrecht»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Das Lehrbuch behandelt die examensrelevanten Fragen des Sachenrechts in gründlich überarbeiteter und teils neu konzipierter Weise. Es trägt inhaltlich den ständig weiter differenzierten Positionen im Kreditsicherungsrecht, den Einflüssen des Umweltrechts und neuer technischer Gegebenheiten auf das Nachbarrecht sowie der zunehmenden Bedeutung des Mobiliarsachenrechts gegenüber dem Grundstücksrecht Rechnung. Das Ineinandergreifen von schuld- und sachenrechtlichen Fragestellungen wird anhand von Fällen mit Lösungen veranschaulicht.
BGB-Sachenrecht — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «BGB-Sachenrecht», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
125
a)Bei der Auslegungvon Erklärungen, in denen eine dingliche Einigung gesehen wird oder liegen soll, ist besonders auf den wirtschaftlichen Zweck einzugehen und zu prüfen, ob sich der bisherige Eigentümer schon endgültig von seinem Recht trennen will und der andere – mit oder ohne Besitzerwerb – bereits eine frei verfügbare Rechtsposition erhalten sollte[5]; so kann im Fall 9I, wenn ihm der Kaufpreis überwiesen wird, mit L über den Eigentumsübergang einig sein, was sich auch in der Mail an R zeigen kann. Dies spielt namentlich eine Rolle bei der Prüfung, ob ein Eigentumsvorbehalt durch Vereinbarung einer aufschiebend bedingten Einigung gewollt war, näher Rn 165. Die Anwendung der allgemeinen Rechtsgeschäftslehre auf die dingliche Einigung führt dazu, dass bei der Einigung auch Stellvertretung iSd § 164 möglich ist (hierzu näher Rn 151)[6], auch können Willensmängel (§§ 119, 123) auftreten oder es kann zur Ungültigkeit wegen Gesetzes- oder Sittenverstoßes (§§ 134, 138) kommen. Die Bedingtheit der dinglichen Einigung (§ 158) kennzeichnet den Eigentumsvorbehalt (Rn 165).
126
Die dingliche Einigung kann von Willensmängelnbeeinflusst sein, wofür aufgrund des Abstraktionsprinzips etwa Irrtümer beim Grundgeschäft nicht in Betracht kommen, wenn hiervon nicht im Einzelfall auch das Verfügungsgeschäft betroffen ist[7]. So kann ein Erklärungsirrtum vorliegen, wenn ein Buchhändler, der verschiedenen Kunden telefonisch ein Buch verkauft und verpackt zur Abholung bereit gelegt hat, bei der Übergabe den Inhalt verwechselt, was ein Erklärungsirrtum bei der dinglichen Einigung ist. Inwieweit ein Eigenschaftsirrtum iSd § 119 Abs. 2, wie er beim Verkauf von alten holländischen Fliesen, deren Herkunft aus dem 16. Jahrhundert dem Verkäufer aber unbekannt ist, sich nur auf den Kaufvertrag oder auch auf die Übereignung auswirkt, ist umstritten[8], allerdings spielt dies beim Kauf regelmäßig keine Rolle, weil bekanntlich (§ 1 Fn 10) bei einem Irrtum des Käufers über Eigenschaften der Kaufsache die Gewährleistungsansprüche vorgehen. Unstreitig ist jedoch, dass bei arglistiger Täuschung oder Drohung der Willensmangel so schwer wiegt, dass er auch das Verfügungsgeschäft erfasst[9], also wenn im genannten Fall der Käufer sehr wohl um das Alter der gekauften Fliesen wusste. Die hier bisweilen wirkende Vorstellung, die dingliche Einigung, die sich ja nur auf den bloßen Eigentumsübergang bezieht, sei deshalb „wertneutral“[10], lenkt ein wenig an dieser Berücksichtigung der Schranken der Bindung an privatautonome Akte vorbei. Deshalb ist auch klar, dass auch ein bloßes Verfügungsgeschäft gegen gesetzliche Verbote(§ 134) oder gegen die guten Sitten(§ 138) verstoßen und daher nichtig sein kann, wenn gerade der Eigentumswechsel und die daraus folgende Verfügungsmacht des Erwerbers durch das verletzte Gebot missbilligt werden: So ist beim Kauf dunkler Damenstrümpfe mit dem offensichtlichen Ziel, sie bei einem anschließenden Banküberfall zur Maskierung zu benutzen, nicht nur das Verpflichtungsgeschäft, sondern auch die Übereignung anstößig, ebenso beim Drogenhandel. Bei undurchsichtigen Geschäften wird man dies aber nicht immer annehmen können. Eine besondere Rolle spielt das Problem der Sittenwidrigkeit bei den Sicherungsgeschäften ( Rn 190).
127
Neben den Fragen, die sich aus der Anwendung des allgemeinen Vertragsrechts auf die dingliche Einigung ergeben, stehen die praktisch ebenfalls wichtigen Folgerungen aus besonderen sachenrechtlichen Gültigkeitserfordernissenwie dem Bestimmtheitsgrundsatz(auch: Spezialitätsgrundsatz), ferner aus der Vorstellung einer gegenüber dem allgemeinen Vertragsrecht geringeren Bindungswirkung der Einigung und schließlich aus dem Grundsatz, dass bei der Vollendung einer Verfügung alle ihre Gültigkeitserfordernisse noch gegeben sein müssen (zum Letzteren näher Rn 140). Nach dem Bestimmtheitsgrundsatz müssen sich Verfügungen als Zuordnungsgeschäfte immer auf einen bestimmten Gegenstand beziehen, anders als Verpflichtungen, die den Schuldner zwar binden, aber die Zuordnung des Gegenstandes der Obligation, wenn der Schuldner ihn überhaupt schon hat, noch nicht verändern, was erst durch das Verfügungsgeschäft geschehen soll; für das schuldrechtliche Geschäft spricht man von einer nur mittelbaren Zuordnung des Gegenstandes der Obligation zum Vermögen des Gläubigers[11], der nunmehr ein Recht aufdie Sache, aber nicht ander Sache hat. Das Bestimmtheitserfordernis, das freilich bei einer Reihe von wirtschaftlich wichtigen, teils durch Rechtsfortbildung entwickelten Verfügungsformen nicht immer mit voller Konsequenz angewendet wird und werden kann[12], ist erfüllt, wenn jeder, der die Vereinbarungen der Beteiligten kennt, ohne Heranziehung weiterer Umstände feststellen kann, auf welche Gegenstände sich die Vereinbarung bezieht[13]. Das wird am deutlichsten bei der Gattungs- oder Vorratsschuld: Die Verpflichtung, 100 Sack Mehl aus einem größeren Lager zu liefern, legt nicht fest, welche Säcke hinfort dem Erwerber gehören sollen[14]. Man muss dann die zu übereignenden Stücke näher bezeichnen, wofür eine Benennung der Räume, in denen sie gelagert werden, ausreicht, wenn alle in diesem Raum befindlichen Gegenstände gemeint sind oder für jeden Dritten anhand der Gattungsbezeichnung klar ist, wie die Eigentumsverhältnisse sind[15]. Aber auch bei der Stückschuld bedarf es nach dem Abstraktionsprinzip und dem Publizitätserfordernis bei der Verfügung einer Einigung und Besitzübertragung, wobei die Letztere nicht ohne einen auf bestimmte Sachen konkretisierten Besitzwillen ( Rn 31) denkbar ist. Für die Bestimmtheit ist der Zeitpunkt der dinglichen Einigung maßgebend.
Das zeigt sich an dem – allerdings nicht unproblematischen – Fall des Ehemanns, der seiner Frau zum dritten Hochzeitstag sämtliche zu diesem Zeitpunkt im gemeinsamen Hausstand befindlichen Hausratsgegenstände geschenkt hatte[16], deren Eigentum die Ehefrau nach der Insolvenz des Ehemanns für sich beanspruchte: Hier war im Zeitpunkt der Einigung klar, welche Sachen sie erfasste; dass später noch andere hinzukamen, beeinträchtigte sicher die Beweisbarkeit der Einigung in Bezug auf die einzelnen Gegenstände, verhinderte aber ihre genügende Bestimmtheit nicht. Zur Besitzübertragung in solchen Fällen Rn 144. Anders wenn die Eheleute – in Voraussicht künftiger Vollstreckungsmaßnahmen von Gläubigern des Ehemanns – die Übereignung nur auf solche Sachen beschränken wollten, die nicht – nach den §§ 808 ff ZPO – unpfändbar und daher vom Gläubigerzugriff nicht bedroht waren[17].
128
Der Bestimmtheitsgrundsatz gilt auch, wenn gleichzeitig mit der dinglichen Einigung das schuldrechtliche Grundgeschäft zu Stande kommt; allerdings muss der Wille vor allem des Veräußerers zur Eigentumsübertragung genügend deutlich zum Ausdruck kommen. Die Rechtsprechung ist dabei – etwa bei der Übereignung von Sammlungsstücken, die in verschiedenen Räumen gelagert und nur allgemein bezeichnet waren – den praktischen Bedürfnissen durchaus entgegengekommen[18]. Dennoch begründen die Unsicherheiten bei der Einschätzung der hinlänglichen Bestimmtheit, besonders bei der Sicherungsübereignung eines Warenlagers mit wechselndem Bestand (Rn 179), oftmals den Entschluss, pauschal alle betroffenen Gegenstände zu übereignen, so dass es auf eine Unterscheidung bezüglich der von dem Rechtsgeschäft betroffenen Sachen nicht ankommt (sog. „All-Klausel“)[19].
129
Zu den spezifisch sachenrechtlichen Gültigkeitserfordernissen eines Rechtsgeschäfts gehört die Verfügungsbefugnisdes Veräußerers (als nicht nur bei der Eigentumsübertragung wichtig, sondern auch bei der Bestellung oder inhaltlichen Veränderung eines dinglichen Rechts)[20]. Diese Befugnis folgt gewöhnlich aus der Inhaberschaft an dem betroffenen Recht, also etwa dem Eigentum, es kann aber auch sein, dass Rechtsinhaberschaft und Verfügungsbefugnis getrennt sind, so etwa in der Insolvenz des Eigentümers, in der die Befugnis, über Gegenstände der Insolvenzmasse zu verfügen, auf den Insolvenzverwalter übergeht, ähnlich bei der Testamentsvollstreckung (§ 2211). Verfügungsbefugnis eines Nicht-Rechtsinhabers kann sich auch durch eine Ermächtigung(§ 185) des Berechtigten ergeben. Eine weitere, die sachenrechtlichen Verfügungsgeschäfte kennzeichnende Besonderheit besteht darin, dass der Doppeltatbestand erst durch die Übergabe oder einen Übergabeersatz vollendet ist, nach wohl hM aber bis dahin die Einigung nicht bindendist, was von der Rechtslage bei sonstigen vertraglichen Einigungen abweicht, näher Rn 142.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «BGB-Sachenrecht»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «BGB-Sachenrecht» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «BGB-Sachenrecht» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.