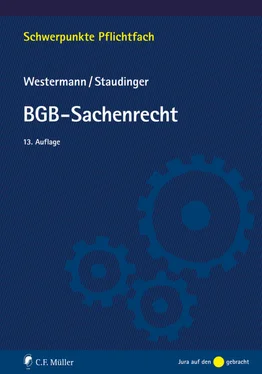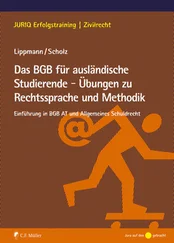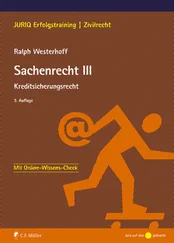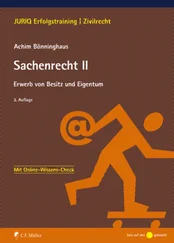[137]
S. auch die Kritik von Westermann/ H.P. Westermann , § 61 Rn 33; Wolf/Wellenhofer , § 25 Rn 29.
[138]
BGHZ 92, 143 ff.
[139]
Deutlicher in diese Richtung später BGH NJW 2008, 922 mit Anm. Vieweg/Regenfus , LMK 2008, 261371.
[140]
Zu der Entscheidung Marburger/Herrmann , JuS 1986, 354 ff; Westermann/ H.P. Westermann , § 61 Rn 37; zur Beweislast s. Baumgärtel , JZ 1984, 1109.
[141]
BGHZ 66, 70, 76; Erman/ Wilhelmi § 906 Rn 37.
[142]
BGHZ 66, 70, 76; Erman/ Wilhelmi § 906 Rn 37; MünchKomm/ Brückner § 906 Rn 68; H. Westermann , FS für Larenz, 1973, S. 1003 ff; § zur gesamtschuldnerischen Haftung auf einen Ausgleich in Geld aber BGHZ 72, 289, 298; krit. Hager , NJW 1991, 134, 141; Westermann/ H.P. Westermann , § 61 Rn 16; s. auch Vieweg/Werner , § 9 Rn 46 ff.
[143]
S. BGHZ 66, 70, 75 f.
[144]
Siehe dazu wieder das „Tennisplatz-Urteil“ BGH NJW 1983, 751 und dazu Hagen , UPR 1985, 192 ff; näher § Erman/ Wilhelmi § 906 Rn 23; HK-BGB/ Staudinger § 906 Rn 11; Westermann/ H.P. Westermann , § 61 Rn 18.
[145]
S. hierzu Schapp , Das Verhältnis von privatem und öffentlich-rechtlichen Nachbarrecht, 1978, S. 34 ff, der öffentliches und privates Nachbarrecht zu einer Einheit zusammenfasst.
[146]
BGH NJW 1985, 2541.
[147]
BGH NJW 1984, 1876; 1975, 1406.
[148]
S. aber BVerfG NJW 1989, 1291; zum Problemkreis eingehend Ossenbühl , Staatshaftungsrecht, 5. Aufl. 1998, S. 288 ff; eingehend Erman/ Wilhelmi § 906 Rn 47, 72; MünchKomm/ Brückner § 906 Rn 108 ff; HK-BGB/ Staudinger § 906 Rn 19.
[149]
Zu den gedanklichen Grundlagen Bälz , FS für Kübler, 1997, S. 355, 362 ff.
[150]
So seit BGHZ 54, 384 stRspr: s. BGH WM 1975, 985; BGHZ 64, 220.
[151]
Insoweit an RGZ 159, 129 (sog. „Autobahn-Entscheidung“) anknüpfend.
[152]
So BGHZ 49, 148; 30, 373.
[153]
Baur , JZ 1974, 659; Erman/ Wilhelmi § 906 Rn 64b; HK-BGB/ Staudinger , § 906 Rn 19; krit. aber Bälz , JZ 1992, 57, 71.
[154]
BGHZ 30, 273, 276.
Teil I Eigentum und Besitz› § 4 Ergänzende Zusammenfassung der Darstellung des Besitz- und Eigentumsrechts
§ 4 Ergänzende Zusammenfassung der Darstellung des Besitz- und Eigentumsrechts
Inhaltsverzeichnis
I. Begrifflichkeit
II. Eigentum
III. Besitzrecht
IV. Eigentümer-Besitzer-Verhältnis
Teil I Eigentum und Besitz› § 4 Ergänzende Zusammenfassung der Darstellung des Besitz- und Eigentumsrechts› I. Begrifflichkeit
103
Das Eigentumist die Zuordnung der umfassenden Herrschaftsmacht über eine Sache (Eigentum im technischen Sinne gibt es nur an Sachen; bei Rechten entspricht dem Eigentum die Inhaberschaft) an eine Person, den Eigentümer, nach Substanz und Nutzung. Durch die umfassende Herrschaftsmacht unterscheidet sich das Eigentum von den beschränkten dinglichen Rechten, die die Sache nur teilweise (also inhaltlich oder zeitlich beschränkt, zB Erbbaurecht, Nießbrauch, Grundpfandrecht) dem Berechtigten zuordnen. Das Eigentum gewährt auch ein Recht zum Besitz[1].
Der Besitzist das äußere Haben der Sache; kennzeichnend ist, dass er vom Recht an der Sache oder auf die Sache unabhängig ist, ja zu ihr im Widerspruch stehen kann (der Dieb, der Räuber sind Besitzer). Wie eng die tatsächliche Herrschaftsmacht des Besitzers an die unmittelbare und ständige Einwirkungsmöglichkeit auf die Sache anknüpft, entscheidet die Verkehrsanschauung[2].
Eigentum und Besitz stehen dadurch so zueinander in Beziehung, dass das Eigentum ein Recht zum Besitz gewährt (daher der Herausgabeanspruch aus § 985). Im Recht der beweglichen Sachen ist der Besitz Verlautbarungsmittel des Eigentums und der dinglichen Rechte. Im Tatbestand der Übereignung beweglicher Sachen (§ 929) ist aber die Übertragung des Besitzes konstitutiv. Dieses sog. Traditionsprinzipist allerdings im positiven Recht vielfach durchbrochen (näher Rn 124).
Teil I Eigentum und Besitz› § 4 Ergänzende Zusammenfassung der Darstellung des Besitz- und Eigentumsrechts› II. Eigentum
104
Der absoluten Natur des Eigentums entsprechend ist das Recht, insbesondere verfassungsrechtlich durch Art. 14 GG, umfassend geschützt: Enteignung ist nur auf Grund eines Gesetzes zulässig; sie löst ebenso wie enteignungsgleiche und enteignende Eingriffe ( Rn 55 ff) unter bestimmten Voraussetzungen Entschädigungsansprüche aus, vorher muss jedoch feststehen, dass die öffentlich-rechtlichen Voraussetzungen eines hoheitlichen Eingriffs in das Eigentum gegeben waren. Als Grundlage bedarf es stets einer Abwägung zwischen entschädigungsloser Sozialbindung des Eigentums, die insbesondere aus der Situationsgebundenheit des Grundstücks folgt, und dem Eigentumsschutz; hieraus folgt ein durch die Rechtsprechung zu konkretisierendes Spannungsverhältnis.
105
Gegen widerrechtliche Beeinträchtigungen hat der Eigentümer Unterlassungs- und Beseitigungsansprüche gegen den Störer, § 1004. Typisch dabei ist, dass es nicht auf das Verschulden, sondern nur auf die objektive Widerrechtlichkeit der Störung ankommt. Störer ist der, auf dessen Willen der beeinträchtigende Zustand zurückgeht oder von dessen Willen die Beseitigung abhängt, vgl. Rn 63.
106
Die Lage von Grundstücken im nachbarlichen Raumlöst Pflichten zur Duldung unwesentlicher und ortsüblicher Beeinträchtigungen aus, falls der Störer die Beeinträchtigungen nicht durch wirtschaftlich zumutbare Maßnahmen verhindern oder mindern kann, § 906. Ortsüblich ist die Beeinträchtigung, wenn das beeinträchtigende Grundstück raumentsprechend genutzt wird. Der Maßstab wechselt mit der Entwicklung des Raumes; eine Berufung auf die Priorität der Nutzungsart macht diese allein nicht ortsüblich. Für ortsübliche, aber unzumutbare Beeinträchtigungen hat der Störer dem Beeinträchtigten einen Ausgleich zu zahlen, § 906 Abs. 2 S. 2; diese Regelung wird entsprechend angewendet, wenn der Beeinträchtigte eine rechtswidrige Störung aus tatsächlichen Gründen nicht verhindern oder beseitigen kann ( Rn 90). Gegenüber gewerbepolizeilich genehmigten Betrieben gibt es überhaupt keinen Unterlassungsanspruch, wohl aber muss der Betriebsinhaber zumutbare Schutzmaßnahmen ergreifen und Entschädigung für die über das ortsübliche Maß hinausgehende Beeinträchtigung leisten, § 14 BImSchG. Gegenüber Beeinträchtigungen, die von Grundstücken ausgehen, die von juristischen Personen öffentlichen Rechts im öffentlichen Interesse genutzt werden, gibt es keinen Unterlassungsanspruch, auch hierfür ist der Eigentümer in besonderen Fällen zu entschädigen (Aufopferungsgedanke).
107
Auf wirtschaftlichen Erwägungen und auf einer Anerkennung des nachbarlichen Gemeinschaftsverhältnisses beruht die Pflicht des Nachbarn, einen Überbauzu dulden (§§ 912 ff), allerdings gegen eine Entschädigung, die sich nach dem Verkehrswert der überbauten Fläche bestimmt[3]. Vorausgesetzt ist, dass der Bauende nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig die Grenze überschritten und der Nachbar nicht sofort widersprochen hat. Der die Grenze überschreitende Teil des Gebäudes ist Bestandteil des Grundstücks, von dem aus überbaut worden ist; das bestimmt auch die Eigentumsverhältnisse.
Wenn die Voraussetzungen der Duldungspflicht nicht vorliegen, hat der Eigentümer des überbauten Grundstücks einen Beseitigungsanspruch aus § 1004. Wenn aber der Abriss des Gebäudes den Überbauenden zu untragbaren Aufwendungen zwingen würde und das Stehenbleiben des Gebäudes den Eigentümer des überbauten Grundstücks nicht besonders beeinträchtigt, hielt der BGH[4] die Geltendmachung des Beseitigungsanspruchs für rechtsmissbräuchlich. Das Notwegrechtder §§ 917, 918 soll eine vernünftige Ausnutzung der Grundstücke ermöglichen. Diese Einrichtung tritt neben die auf einer vertraglichen Grundlage beruhende Benutzungsmöglichkeit eines fremden Grundstücks auf Grund von Dienstbarkeiten( Rn 529). Eine gewisse Bedeutung im Hinblick auf die Sicherung des Rechtsfriedens kommt auch den gesetzlichen Regelungen der Grenzverhältnissezu. In städtischen Siedlungsverhältnissen spielen die Eigentumsverhältnisse und die Benutzungsrechte bezüglich der Grenzanlagen bei einer Mauer (§ 921) eine nicht unerhebliche Rolle. Ein auf der Grenze zwischen zwei Grundstücken stehender Baum, der nach der Rechtsprechung beiden Grundstückseigentümern in der Weise geteilt zusteht, dass jedem der auf seinem Grundstück befindliche Teil gehört, löst Verkehrssicherungspflichten beider Eigentümer aus, die etwa beim Umstürzen des „Grenzbaums“ auf eines der Grundstücke Schadensersatzansprüche gegen beide Eigentümer begründen können.
Читать дальше