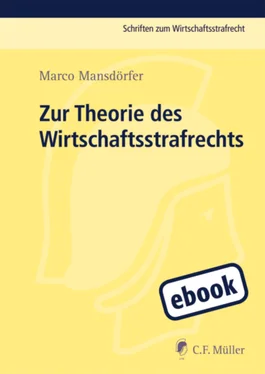e) Die Garantie der Vereinigungsfreiheit als Recht auf freie Assoziierung des Einzelnen mit Dritten
248
Die Vereinigungsfreiheit aus Art. 9 GG ergänzt die anderen Freiheiten, indem sie allen Deutschen das Recht gewährt, die verbürgten individuellen ökonomischen Freiheiten auch durch eine Assoziierung mit anderen und mittels einer bestehenden Vereinigung oder Gesellschaft wahrzunehmen[555]. Sie verbürgt damit im Gegensatz zu ständischen Korporationsgedanken älterer Sozialordnungen ein liberales Assoziationsprinzip und rezipiert damit auch die Vorstellung des an die Gemeinschaft gebundenen und auf die Gemeinschaft bezogenen Individuums[556].
249
Art. 9 GG im Zusammenwirken mit den infrage kommenden „Inhaltsrechten“ setzt voraus, dass sich außenrechtliche Freiheitsgewähr, binnenrechtliche Organisation und Willensbildung der Vereinigung strukturell entsprechen. Wer die Unternehmer- und Berufsfreiheit und die Garantie des unternehmerisch genutzten Eigentums für sich in Anspruch nimmt, soll sich im Ansatz auch nach diesen Grundsätzen organisieren[557]. Ein Antrag auf Mitgliedschaft in einer Vereinigung darf daher nicht willkürlich versagt werden, wenn der Verein eine überragende Machtstellung hat und ein besonderes Interesse am Erwerb der Mitgliedschaft besteht[558]. Die innere Struktur der Vereinigung muss plural organisiert sein; sie ist auch einer gesetzlichen Regelung zugänglich, die jedoch inhaltlich die Vereinigungsfreiheit zur Schranken-Schranke hat. Wie weit die gesetzlichen Regelungen reichen können, bestimmt sich folgerichtig nach dem inneren Grund der Vereinigung. Ist die Vereinigung – zum Beispiel eine Aktiengesellschaft – von ökonomischen Interessen dominiert, können die Mitgliedschaftsrechte anstatt von Art. 9 GG durch die Grundrechte der Art. 2, 3, 12 und 14 GG und allgemeine Verfassungsprinzipien, wie etwa die Prinzipien der Rechts- und Sozialstaatlichkeit, bestimmt sein[559].
250
Der verbürgte Schutz erfasst nicht nur den Kernbereich koalitionsmäßiger Betätigung, sondern alle zum Erhalt und zur Sicherung der Vereinigung notwendigen Tätigkeiten. Dazu kommt das Recht, die in Art. 9 Abs. 3 GG genannten Zwecke der Wahrung und Förderung der Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen durch eine spezifisch koalitionsmäßige Betätigung zu verfolgen[560]. Damit wird wie in den Art. 159 und 165 Weimarer Verfassung zunächst die Freiheit der Gewerkschaften geschützt, darüber hinaus aber auch die von Arbeitgebervereinigungen[561].
251
Art. 9 GG gewährleistet damit eine Ordnung des Arbeits- und Wirtschaftslebens, bei der der Staat seine Zuständigkeit zur Rechtsetzung weit zurückgenommen und die Bestimmung über die regelungsbedürftigen Einzelheiten des Arbeitslebens grundsätzlich den Koalitionen überlassen hat[562]. Erst recht ist damit der Einsatz des Strafrechts zur Durchsetzung der Vereinigungsfreiheit allenfalls in Extremfällen legitimierbar. Austariert wird die Ordnung des Arbeitslebens in erster Linie durch die Tarifautonomie[563]. Mit ihrer Hilfe soll die strukturelle Unterlegenheit der Arbeitnehmer gegenüber den Arbeitgebern ausgeglichen und ein annähernd gleichgewichtiges Aushandeln der Löhne und der wesentlichen übrigen Arbeitsbedingungen ermöglicht werden[564]. Um diese Verhandlungsparität zu gewährleisten, sind auch Arbeitskampfmaßnahmen zulässig[565]. Für das Strafrecht ist damit auch eine wichtige Grenze des Bereichs tatbestandsmäßigen Verhaltens bei der Nötigung gesetzt. Umgekehrt gewährt Art. 9 Abs. 3 GG nicht die uneingeschränkte Befugnis, alle denkbaren Kampfformen einzusetzen[566]. Das Strafrecht ist damit nicht gänzlich ausgeschlossen, es muss aber grundsätzlich neutral sein[567].
252
Da es dem Recht außerdem verwehrt ist, eine konkrete Organisation assoziierten Individualverhaltens vorzuschreiben, kann das Strafrecht hier allenfalls Randbereiche betreffen und minimale Standards absichern[568]. Größere Bedeutung hat die Vereinigungsfreiheit insgesamt beim Zurückdrängen bestimmter Strafnormen, soweit etwa die gewerkschaftliche Präsenz im Betrieb, die gewerkschaftliche Betätigung in Betriebsräten oder die außergerichtliche Beratung der Mitglieder an sich Tatbestände mit einer allgemeinen Zwecksetzung erfüllen[569]. Das Zurückdrängen des Strafrechts an dieser Stelle entspricht freilich den aufgestellten wirtschaftstheoretischen Postulaten und zeigt die Konsistenz der verfassungsrechtlichen Rahmenordnung[570].
2. Integration der Wirtschaft in die Europäische Union und die Folgen für die Wirtschaftsverfassung
253
Konkretere Vorgaben für die Ausgestaltung der Wirtschaftsordnung folgen aus der supranationalen Einbindung der Bundesrepublik Deutschland in die Europäische Union. Für das Wirtschaftsstrafrecht sind diese Vorgaben indessen nicht von prinzipieller Bedeutung.
Die Unionsverträge erfüllen auf supranationaler Ebene zwar die Funktionen, die national einer Verfassung zukommen[571], und sie verpflichten die Union und ihre Mitgliedstaaten in den Art. 3 Abs. 3 EUV, 101 ff., 106 ff., 120 AEUV auf die Grundsätze einer offenen Marktwirtschaft mit freiem Wettbewerb[572]. Ebenso stellt die Europäische Union eine „in hohem Maße wettbewerbsfähige soziale Marktwirtschaft“ als wirtschaftspolitisches Leitprinzip in den Vordergrund[573]. Die Europäische Gemeinschaft garantiert damit eine wettbewerbsgesteuerte Marktwirtschaft als Wirtschaftsordnung[574], sodass es strukturell unmöglich ist, etwa eine Zentralverwaltungswirtschaft einzuführen[575].
254
Noch wenig geklärt ist aber, in welchem Umfang sich aus diesem Verständnis der Gemeinschaftsverträge Kompetenzen und Rechte der Einzelnen ergeben. Bis zu Beginn der neunziger Jahre des 20. Jahrhunderts wurden derartige Überlegungen kategorisch abgelehnt[576]. Mit der Grundrechtscharta der Europäischen Union wurden dann erstmals die Rechte des Einzelnen urkundlich betont[577]. Dogmatisch wurden in der Rechtsprechung spätestens im Jahr 2003 Tendenzen deutlich, Individualgrundrechte zunehmend als Schranken-Schranken wirtschaftlich determinierten Gemeinschafts- und Unionsrechts zu verstehen und beide Sachmaterien als gleichgewichtige Begründungsansätze des Rechts zu einer praktischen Konkordanz zu führen[578].
255
Für das Wirtschaftsstrafrecht führen diese supranationalen Vorgaben jedenfalls zu keinen grundlegenden konzeptionellen Änderungen. Da nationales und supranationales Grundsystem in weiten Teilen identisch sind, beschränken sich die Einwirkungen auf Einzelfälle. Das führt insbesondere zu erweiterten individuellen Handlungsspielräumen bei einer grenzüberschreitenden Freiheitsausübung, da im Rahmen der Europäischen Union dem Ziel der Marktintegration eine überragende Bedeutung zukommt und die Gemeinschaftsorgane bei der Verwirklichung dieser Ziele ein weit gespanntes, nicht aber uneingeschränktes Ermessen haben. Diese Integration darf indessen nicht beliebig zu Lasten eines hinreichenden Gesundheits-, Umwelt- oder Verbraucherschutzes verfolgt werden[579], sodass die Union gehalten ist, bei der Verfolgung der Ziele jenen Ausgleich sicherzustellen, den Widersprüche zwischen den verschiedenen Zielen erforderlich machen können[580]. Insgesamt kann dieser Aspekt damit bei der hier unternommenen funktionalen Analyse des Wirtschaftsstrafrechts außer Betracht bleiben.
3. Folgen der Integration der Wirtschaft in die Weltwirtschaft
256
Eine ähnlich geringe Bedeutung für die nachstehenden Überlegungen hat die Integration der Bundesrepublik in eine sich immer stärker verflechtende Weltwirtschaft. Auch weltweit setzt sich die marktwirtschaftliche Wirtschaftsordnung durch, sodass inzwischen mehr als neunzig Volkswirtschaften wettbewerbsrechtlich geordnet sind[581]. Dieser Erfolg und die Notwendigkeit, im globalen Handel hoheitliche Kompetenzen zunehmend auf supranationale und völkerrechtlich fundierte Einrichtungen zu übertragen[582], haben zwar mittelbar auch zu einem steigenden Einfluss wirtschaftsvölkerrechtlicher Vorgaben geführt[583]; für das Strafrecht sind diese bislang allerdings nur von randständiger Bedeutung.
Читать дальше