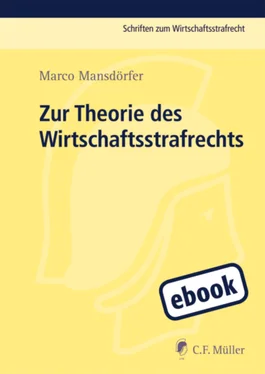257
Das Wirtschaftsvölkerrecht enthält heute im Wesentlichen Vereinbarungen über den Handel mit Waren oder Dienstleistungen sowie den Schutz von geistigem Eigentum[584]. Darüber hinaus bestehen zaghafte Ansätze zu einem internationalen Wettbewerbsrecht[585]. Auch hier werden aber durch das Prinzip der Nichtdiskriminierung und das Prinzip der offenen Märkte zumindest im Ansatz die Grundbedingungen für einen fairen Wettbewerb gewährleistet. Dazu wurde institutionell zum 1. Januar 1995 mit der Welthandelsorganisation (WTO) eine universelle internationale Organisation des Welthandels gegründet[586]. Eine der wichtigsten Aufgaben der WTO besteht darin, die gegenläufigen Ziele von freiem Handel einerseits und Umwelt- sowie Gesundheitsschutz andererseits zu einem praktischen Ausgleich zu bringen[587]. Nach Art. XVI Abs. 4 WTO muss jeder Mitgliedstaat außerdem sicherstellen, dass seine Gesetze, sonstigen Vorschriften und Verwaltungsverfahren mit den WTO-Vorgaben in Einklang stehen[588].
258
Konkrete Konfliktfelder zwischen dem Welthandelsrecht und dem europäisierten nationalen Wirtschaftsrecht sind etwa, das Verhältnis des auf nationaler und europäischer Ebene gewährleisteten Gesundheitsschutzes zu den Marktfreiheiten und das verbindliche Maß an Verbraucherschutz[589]. Das Welthandelsrecht ist mittlerweile so ausgestaltet, dass die letzte Definitionsmacht bei der WTO selbst sowie den ihr verbundenen internationalen Standardisierungsorganisationen liegt. Diese Kompetenz erweist sich wegen der mangelhaften Bindung dieser Institutionen an Grund- und Menschenrechte zwar als problematisch; rechtspraktisch führt die mangelnde Bindung aber nicht dazu, dass diese Rechte überhaupt nicht berücksichtigt werden können. Möglich bleibt sowohl eine menschenrechtskonforme Auslegung unbestimmter Rechtsbegriffe als auch auf politischer Ebene die Fortentwicklung des Völkervertragsrechts.
259
Für das Strafrecht kann dies freilich dazu führen, dass insbesondere etwa bei Gesundheitsschutz größere Gefahren rechtlich toleriert werden müssen als bei rein nationalen Sachverhalten. Folgen kann dies aber auch für konkrete Verhaltensnormprogramme etwa im Bereich der Produktsicherheit haben, sodass bestimmte Produkte etwa nicht zurückgerufen werden müssen und trotz bestehender Gefahren vertrieben werden dürfen. Mit dem zunehmenden Abbau staatlicher Handelshemmnisse zeigt sich außerdem das auf regionaler Ebene bereits aus der Ausarbeitung des Vertrags zur Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) bekannte Problem, dass Wettbewerbsbeschränkungen zunehmend durch private Marktteilnehmer aufgebaut werden. Theoretisch werden damit Fälle der Nötigung denkbar, die so früher nicht möglich gewesen waren, von der rechtstheoretischen Seite dagegen keine prinzipiell neuen Überlegungen erfordern.
260
In erster Linie sicherheitspolitischen Zwecken dienen dagegen Sanktionen des UN-Sicherheitsrats, die zu Embargos gegenüber Staaten oder seit 1999 auch zu gezielten Handelsverboten gegenüber Einzelpersonen, Gruppen oder Organisationen führen (sog. smart sanctions bzw. targeted sanctions)[590]. Praktisch bedeutsam wurden in letzter Zeit entsprechende Maßnahmen gegen den Irak, Afghanistan, die Taliban und Listen mit Personen, die im Verdacht stehen, internationale Terroristen zu unterstützen[591]. Die aus solchen Verboten resultierenden Handelsbeschränkungen für Dritte mit diesen Staaten bzw. Personen sind nur eine zwangsläufige Nebenfolge der Verbote, aber kein Welthandelsrecht im engeren Sinn, sondern Maßnahmen im Rahmen einer kontrollierten Außenwirtschaft.
Teil 1 Grundlagen zur Theorie des Wirtschaftsstrafrechts› D › II. Korrespondierende Aufgabenbereiche und Ziele der Staatstätigkeit
II. Korrespondierende Aufgabenbereiche und Ziele der Staatstätigkeit
261
Bereits aus der Beschreibung der wirtschaftsverfassungsrechtlichen Vorgaben für individuelles ökonomisches Verhalten wurde deutlich, dass dem Staat zunehmend eine Globalverantwortung für den Bestand und die Entwicklung der Gesellschaft in ökonomischer, sozialer und kultureller Sicht zugeschrieben wird[592]. Diese Entwicklung hat selbstverständlich Rückwirkungen auf das Aufgabenverständnis seitens der Hoheitsgewalt und ihre Aufgabenerfüllung[593]. Welches die wesentlichen Bereiche legitimer Staatstätigkeit in einer sozial korrigierten Marktwirtschaft sind, lässt sich anhand von drei von der Volkswirtschaftslehre herausgearbeiteten Grundfragen zeigen:
| 1. |
Was soll produziert werden? |
| 2. |
Wie soll produziert werden? |
| 3. |
Wie soll das Produktionsergebnis verteilt werden? |
1. Minimalvorgaben bezüglich Produktionszielen und Güterarten
262
Mit der Antwort auf die Frage, was produziert werden soll, wird die Art und der Umfang der Güter festgelegt, die zur Befriedigung der Bedürfnisse der Menschen in einer Volkswirtschaft dienen sollen[594]. Da die Bedürfnisse im Verhältnis zu den Möglichkeiten ihrer Befriedigung theoretisch wie praktisch unbegrenzt sind, muss zunächst eine Prioritätenliste erstellt werden. Die Wirtschaftsverfassung verhält sich in Bezug auf die Ausgestaltung dieser Prioritätenliste – solange diese Güter keine übermäßigen Gefahren in sich bergen – neutral. Aussagen, ob vorwiegend Sachgüter oder Dienstleistungen, Konsumgüter oder Produktionsgüter, Verbrauchs- oder Gebrauchsgüter, Existenz-, Kultur- oder Luxusgüter hergestellt werden sollen, sind der Wirtschaftsverfassung daher nicht zu entnehmen. Die Art der produzierten Güter und deren ökonomischer Verwendungszweck werden in wesentlichen Teilen der Selbststeuerung der Gesellschaft überlassen. Nur vereinzelt bestehen Vorgaben, die sich rechtlich aus Staatszielbestimmungen oder Grundrechten der Einzelnen und faktisch aus dem Entwicklungsstand der Volkswirtschaft ergeben. Für Strafrecht bleibt in diesem Bereich naturgemäß kaum Raum. Soweit dieses Feld der gesellschaftlichen Selbststeuerung überlassen bleibt, kann Strafrecht nur zur Gewährleistung der Grundbedingungen dieser Selbststeuerung eingesetzt werden. Strafnormen zum Schutz von Produktionszielen sind nicht, solche zum Schutz bestimmter Güterarten sind nur ausnahmsweise vorstellbar[595].
263
In Bezug auf die für eine Volkswirtschaft wesentlichen Güterarten lassen sich vor allem zwei Aufgaben legitimer Staatstätigkeit ausweisen: Erstens muss die Hoheitsgewalt bestimmen, ob und inwieweit Güter zu den freien bzw. zu den knappen Gütern gehören. Freie Güter sind solche, die als unbegrenzt verfügbar gelten und daher keinen Preis haben. Knappe Güter stehen dagegen nur in begrenztem Umfang zur Verfügung, müssen teilweise erst hergestellt werden und haben daher einen Preis. Naturgüter können durch hoheitliche Maßnahmen in knappe Güter verwandelt werden, indem für ihre Bereitstellung bzw. Inanspruchnahme – wie zum Beispiel für Wasser oder den Durchgang durch ein Tal – Kosten auferlegt werden. Eine Tendenz zur Verknappung natürlicher Güter folgt namentlich aus der Staatszielbestimmung des Umweltschutzes in Art. 20a GG und aus fiskalischen Interessen der hoheitlichen Hand. Zweitens muss festgelegt werden, welche Güter als Individualgüter und welche als Kollektivgüter anerkannt werden. Individualgüter, oft auch private Güter genannt, dienen ausschließlich zur Befriedigung der Bedürfnisse eines Einzelnen. Andere Personen sollen davon ausgeschlossen sein. Dieses Ausschlussprinzip gilt bei Kollektivgütern, zum Teil spricht man hier von öffentlichen Gütern, nicht. So kann etwa das Bedürfnis nach äußerer Sicherheit, nach einer öffentlichen Infrastruktur oder nach Märkten zwar von einer Einzelperson artikuliert, aber nur zusammen mit anderen Personen befriedigt werden[596]. Handlungsaufträge zur Gewährleistung öffentlicher Güter folgen vor allem aus dem Sozialstaatsprinzip, aus der Teilhabefunktion der Grundrechte, aber auch aus der Festlegung auf eine soziale Marktwirtschaft insgesamt. Der Hoheitsgewalt obliegen insoweit Vorsorgepflichten in Bezug auf Sachgüter und Dienstleistungen, die wegen einer fehlenden Gewinnaussicht nicht von privaten Wirtschaftssubjekten über den Markt bereitgestellt werden[597]. In der Sache sind solche öffentlichen Güter etwa Sicherheit, Bildung, Kultur oder Information. Hauptaufgabe strafrechtlicher Normen ist hier die Sicherung öffentlicher Güter und knapper Individualgüter sowie die Verknappung freier Güter entsprechend der hoheitlichen Planung durch die Sanktionierung eines übermäßigen Verbrauchs. Beispiele sind Strafnormen zum Schutz der Umwelt, der strafrechtliche Eigentumsschutz oder Tatbestände wie der Subventionsbetrug oder die Korruptionsdelikte, wenn dadurch die Bereitstellung öffentlicher Güter gesichert werden soll.
Читать дальше