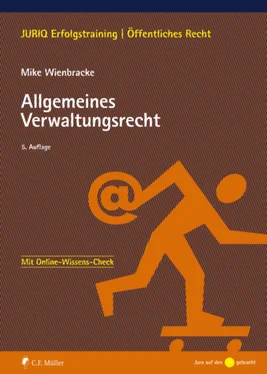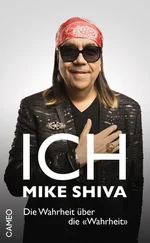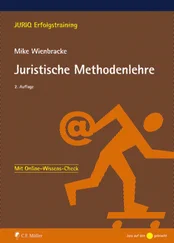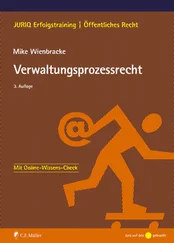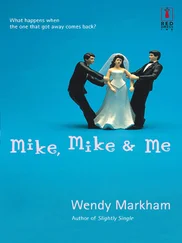Nein. Nach § 42 Abs. 1 Alt. 1 VwGO ist die Anfechtungsklage nur dann statthaft, wenn der Kläger die Aufhebung eines Verwaltungsakts begehrt. Das ist in Bezug auf die von B erklärte Aufrechnung allerdings gerade nicht der Fall. Die Aufrechnungserklärung ist – ähnlich wie die Erfüllung einer Geldschuld durch Zahlung eines Geldbetrags – für sich allein noch kein Verwaltungsakt i.S.v. § 42 Abs. 1 VwGO sowie § 35 S. 1 VwVfG. Vielmehr handelt es sich bei der Aufrechnung um die Ausübung eines schuldrechtlichen Gestaltungsrechts und erfolgt in der Regel gem. §§ 387, 388 BGB durch eine einseitige empfangsbedürftige Willenserklärung eines Schuldners, der zugleich der Gläubiger seines Gläubigers ist. Die Aufrechnungserklärung ist also eine Handlung, die der Erfüllung der eigenen Verbindlichkeit dient und dabei gleichzeitig die Befriedigung der eigenen Forderung bewirkt. Die Erklärung wird ohne Rücksicht darauf, ob die Aufrechnung seitens des Bürgers oder seitens der Behörde erfolgt und ob mit einer privatrechtlichen gegen eine öffentlich-rechtliche (§ 395 BGB), mit einer öffentlich-rechtlichen gegen eine privatrechtliche oder mit einer öffentlich-rechtlichen gegen eine öffentlich-rechtliche Forderung aufgerechnet wird, nicht aus einer hoheitlichen Position abgegeben. Sie ergeht damit ähnlich wie eine Willenserklärung, mit der ein öffentlich-rechtlicher Vertrag (Aufrechnungsvertrag) geschlossen wird, auf einer gleichgeordneten rechtlichen Ebene.
47
Die auf dem Gebiet des öffentlichen Rechts getroffene hoheitliche Maßnahme muss gem. § 35 S. 1 VwVfG zudem von einer „Behörde“vorgenommen worden sein, damit sie als Verwaltungsakt qualifiziert werden kann.

Der Legaldefinition des § 1 Abs. 4 VwVfG[46] zufolge ist unter dem Begriff Behörde– unabhängig von ihrer Bezeichnung[47] – „jede Stelle, die Aufgaben der öffentlichen Verwaltung wahrnimmt“, zu verstehen (funktioneller bzw. verwaltungsverfahrensrechtlicher Behördenbegriff[48]), wobei „Stelle“ wiederum jede durch Rechtssätze des öffentlichen Organisationsrechts geschaffene, überindividuelle, mit konkreten Verwaltungszuständigkeiten ausgestattete organisatorische Einheit eines Trägers der öffentlichen Verwaltung meint.[49]
48
Nicht um einen Verwaltungsakt ( Nicht-bzw. Scheinverwaltungsakt) handelt es sich daher zum einen dann, wenn das betreffende Verhalten nicht einer Behörde zugerechnet werden kann (z.B. Aufstellen eines Verkehrsschilds i.S.d. StVO durch einen [nicht beliehenen] Privaten ohne behördlichen Auftrag;[50] vgl. die Beispiele in Rn. 29und Rn. 52).
Hinweis
„Erforderlich, aber auch genügend für die Annahme eines Verwaltungsakts in Abgrenzung von einem Nichtakt (Scheinverwaltungsakt) ist dann, wenn die betreffende Maßnahme eine Behörde als Entscheidungsträger ausweist, intern jedoch ein Privater sie getroffen hat, dass die nach außen in Erscheinung tretende Behördedas Tätigwerden des Privaten als Geschäftsbesorger veranlasst hat, der Geschäftsbesorger also mit ihrem Wissen und Wollen tätig geworden ist. Hiervon kann nur gesprochen werden, wenn die von dem Geschäftsbesorger durchzuführende Tätigkeit ihrer Art und ihrem Umfang nach so hinreichend genau bestimmt ist, dass ohne Weiteres feststellbar ist, ob er sich im Rahmen der ihm übertragenen Tätigkeit gehalten hat.“ Dass die Behörde den Inhalt des Bescheids ggf. nicht kannte und ihn daher vor seinem Erlass nicht auf seine Richtigkeit hin überprüfen konnte, führt zu keiner anderen Beurteilung der Verwaltungsaktqualität.[51]
Zum anderen ist der Behördenbegriff auf die Wahrnehmung von Verwaltungsaufgabenbegrenzt, so dass Maßnahmen auf dem Gebiet der Gesetzgebung, der Regierung und der Rechtsprechung ebenfalls nicht unter § 35 S. 1 VwVfG fallen. Verfassungs-, prozess-, straf-, kirchen- und völkerrechtliche Tätigkeiten gehören zwar zum öffentlichen Recht, nicht aber zu dessen Teilbereich des Verwaltungsrechts und sind daher keine Verwaltungsakte. Aufgrund der funktionalen Definition des Behördenbegriffs in § 1 Abs. 4 VwVfG kann es allerdings durchaus vorkommen, dass auch Organe der Gesetzgebung sowie der Rechtsprechung einmal als „Behörde“ zu qualifizieren sind, nämlich dann, wenn sie im konkreten Fall Verwaltungsaufgaben wahrnehmen (z.B. Erteilung eines Hausverbots durch den Präsidenten des Bundestags bzw. den Gerichtspräsidenten).
JURIQ-Klausurtipp
Über § 35 S. 1 VwVfG hinaus kann der Begriff „Behörde“in der Klausurbearbeitung auch in folgenden Zusammenhängen relevant werden:
| • |
Zuständigkeit, vgl. § 3 VwVfG ( Rn. 140 ff.); |
| • |
Verwaltungsverfahren, siehe §§ 9 ff. VwVfG ( Rn. 150); |
| • |
Beteiligtenfähigkeit im Verwaltungsprozess, siehe § 61 Nr. 3 VwGO i.V.m. z.B. § 8 Abs. 1 BbgVwGG[52]; |
| • |
richtiger Klagegegner, siehe § 78 Abs. 1 Nr. 2 VwGO i.V.m. z.B. § 19 Abs. 2 AGVwGO Saarl.[53] |
49
Da sich der Behördenbegriff v.a. beim ersten Zugriff erfahrungsgemäß häufig nur schwer erschließt, wird nachfolgend eine Kurzdarstellung des zugrundeliegenden Verwaltungsorganisationsrechts gegeben:[54] Originärer Träger der öffentlichen Verwaltungist der Staat als Inhaber der ursprünglichen Herrschaftsgewalt. In der bundesstaatlichen Ordnung des Grundgesetzes (Art. 20 Abs. 1 GG) kommt neben dem Zentralstaat „Bundesrepublik Deutschland“ auch den einzelnen Gliedstaaten, d.h. den 16 Bundesländern, Staatsqualität[55] zu, vgl. auch Art. 30 GG; die Kommunen sind insoweit den Ländern zuzuordnen.
JURIQ-Klausurtipp
Die Bestimmung des Verwaltungsträgers ist v.a. im Rahmen von § 78 Abs. 1 Nr. 1 VwGOrelevant, wonach die Anfechtungs- und Verpflichtungsklage grundsätzlich gegen den Rechts-, d.h. Verwaltungsträger der Behörde zu richten ist. Bzgl. der allgemeinen Leistungsklage, der allgemeinen Feststellungsklage sowie des Normenkontrollverfahrens (§ 47 Abs. 2 S. 2 VwGO) gilt das Rechtsträgerprinzip ausnahmslos.[56]
Als juristische Personen(des öffentlichen Rechts) sind der Bund und die Länder zwar rechtsfähig, d.h. sie können Träger von Rechten und Pflichten sein, nicht jedoch auch handlungsfähig. Ebenso wie juristische Personen des Privatrechts (z.B. Aktiengesellschaft, AG) bedürfen daher auch der Bund und die Länder Organe, um handeln zu können.

Organesind organisatorisch – nicht aber: rechtlich – selbstständige und vom Wechsel ihrer Inhaber unabhängige Einrichtungen eines Verwaltungsträgers (z.B. Gemeinde), die dessen Zuständigkeit nach innen (z.B. Gemeinderat; vgl. im Privatrecht etwa den Aufsichtsrat der AG) und/oder außen (z.B. Bürgermeister; bei der AG: der Vorstand) für diesen wahrnehmen.[57]
Über welche und wie viele Organeeine juristische Person des öffentlichen Rechts verfügt, kann bei Trägern der mittelbaren Staatsverwaltung ( Rn. 50), die aufgrund des aus dem Demokratieprinzip folgenden institutionellen Gesetzesvorbehalts ( Rn. 15) über kein Organerfindungsrecht verfügen, nur durch oder aufgrund eines formellen Gesetzes bestimmt werden. Demgegenüber beruht die Errichtung staatlicher Behörden nicht stets auf einem Bundes- bzw. Landes(organisations)gesetz ( Rn. 140), sondern kann auch durch einen zuständigkeitsregelnden Organisationserlass – als atypischer Verwaltungsvorschrift mit Bindungswirkung gegenüber Gerichten und Bürgern ( Rn. 238 ff.) – erfolgen.
Читать дальше