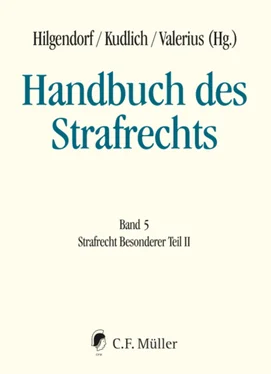8. Der subjektive Tatbestand
74
Der subjektive Tatbestand erfordert neben dem allgemeinen Vorsatz hinsichtlich des Vorliegens sämtlicher objektiver Tatbestandsmerkmale eine besondere Bereicherungsabsicht.
75
Der Vorsatz muss sich – wie auch sonst – auf das Vorliegen sämtlicher objektiver Tatbestandsmerkmale erstrecken, wobei ein bedingter Vorsatz jeweils ausreicht.[220] Der Täter muss also wissen, dass er durch sein Verhalten Gewalt anwendet oder dem Opfer droht bzw., dass das Opfer sein Verhalten als Drohung empfindet. Dies wird meist unproblematisch sein. Darüber hinaus muss er wissen oder es zumindest für möglich halten, dass das Opfer durch die Gewaltanwendung oder Drohung zu einem Verhalten genötigt wird, welches nicht seinem freien Willen entspricht und welches das Opfer ohne das Verhalten des Täters nicht vorgenommen hätte. Im Hinblick auf die Drohung reicht es aus, dass der Täter es für möglich hält, dass das Opfer an die Ernstlichkeit der Drohung glaubt und dadurch zu seinem Entschluss bestimmt wird.[221] Auch muss der Täter den Vorsatz haben, das Opfer (oder einen Dritten) in seinem Vermögen zu schädigen.[222] Es ist allerdings zu beachten, dass dieser Schädigungsvorsatz bereits zum Zeitpunkt der Gewaltanwendung bzw. dem Ausspruch der Drohung bestehen muss.[223] Ferner muss der Täter das Nötigungsmittel gerade zu dem Zweck einsetzen, die Vermögensverfügung beim Opfer herbeizuführen, insoweit ist also eine Finalität des Handelns erforderlich.[224] Außerdem muss sich der Vorsatz auch auf den Ursachen- und Zurechnungszusammenhang beziehen.[225] Dabei entfällt der diesbezügliche Vorsatz jedoch nicht deshalb, weil der Täter weniger Geld erbeutet als ursprünglich geplant.[226]
76
Da es sich bei der Erpressung um ein Vermögensverschiebungsdelikthandelt, ist die bloße Nachteilszufügung nicht ausreichend. Der Täter muss vielmehr handeln, „um sich oder einen Dritten zu Unrecht zu bereichern“. Die angestrebte Bereicherung ist also für die Vollendung der Tat nicht erforderlich, sie muss allerdings das Tatziel sein, es handelt sich insoweit um ein sog. „kupiertes Erfolgsdelikt“.[227] Einer Vollendung der Erpressung steht es also nicht entgegen, wenn das Opfer das erpresste Geld auf den Postweg gibt (im Moment der Absendung ist der Vermögensschaden eingetreten) und das Geld während dem Transport verloren geht.[228] § 253 StGB fordert dabei gerade die Absicht rechtswidriger Bereicherung. Die Voraussetzungen decken sich hier mit denjenigen des Betruges, § 263 StGB.[229]
77
Der Täter muss also zum Zeitpunkt der Tatbegehung (d.h. bei Einsatz des Nötigungsmittels)[230] jedenfalls irgendeine (materielle) Bereicherungim Sinne einer günstigeren Gestaltung der Vermögenslage erstreben. Eine solche kann bereits in einer bloßen Besitzerlangung,[231] dem Erhalt eines Kredits oder in der Erteilung eines gewinnbringenden Auftrags gesehen werden.[232] Allerdings wurde die Nötigung zum Abschluss eines wirtschaftlich ausgeglichenen Vertrages nicht als Vermögensvorteil angesehen,[233] was jedenfalls dann zweifelhaft ist, wenn der Vertrag eine (im üblichen Rahmen liegende) Gewinnspanne für den Nötigenden enthält. Keine Bereicherung soll auch in der bloßen Besitzerlangung einer Sache zum Zweck der Vernichtung derselben liegen.[234] Auch wer eine Sache (wie z.B. ein Mobiltelefon) einem anderen abnötigt, um diesen damit in eine hilflose Lage zu bringen, soll keine Bereicherung anstreben.[235] Der BGH lehnte es ferner ab, dem Standplatz einer Prostituierten einen Vermögenswert zuzusprechen.[236] Unzutreffend ist es hingegen, wenn der BGH[237] auch dem abgenötigten Geschlechtsverkehr mit einer Prostituierten einen Vermögenswert abspricht.[238] Wie beim Betrug scheidet eine Erpressung aber in denjenigen Fällen aus, in denen durch die Nötigung nur ein staatlicher Bußgeldanspruch oder eine vergleichbare staatliche Sanktion abgewendet werden soll.[239]
78
Problematisch ist eine solche (beabsichtigte) Bereicherung dann, wenn der Täter vorhat, die Vermögensgegenstände unmittelbar nach der Tat wieder zurückzugeben,[240] der Polizei auszuhändigen[241] oder zu vernichten.[242] Hier kommt es darauf an, ob der Täter die Vermögensgegenstände wenigstens kurzzeitig für einen bestimmten vermögensrechtlich relevanten Zweck benutzen möchte, z.B. wenn er die Herausgabe eines Autos erpresst, um dieses kurzfristig als Transportmittel zu verwenden.[243]
79
Der Täter muss ferner handeln, „um sich oder einen Dritten zu Unrecht zu bereichern“. Die Absicht muss somit auf eine rechtswidrigeBereicherung gerichtet sein. Trotz der unterschiedlichen Formulierung entspricht § 253 StGB auch in diesem Punkt der Regelung in § 263 StGB („sich […] einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen“).[244] Wer einen materiell-rechtlich existierenden Anspruch mit (unerlaubten) Nötigungsmitteln durchsetzt, macht sich demnach nicht wegen einer Erpressung strafbar,[245] da, wie auch beim Betrug, der eingetretene Vermögensvorteil hier durch den Wegfall der Forderung kompensiert wird. Allerdings wird es in diesen Fällen zumeist schon an einem Vermögensschaden des Opfers fehlen, sodass bereits der objektive Tatbestand nicht vorliegt. Dies gilt zumindest dann, wenn das Opfer zur Zahlung eines Geldbetrages genötigt wird und dadurch seine bestehende Zahlungsverpflichtung zivilrechtlich erlischt.[246] Jedenfalls macht die mit Nötigungsmitteln durchgesetzte Forderung den begehrten Vermögensvorteil nicht alleine wegen der Art und Weise seiner Durchsetzung rechtswidrig.[247] Trotz der Rechtmäßigkeit des Ziels (Befriedigung des materiell-rechtlichen Anspruchs) kann das hierzu eingesetzte Druckmittel zwar unerlaubt sein, es greift dann aber nicht § 253 StGB, sondern (lediglich) § 240 StGB.
80
Entscheidend ist, dass sich die Rechtswidrigkeit der Bereicherung – obwohl Bestandteil des subjektiven Tatbestandes – ausschließlich nach objektiven Kriterien und nicht nach dem Wissen und Wollen des Täters bestimmt. Dabei hat das Strafgericht diese Rechtswidrigkeit eigenständig zu prüfen, ist also nicht etwa an die Einschätzung des Zivilgerichts gebunden.[248] Allerdings muss der Täter auch und gerade hinsichtlich dieser Rechtswidrigkeit vorsätzlich handeln. Wer fälschlicherweise glaubt, einen Anspruch zu haben, unterliegt einem vorsatzausschließenden Tatbestandsirrtum.[249] Der BGH führt diesbezüglich – im Hinblick auf zugrunde liegende sitten- oder gesetzeswidrige Geschäfte (Drogenverkauf) – allerdings aus, ein solcher Tatbestandsirrtum liege nicht vor, wenn sich der Täter nur „nach den Anschauungen der einschlägig kriminellen Kreise als berechtigter Inhaber eines Zahlungsanspruchs gegen das Opfer“ fühlt[250] und daher weiß oder es jedenfalls für möglich hält und billigend in Kauf nimmt, dass er die „Forderung“ auf rechtlichem Wege nicht durchsetzen kann. Auf der anderen Seite stellt der BGH in einer weiteren Entscheidung, die einen (vermeintlichen) Anspruch aus Drogengeschäften betraf, fest: „Da bei der Erpressung die Rechtswidrigkeit des erstrebten Vermögensvorteils ein normatives Tatbestandsmerkmal ist, liegt auch bei rechtlich falscher Beurteilung des dem Täter bekannten wahren Sachverhalts ein den Vorsatz ausschließender Tatbestandsirrtum vor“.[251] Es ist jedoch darauf hinzuweisen, dass in denjenigen Fällen, in denen der Täter mit der Möglichkeit rechnet, dass ein entsprechender Anspruch nicht besteht oder ein bestimmter schuldrechtlicher Anspruch von der Rechtsordnung nicht toleriert wird, und er dies auch billigend in Kauf nimmt, ein jedenfalls bedingter Vorsatz vorliegt.[252] Dieser aber reicht hier aus, sodass in diesen Fällen ein Tatbestandsirrtum ausscheidet.[253] Wer andererseits irrtümlich glaubt, einen rechtswidrigen Anspruch durchzusetzen, der aber in Wirklichkeit der materiell-rechtlichen Rechtslage entspricht, begeht – je nachdem ob er über tatsächliche Umstände oder die rechtliche Bewertung irrt – entweder einen untauglichen Versuch oder ein Wahndelikt.
Читать дальше