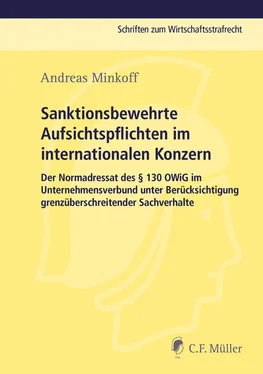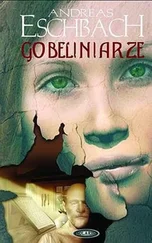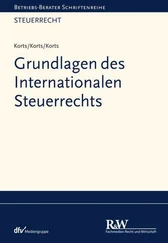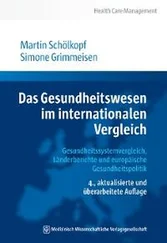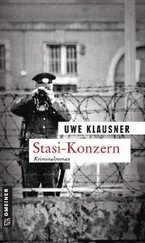Mit den modernen Erscheinungsformen von Konzernverbindungen hatten diese Formen der Bündelung dennoch wenig gemein. Die Voraussetzung von Konzernen im Sinne des heutigen Verständnisses schuf erst die erfolgreiche Verbreitung von Aktiengesellschaften, die allerdings bedeutend später einsetzte. Zwar wurden bereits im 15. Jahrhundert in Italien erste gemeinschaftliche Unternehmen gegründet, bei denen Papiere zur Legitimation der Eigentümer ausgegeben wurden.[3] Ihre wesentliche Gestalt erlangte die Aktiengesellschaft aber erst durch den französischen code de commerce im 18. Jahrhundert. Festgesetzt wurden darin eine Generalversammlung der Aktionäre, ein von dieser Versammlung abhängiger Vorstand als Geschäftsführungsorgan sowie ein Aufsichtsrat zur Kontrolle des Vorstandes.[4] Maßgeblich für die Etablierung dieser neuen Gesellschaftsform war vor allem der zunehmende Kapitalbedarf in der Zeit der industriellen Revolution.[5] Große Produktionsanlagen erforderten Kapital, das auch durch den Zusammenschluss mehrerer Einzelunternehmen als solches nicht zu verwirklichen war. Die Abkehr vom anfänglichen Konzessionssystem kurz vor der Reichsgründung sorgte ab 1870 schließlich dafür, dass auch in Deutschland die Verbreitung von Aktiengesellschaften erheblich zunahm.[6] Allein zwischen 1871 und 1873 wurden 500 neue Aktiengesellschaften gegründet.[7] Gab es in Preußen 1835 insgesamt 25 Unternehmen dieser Rechtsform,[8] waren es 1890 im Kaiserreich bereits 2383.[9] Nur 16 Jahre später sollten es 5060 Aktiengesellschaften sein.[10]
21
Die Aktien dieser in ihrer Anzahl zunehmenden Gesellschaften wurden aber nicht allein von Individualpersonen erworben und gehalten. Auch die Unternehmen selbst beteiligten sich untereinander. Ziel war vornehmlich die Schwächung oder gar Ausschaltung des Wettbewerbs durch Beherrschung ganzer Marktsegmente sowie die Sicherung von Rohstoffen.[11] Die Marktdominanz sollte daher nicht nur den Absatz stärken, sondern auch konjunkturelle Schwankungen absichern.[12]
22
Die zunehmende Konzernierung erfolgte dabei parallel zur – zunächst bedeutsameren – Bildung von Kartellen.[13] Beide Erscheinungen nahmen eine beachtliche Rolle in der weiteren Wirtschaftsentwicklung ein. Die durch sie beginnende Phase der Unternehmenskonzentration lässt sich in vier wesentliche Phasen einteilen.[14]
1. Erste Konzentrationsphase: Das Deutsche Kaiserreich
23
Sowohl Kartelle wie auch Konzernverflechtungen konnten sich in der deutschen Wirtschafts- und Rechtswirklichkeit zunächst weitgehend schrankenlos etablieren und dabei von einer vermeintlich nachteiligen Wirkung des freien Wettbewerbes profitieren.[15] Vor dem Hintergrund der konjunkturellen Interessenslage legitimierte auch das Reichsgericht in seiner bedeutenden Entscheidung zum Sächsischen Holzstoff-Fabrikanten-Verband die Zulässigkeit von Kartellen[16] und konnte sich dabei auf die herrschende Ansicht in der Rechtswissenschaft, aber auch auf die öffentliche Meinung stützen.[17] Und wenn es auch eine vollständige Selbstentmündigung von Aktiengesellschaften als unzulässig erachtete,[18] so waren der Rechtsprechung des Reichsgerichts dennoch zumindest keine Bedenken hinsichtlich der Beteiligung von juristischen Personen an anderen juristischen Personen zu entnehmen.[19] Anders war dies in den USA, wo der Sherman Anti-Trust Act vom 2.7.1890 sowohl Kartelle wie auch Unternehmensbeteiligungen untersagte und vielmehr ausschließlich vollständige Fusionen zur einzig zulässigen Form der Unternehmenskooperation erklärte.[20]
24
Vor allem die Minderheitsaktionäre genossen damit im deutschen Kaiserreich einen sehr viel beschränkteren Schutz, während die Erleichterung der Unternehmensleitung in den deutlich sichtbaren Vordergrund gerückt wurde. Im Grundsatz stand zwar gegen schädigende Einflussnahme durch den Mehrheitsaktionär bald die Schadensersatznorm des § 826 BGB zur Verfügung, aufgrund der strengen Anspruchsvoraussetzungen erwies sich dieser Schutz jedoch als nur sehr unzulänglich.[21]
2. Zweite Konzentrationsphase: Die Weimarer Republik
25
Auch wenn die Bedingungen zur Unternehmenskonzentration damit schon vor Ausbruch des Ersten Weltkrieges günstig waren, so war es vor allem die Inflation zu Beginn der 1920er Jahre, die der Entwicklung zusätzliche und entscheidende Geschwindigkeit verlieh. Die mit der drastischen Inflation verbundene Möglichkeit des Kapitaleinsatzes sorgte für einen Kampf um die Machtverhältnisse innerhalb von Aktiengesellschaften und legte den Grundstein für „industrielle Herzogtümer“.[22] Die Konzernierung überflügelte im Rahmen dieser Entwicklung bald die Kartellierung.[23] 1927 waren bereits 60 % des Aktienkapitals in Konzerne eingebunden,[24] von den insgesamt 9634 Aktiengesellschaften im Jahre 1932 bildeten 4060 Bestandteile von Unternehmensgruppen.[25] Von insgesamt 22,3 Milliarden RM, die das Gesamtkapital der Aktiengesellschaften zu dieser Zeit ausmachten, verfügten die konzerngebundenen Gesellschaften über 18,8 Milliarden RM.[26]
26
Die in der Gesetzgebung bis dahin noch nicht in besonderer Weise gewürdigte Erscheinung des Konzerns profitierte in dieser Phase von zwei entscheidenden Regelungen. Durch das sogenannte Schachtelprivileg wurde zum einen die Doppelbesteuerung von Konzernunternehmen verhindert.[27] Zum anderen nahm das zunächst durch die Rechtsprechung eingeführte Prinzip der Organschaft an, dass ein untergeordnetes Unternehmen Teil und damit Organ einer Gesamtkörperschaft sei.[28] Die bedeutende Konsequenz war der Wegfall der Umsatzsteuerpflicht auf konzerninterne Umsätze sowie die Möglichkeit des Ausgleichs von Gewinnen und Verlusten einzelner Konzerngesellschaften.[29] Maßgeblich für die Anerkennung als untergeordnetes Unternehmen war dabei die Frage nach der Möglichkeit der eigenen Willensbildung.[30] Hielt ein anderes Unternehmen die Mehrheit des stimmberechtigten Kapitals, wurde diese Möglichkeit regelmäßig verneint und die Organschaft angenommen.[31] Weitere Merkmale für das Vorliegen einer abhängigen Konzerngesellschaft konnten in der Verlustübernahme durch die herrschende Gesellschaft, die Identität der entscheidenden Verantwortungsträger der Unternehmen oder aber in einer Absichtserklärung der gemeinsamen Förderung der Obergesellschaft zu sehen sein.[32]
27
Aufgegeben wurde dabei auch das anfangs durch das Reichsgericht postulierte Selbstentmündigungsverbot.[33] Die Möglichkeit der vertraglichen Weisungsrechte wurde damit weiterer Katalysator konzernartiger Verbindungen und Verflechtungen. Muttergesellschaften profitierten darüber hinaus in dem bedeutsamen Bereich des Außenhaftungsrechts von weitreichendem Schutz. Für die Verbindlichkeiten von Tochterunternehmen musste sie nur in den selten bejahten Fällen der Durchgriffshaftung einstehen.[34] Auch im Rahmen der Innenhaftung musste das Interesse der abhängigen Unternehmen zunehmend einem übergeordneten Konzerninteresse zurückweichen. Nach der wohl herrschenden Meinung konnten Schädigungen der untergeordneten Konzernglieder mit Rücksicht auf das Gesamtkonzerninteresse jedenfalls dann nicht verhindert werden, wenn zugleich Abfindungsansprüche für Minderheitengesellschafter vorgesehen waren.[35]
28
In die Zwischenphase der beiden großen Kriege fielen neben diesen konzernfreundlichen Entwicklungen jedoch auch Elemente einer ersten Kehrtwende.[36] Insbesondere für Kartelle brachte die Kartellverordnung von 1923 erste Einschränkungen.[37] Auf die Konzernierung hatte dies jedoch kaum Einfluss.[38] Erst das Hereinbrechen der Weltwirtschaftskrise und die daraus resultierenden Zusammenbrüche von Konzernen führten zu – wenn auch zögerlichen – Reaktionen. Die für das Aktienrecht bedeutsame Notverordnung vom 19.9.1931[39] traf erstmalig – wenn auch nur wenige[40] – Regelungen zum Konzernrecht, insbesondere zur Rechnungslegung.[41] Fortan mussten unabhängige Abschlussprüfer jährliche Bilanzprüfungen durchführen,[42] der Jahresabschluss konnte zudem allein durch die Generalversammlung beschlossen werden.[43]
Читать дальше