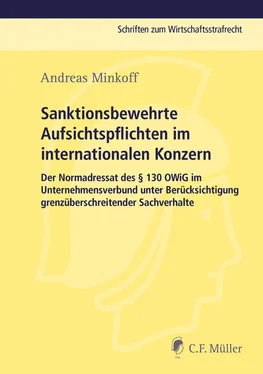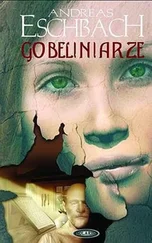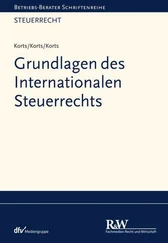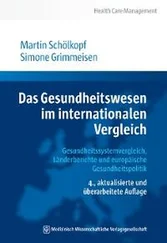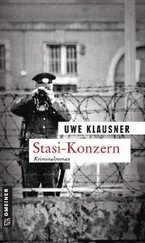13
Aufgrund der heute gängigen multinationalen Ausrichtung von Unternehmen wird sich die Untersuchung darüber hinaus um Klärung der Behandlung grenzüberschreitender Sachverhalte bemühen (Teil 5 Rn. 382 ff.). Dabei beginnt das Kapitel mit einer überblickartigen Einleitung zu den rechtlichen Rahmenbedingungen internationaler Konzerne sowie den Grundlagen zur räumlichen Geltung des Straf- und Ordnungswidrigkeitenrechts. Sodann wird die Anwendbarkeit des § 130 OWiG in zwei Richtungen geprüft werden. Zunächst erfolgt die Beurteilung der ordnungsrechtlichen Aufsichtspflichten inländischer Muttergesellschaften gegenüber ausländischen Tochtergesellschaften, ehe die entgegengesetzte Richtung der Aufsichtspflichten einer ausländischen Muttergesellschaft gegenüber inländischen Tochtergesellschaften und die insofern bestehenden Möglichkeiten der Sanktionierung nach deutschem Ordnungswidrigkeitenrecht erörtert werden. Das Kapitel soll abgerundet werden mit einem Blick auf die Rechtsfolgenseite, nicht unerwähnt bleiben soll insbesondere die Problematik der Doppelbestrafung.
14
Die Untersuchung schließt in ihrem Fazit mit einer Zusammenfassung der wichtigsten Thesen zur Beantwortung der Ausgangsfragen sowie einer Schlussbetrachtung (Teil 6 Rn. 481 ff.).
Teil 1 Einführung› D. Terminologie
15
Hinzuweisen ist bereits an dieser Stelle auf sprachliche Ungenauigkeiten, die in der rechtswissenschaftlichen Literatur im Zusammenhang mit dem Konzernrecht üblicherweise vorzufinden sind. Sofern sich Abhandlungen mit dem Konzernrecht auseinandersetzen, werden damit in den meisten Fällen die Regelungen über verbundene Unternehmen im Allgemeinen bezeichnet.[1] Der Konzern im engeren Sinne, dessen Legaldefinition sich in § 18 AktG findet, stellt jedoch lediglich eine Form der Unternehmensverbindung dar. Daneben werden etwa in § 16 AktG Unternehmen in Mehrheitsbesitz sowie in § 17 AktG Unternehmen in einem Abhängigkeitsverhältnis beschrieben. Sofern im Rahmen dieser Untersuchung die Bezeichnung des Konzernrechts aufgegriffen wird, folgt die Darstellung der rechtswissenschaftlichen Praxis und nimmt damit Bezug auf die Regelungen über die verbundenen Unternehmen im Ganzen. Im Rahmen des Aktiengesetzes sind dabei zum einen die Regelungen der §§ 15 bis 22 AktG relevant, die durch ihren Charakter als vor allem definierende Normen als allgemeiner Teil des Konzernrechts bezeichnet werden können. Daneben sind die Vorschriften der §§ 291 bis 328 AktG umfasst. Hier finden sich Bestimmungen über abhängige Aktiengesellschaften. Sofern die Unterscheidung der verschiedenen Formen von Unternehmensverbindungen für die Untersuchung Relevanz entfaltet, erfolgt freilich eine ausdrückliche Differenzierung unter Benennung der konkreten Art der Unternehmensverbindung.
16
Eine zweite sprachliche Klarstellung hat mit Blick auf die Begriffsverwendung im Rahmen der am Konzern beteiligten Gesellschaften zu erfolgen. Um die Lesbarkeit zu vereinfachen, werden mit den Begriffen Obergesellschaft, Muttergesellschaft oder auch Mutterunternehmen unterschiedliche Bezeichnungen verwendet, die jedoch synonym verstanden werden sollen. Gleiches gilt für die Begriffe Untergesellschaft, Tochtergesellschaft oder Tochterunternehmen. Wo mehrstufige Konzernverbindungen Erwähnung finden, wird überdies auch der Begriff der Enkelgesellschaft genutzt.
17
Ein weiterer terminologischer Hinweis ist schließlich mit Blick auf die Verwendung des Strafrechtsbegriffes angezeigt. Sofern hier von § 130 OWiG als eine der bedeutsamsten Regelungen des Wirtschaftsstrafrechts die Rede ist, mag dies missverständlich wirken. Denn die Norm ist eine solche des Ordnungswidrigkeitenrechts, das trotz unübersehbarer Nähe und Parallelen durch den Gesetzgeber vom Strafrecht abgegrenzt wurde. Dennoch erlangt das Ordnungswidrigkeitenrecht im Rahmen der Bekämpfung von Wirtschaftskriminalität große Bedeutung. Zurückzuführen ist dies mitunter auch auf die Regelung des § 30 OWiG, die es erlaubt, Bußgelder direkt gegen Unternehmen zu verhängen. Sofern für das Wirtschaftsstrafrecht das Ordnungswidrigkeitenrecht ganz wesentliche Bedeutung erlangt, erscheint es auch aufgrund der strukturellen Ähnlichkeit[2] angezeigt, insofern von einem umspannenden weiten Strafrechtsbegriff auszugehen, der das Ordnungswidrigkeitenrecht einschließt und sodann auch dieser Untersuchung zu Grunde gelegt wird.[3] Sofern Differenzierungen geboten sind, werden solche explizit bezeichnet.
[1]
Vgl. hierzu auch Bayer in: MK-AktG, § 15 AktG Rn. 6; Vetter in: Schmidt/Lutter, § 15 AktG Rn. 8; Habersack in: Emmerich/Habersack, Konzernrecht, § 1 Rn. 2; Theisen Der Konzern, S. 27; Koch in: Hüffer, § 15 AktG Rn. 2; Maier-Reimer in: Henssler/Strohn, § 15 AktG Rn. 1; Raiser/Veil Recht der Kapitalgesellschaften, § 50 Rn. 2.
[2]
Ähnlich Schünemann Unternehmenskriminalität, S. 7 f. So zeigt sich die enge Verknüpfung schon durch das strafrechtliche Gesetzlichkeitsprinzip, das auch im Ordnungswidrigkeitenrecht Geltung entfaltet, vgl. nur Rogall in: KK-OWiG, § 3 OWiG Rn. 1; Klesczewski Ordnungswidrigkeitenrecht, Rn. 70.
[3]
Siehe hierzu auch Rotsch in: Rotsch, Criminal Compliance, § 1 Rn. 11. Zur dogmatischen Abgrenzung von Ordnungswidrigkeiten- und Kernstrafrecht vgl. nur Gürtler in: Göhler, vor § 1 OWiG Rn. 4 ff.
Teil 2 Gesellschaftsrechtliche Grundlagen
Inhaltsverzeichnis
A. Einführung in das Konzernrecht
B. Erscheinungsformen des verbundenen Unternehmens
C. Auswirkungen auf den unternehmerischen Pflichten- und Haftungsumfang
D. Zusammenfassung
Teil 2 Gesellschaftsrechtliche Grundlagen› A. Einführung in das Konzernrecht
A. Einführung in das Konzernrecht
18
Die Relevanz des Konzerns ist mit Blick in die Praxis unübersehbar. Wie einführend dargelegt, ist jedenfalls die überwiegende Zahl der deutschen Kapitalgesellschaften Teil von Unternehmensverbindungen.[1] Der Konzern ist in der Unternehmenspraxis heute damit nichts anderes als die gängige Organisationsform.[2]
[1]
Vgl. insofern bereits oben die Nachweise in 2. Fn. zu Rn. 4.
[2]
So auch Theisen Der Konzern, S. 21; Wiesenack/Klein in: Eisele/Koch/Theile, S. 7; vgl. auch Raiser/Veil Recht der Kapitalgesellschaften, § 50 Rn. 1; Görling Konzernhaftung, S. 27, 47 ff.; van Vormizeele WuW 2010, 1008 (1008).
Teil 2 Gesellschaftsrechtliche Grundlagen› A. Einführung in das Konzernrecht› I. Historische Entwicklung des Konzernrechts
I. Historische Entwicklung des Konzernrechts
19
Die Wurzeln dieser heute die globale Wirtschaftslandschaft so prägenden Erscheinung reichen weit in die Vergangenheit. Insbesondere die Idee der Bündelung von Arbeitskraft und Arbeitsmitteln unter einer koordinierenden, einheitlichen Leitung bei gleichzeitiger Erhaltung einer gewissen Selbstständigkeit ist bereits in der frühen Wirtschaftsgeschichte zu finden. Der nicht selten auch freiwillige Zusammenschluss von Bauern unter einer Grundherrschaft begann bereits gegen Ende des 6. Jahrhunderts im fränkischen Reich.[1] War hier jedoch noch der erhoffte Schutz vor Anderen wesentlicher Anstoß des Zusammenschlusses, waren es im Rahmen der Etablierung der Zünfte, beginnend ab dem 12. Jahrhundert in Italien, bereits Motive, die einem modernen Ökonomieverständnis sehr nahe kommen. Wesentliches Merkmal war mitunter die Reduzierung des Wettbewerbs und die Förderung der Produktion, etwa durch Nutzung gemeinsamer Einrichtungen.[2]
20
Читать дальше