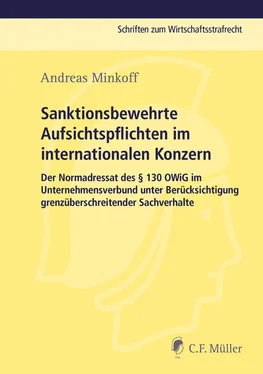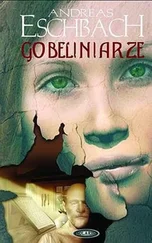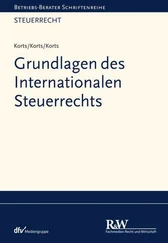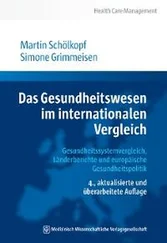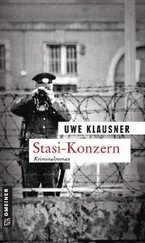Meiner Mutter
Vorwort Vorwort Die vorliegende Arbeit wurde im Sommersemester 2015 von der Juristischen Fakultät der Ludwig-Maximilians-Universität München als Dissertation angenommen und durch diese mit dem Fakultätspreis 2015 ausgezeichnet. Rechtsprechung und Literatur konnten bis Anfang 2015 Berücksichtigung finden. Sehr gerne möchte auch ich die Gelegenheit ergreifen, das Vorwort der Dissertation zur Danksagung zu nutzen. Dabei hatte ich das unschätzbare Glück, auf eine Vielzahl an Personen getroffen zu sein, die mein Fortkommen weit über das Maß der Selbstverständlichkeit hinaus gefördert haben. In diesem Rahmen ist es mir kaum möglich, sie alle beim Namen zu nennen oder gar ihnen allen gebührend zu danken. Mir bleibt nur die Möglichkeit, einige Personen herauszustellen. An erster Stelle nennen möchte ich dabei Frau Professor Dr. Petra Wittig, die nicht nur diese Arbeit betreute, sondern überdies meine bisherige juristische Laufbahn von Beginn an begleitet und maßgeblich geprägt hat. Meinen Dank hier im ausreichenden Maße auszudrücken ist sicher nicht möglich. Eine großartigere Professorin kann sich schlichtweg niemand wünschen. Mein Dank gebührt zudem Herrn Professor Dr. Armin Engländer für die zügige Erstellung des Zweitgutachtens sowie Herrn Professor Dr. Thomas Rotsch, Herrn Professor Dr. Mark Deiters und Herrn Professor Dr. Mark A. Zöller für die Aufnahme der Arbeit in diese Schriftenreihe. Danken möchte ich darüber hinaus für so vieles meinen Freunden Florian Weiß und Tim Kreysing. Daneben gebührt mein Dank der Kanzlei ROXIN Rechtsanwälte LLP. Durch den ständigen Blick in die Praxis wurde die vorliegende Untersuchung ganz wesentlich beeinflusst. Mein Dank gilt dabei an erster Stelle Herrn Dr. Oliver Sahan – freilich ohne mich auf seine Unterstützung im Rahmen meiner Promotion zu beschränken. Zu Dank verpflichet bin ich zudem Frau Dr. Imme Roxin und Herrn Michael Reinhart sowie – für die für mich so wertvollen Gespräche und Diskussionen – Herrn PD Dr. Ken Eckstein und meinem ehemaligen Kollegen Herrn Dr. Christian Corell. Nicht unerwähnt bleiben dürfen zudem RiLG Tobias Dallmayer und Michael Grieger. In besonderer Weise möchte ich außerdem Alexander Schemmel meinen Dank aussprechen. All dies gilt schließlich auch für die wichtigsten Personen in meinem Leben und damit für meine Frau, meine Schwester sowie meine Eltern. Ihnen gebührt mein größter Dank – für einfach Alles. Widmen möchte ich die Arbeit von ganzem Herzen meiner Mutter Katharina Gabriele Minkoff. München, im Februar 2016 Andreas Minkoff
Abkürzungsverzeichnis
Teil 1 Teil 1 Einführung Inhaltsverzeichnis A. Problemaufriss B. Eingrenzung des Untersuchungsthemas C. Gang der Untersuchung D. Terminologie
Einführung Teil 1 Einführung Inhaltsverzeichnis A. Problemaufriss B. Eingrenzung des Untersuchungsthemas C. Gang der Untersuchung D. Terminologie
A. Problemaufriss
B. Eingrenzung des Untersuchungsthemas
C. Gang der Untersuchung
D. Terminologie
Teil 2 Gesellschaftsrechtliche Grundlagen
A. Einführung in das Konzernrecht
I. Historische Entwicklung des Konzernrechts
1. Erste Konzentrationsphase: Das Deutsche Kaiserreich
2. Zweite Konzentrationsphase: Die Weimarer Republik
3. Dritte Konzentrationsphase: Das nationalsozialistische Reich
4. Vierte Konzentrationsphase: Der Anfang der Bundesrepublik
II. Bedeutung und Gefahren der Konzernierung
1. Ursachen für Konzernbildung und Unternehmenskonzentration
2. Gefahren der Konzernierung
B. Erscheinungsformen des verbundenen Unternehmens
I. Allgemeine Regelungen
II. Mehrheitsbeteiligung gem. § 16 AktG
III. Abhängigkeit gem. § 17 AktG
IV. Der Konzern gem. § 18 AktG
1. Eingliederungskonzern, Vertragskonzern, und faktischer Konzern
a) Eingliederungskonzern
b) Vertragskonzern
c) Faktischer Konzern
2. Gleichordnungs- und Unterordnungskonzern
V. Wechselseitig beteiligte Unternehmen gem. § 19 AktG
C. Auswirkungen auf den unternehmerischen Pflichten- und Haftungsumfang
I. Konzernleitungsmacht und -pflicht
1. Möglichkeiten der Konzernleitung
2. Pflicht zur Konzernleitung
a) Pflicht zur Konzernleitung gegenüber der abhängigen Gesellschaft
b) Pflicht zur Konzernleitung gegenüber der eigenen Gesellschaft
aa) Keine umfassende Konzernleitungspflicht
bb) Pflicht zur Wahrung der gesellschaftlichen Interessen
II. Kontroll- und Überwachungspflichten
1. Gesellschaftsrechtliche Überwachungspflichten im Einzelunternehmen
2. Gesellschaftsrechtliche Überwachungspflichten im Unternehmensverbund
III. Haftungsdurchgriff
IV. Deliktsrechtliche Haftungsfolgen
D. Zusammenfassung
Teil 3 Überblick der strafrechtlichen Verantwortlichkeiten im Konzern
A. Grundlagen des Unternehmensstrafrechts
B. Aktive Begehung durch die Konzernspitze
I. Form der Strafbarkeit
II. Sonderdelikte
1. Auswirkungen der Konzernierung auf Ebene der Organ- und Vertreterhaftung
2.Sonderfall Untreue
C. Strafbarkeit durch Unterlassen
I. Die Produkthaftung
II. Die Geschäftsherrenhaftung
1. Geschäftsherrenhaftung auf Ebene des Einzelunternehmens
2. Geschäftsherrenhaftung auf Konzernebene
III. Garantenpflichten kraft Übernahme eines Pflichtenkreises
D. Zusammenfassung
Teil 4 Der Konzern im Rahmen des § 130 OWiG
A. Die Regelung des § 130 OWiG
I.Regelungsinhalt
1. Die Aufsichtspflichtverletzung i.S.d. § 130 OWiG
a)Normadressaten
aa) Betrieb und Unternehmen
bb) Inhaberschaft
b) Tathandlung
c) Anknüpfungstat
aa) Der Terminus der Zuwiderhandlung
bb) Die Betriebsbezogenheit der Pflichtverletzung
cc) Der Täterkreis der Zuwiderhandlung
dd) Die Zurechnung der Zuwiderhandlung
d) Subjektiver Tatbestand
2. Das Haftungssystem der §§ 9, 30, 130 OWiG
II. Rechtsnatur
III. Regelungszweck
IV. Relevanz der Regelung heute
B. Anwendbarkeit auf Konzernsachverhalte
I. § 130 OWiG auf Konzernebene in der Praxis
1. Bußgeldbescheid der Staatsanwaltschaft München I gegen die Siemens AG
2. Bußgeldbescheid der Staatsanwaltschaft München I gegen die MAN Nutzfahrzeuge AG
3. Bußgeldbescheid des Bundeskartellamts gegen die Etex Holding GmbH
4. Beschluss des Bundesgerichtshofes vom 1.12.1981
5. Beschluss des OLG München vom 23.9.2014
II. Dogmatische Begründungsansätze
1. Die Konzernobergesellschaft als Inhaber des Tochterunternehmens
2. Der Konzern als Unternehmen
a) Annäherung über das allgemeine Wirtschaftsverständnis
b) Der Konzern als Unternehmen im europäischen Kartellrecht
aa) Urteil des Europäischen Gerichtshofes vom 14.7.1972 – ICI/Kommission
bb) Urteil des Europäischen Gerichtshofes vom 12.7.1984 – Hydrotherm/Compact
cc) Urteil des Europäischen Gerichtshofes vom 10.9.2009 – Akzo Nobel
dd) Folgen für den Unternehmensbegriff
c) Der Unternehmensbegriff im nationalen Kartellrecht
d) Der Unternehmensbegriff im Aufsichtsrecht
e) Der Unternehmensbegriff im allgemeinen Zivil- und Gesellschaftsrecht
f) Begriffsbestimmung im Rahmen des § 130 OWiG
3. Stellungnahme
a) Ausgangspunkt Wortlaut und Zweckbestimmung
b) Ablehnung des vereinheitlichenden Unternehmensbegriffes
c) Ablehnung der wirtschaftlichen Inhaberschaft
d) Ablehnung der rechtlichen Inhaberschaft
e) Die organisationsbasierte Inhaberschaft
f) Erfasste Unternehmensverbindungen
aa) Aktienkonzerne
bb) GmbH-Konzerne
cc) Unternehmensverbindungen unter Beteiligung sonstiger Rechtsformen
Читать дальше