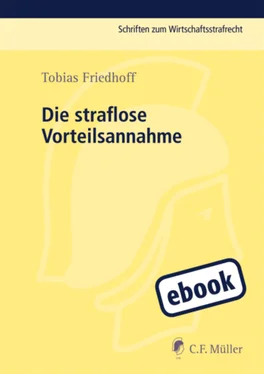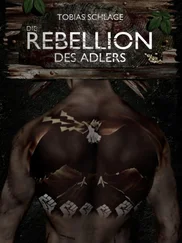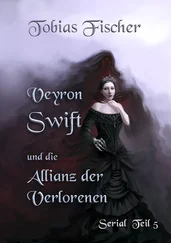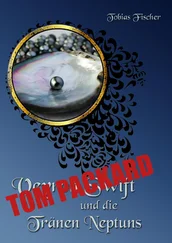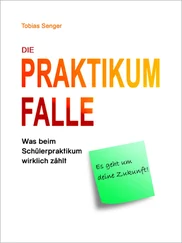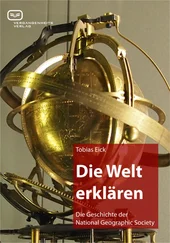II. Die Auswirkungen des ultima-ratio-Prinzips auf die Vorteilsannahme
III.Die Überkriminalisierung von Handlungen durch den Tatbestand
1. Die Vorteile einer Überkriminalisierung für den Gesetzgeber
2. Die Folge der Überkriminalisierung von Verhaltensweisen – der verängstigte Bürger
IV. Die Erfassung nicht ausreichend sozialschädlicher Handlungen durch § 331 Abs. 1 StGB im Konflikt mit dem ultima-ratio-Prinzip
B. Die Restriktionen des Tatbestandes im Rahmen des Vorteilsbegriffs
I. Vorgeschlagene Restriktionsmöglichkeiten im Rahmen des Vorteilsbegriffs
II. Kritische Bewertung der Restriktionsmöglichkeit im Rahmen des Vorteilsbegriffs
1. Kritik an der Ansicht, die Geringwertigkeit der Zuwendung lasse das Tatbestandsmerkmal „Vorteil“ objektiv entfallen
a) Der Wert des Vorteils entscheidet nicht über die tatbestandliche Qualifizierung einer Zuwendung als Vorteil
b) Untragbare Ergebnisse im Hinblick auf die §§ 332, 334 StGB
2. Kritik an der Ansicht, dass geringwertige Vorteile die Unrechtsvereinbarung entfallen lassen
a) Bloße Verlagerung der Problematik in den Bereich der Sozialadäquanz
b) Bestehen einer Gefahr für das Rechtsgut des § 331 StGB auch bei geringwertigen Vorteilen
c) Benachteiligung von Personen mit höherem gesellschaftlichen Status
d) Untragbare Ergebnisse im Hinblick auf die §§ 332, 334 StGB
3. Ergebnis
C. Die Restriktionen des Tatbestandes durch die Sozialadäquanz im Rahmen der Unrechtsvereinbarung
I.Die dogmatische Einordnung der Sozialadäquanz durch die Literatur
1. Die Lehre von der Sozialadäquanz nach Welzel
2.Die Sozialadäquanz als eigenständiges Merkmal des Unrechtstatbestandes oder als Ausfluss einer am Rechtsgut ausgerichteten Auslegung?
a) Die Ansicht von Eser
b) Die Ansicht von Roxin
c) Eigene Ansicht: Die Sozialadäquanz des Verhaltens bestimmt sich nach dem zu schützenden Rechtsgut des Tatbestandes
II.Die Sozialadäquanz im Hinblick auf § 331 StGB in Literatur und Rechtsprechung
1. Die Sozialadäquanz als Wegbereiterin für ein „case law“ im Rahmen der Vorteilsannahme?
2. Die allgemeine Beschreibung des Begriffs der Sozialadäquanz
3.Das Problem der Allgemeingültigkeit von sozialadäquaten Verhaltensweisen
a) Einzelfallgerechtigkeit contra Rechtssicherheit?
b) Das Problem der Einzelfallbewertung unter besonderer Berücksichtigung der „Branchenüblichkeit“ von Zuwendungen
4. Ablehnung des Merkmals der Sozialadäquanz durch Stimmen der Literatur
III.Stellungnahme zum Kriterium der Sozialadäquanz
1. Die Gefahr der Einordnung eines Verhaltens als strafbar oder straflos aufgrund eines Rechtsgefühls
2. Die Berufung auf die Sozialadäquanz in der Rechtsprechung als Folge einer schlechten Tatbestandsformulierung
Teil 4 Die Vereinbarkeit des Tatbestandes der Vorteilsannahme mit dem Bestimmtheitsgebot
A. Das Bestimmtheitsgebot (lex certa)
I. Die Verwendung von Generalklauseln und unbestimmten Rechtsbegriffen durch den Gesetzgeber und die Bewertung durch das BVerfG
1. Problemaufriss: Die Verwendung von Generalklauseln und unbestimmten Rechtsbegriffen
2. Vom BVerfG aufgrund des Verstoßes gegen Art. 103 Abs. 2 GG für nichtig erklärte strafrechtliche Tatbestände
3. Die Kriterien des BVerfG für die Annahme von ausreichend bestimmten Straftatbeständen
4. Kritische Anmerkung zum historischen Kriterium des BVerfG
II. Die Optimierungspflicht des Gesetzgebers im Hinblick auf die Bestimmtheit von Straftatbeständen
III. Unbestimmtheit durch Auslegung der Tatbestandsmerkmale trotz Bestimmtheit des Tatbestandes
B. Steigen die Bestimmtheitsanforderungen an einen Straftatbestand proportional zu dessen Strafandrohung?
I. Der gedankliche Hintergrund zur Ansicht des BVerfG – das Verhältnismäßigkeitsargument
II. Der erhöhte „Risikobereich“ bei Tatbeständen mit niedriger Sanktionsdrohung
III. Folgerungen für die Kriterien des BVerfG zur Bewertung der Bestimmtheit von Tatbeständen
C. Die Sozialadäquanz als strafbarkeitsbegrenzendes Merkmal im Konflikt mit dem Bestimmtheitsgebot
I. Die Unrechtsvereinbarung als das unbestimmte Merkmal des § 331 Abs. 1 StGB?
II. Die fehlende Erkennbarkeit des Strafbarkeitsrisikos bei unklaren Kriterien für eine Tatbestandsrestriktion für Bürger und Strafverfolgungsorgane
1. Keine sichere Einschätzungsmöglichkeit für den Bürger hinsichtlich der strafrechtlichen Relevanz seines Verhaltens
2. Keine sichere Einschätzungsmöglichkeit für die Strafverfolgungsbehörden und daraus resultierende Gefahr der „Verfolgung Unschuldiger“ – der EnBW-Fall
III. Die Verletzung des Bestimmtheitsgrundsatzes durch das Kriterium der Sozialadäquanz und durch das Fehlen nicht abschließender Kriterien für deren Annahme bzw. Verneinung
IV.Keine geringeren Bestimmtheitsanforderungen aufgrund des tatbestandsbeschränkenden Charakters der Sozialadäquanz
1. Sozialadäquanz vergleichbar mit der Verwerflichkeitsklausel?
2. Die Sozial(in)adäquanz als strafbarkeitsbegründendes Merkmal
V. Die Genehmigungsmöglichkeit des § 331 Abs. 3 StGB im Konflikt mit dem Bestimmtheitsgebot
1. Geringere Erkennbarkeit einer möglichen Strafbarkeit durch die mutmaßliche und nachträgliche Genehmigung
2. Probleme hinsichtlich der Tatsache, dass die Bestimmung der Strafbarkeit Aufgabe des Gesetzgebers ist
VI. Die §§ 332, 334 StGB als Beispiel für eine gute Tatbestandsformulierung
VII. Fazit und Schlussfolgerungen
Teil 5 Die Vorteilsannahme in Österreich und der Schweiz
A. Strafrechtsvergleichender Teil – Österreich
I.Die Entwicklung der in Österreich den Tatbeständen der Vorteilsannahme und Vorteilsgewährung entsprechenden Tatbestände seit 2007 bis zum Korruptionsstrafrechtsänderungsgesetz 2009
1. Die in Österreich den Tatbeständen der Vorteilsannahme und Vorteilsgewährung entsprechenden Tatbeständen vor 2008
a) Die Geschenkannahme durch Beamte für pflichtgemäße Vornahmen oder Unterlassungen eines Amtsgeschäfts
aa) Der Wortlaut des Tatbestandes „Geschenkannahme durch Beamte“
bb) Die Tatbestandsmerkmale, insbesondere das Erfordernis einer konkreten Amtshandlung
b)Die Bestechung für pflichtgemäße Vornahmen oder Unterlassungen eines Amtsgeschäfts
aa) Der Wortlaut des Tatbestandes „Bestechung“
bb) Der Tatbestand im Vergleich zu § 304 öStGB (vor 2008)
2. Die Ausweitung des Tatbestandes der Vorteilsannahme und Vorteilsgewährung durch das Strafrechtsänderungsgesetz 2008
a)Der Tatbestand der „Geschenkannahme durch Amtsträger oder Schiedsrichter“
aa) Der Wortlaut des Tatbestandes „Geschenkannahme durch Amtsträger oder Schiedsrichter“
bb) Die Änderungen gegenüber dem Tatbestand vor 2008
b)Der Tatbestand der „Bestechung“
aa) Der Wortlaut des Tatbestandes der „Bestechung“
bb) Die Unterschiede zwischen dem Tatbestand der „Bestechung“ und dem Tatbestand der „Geschenkannahme durch Amtsträger oder Schiedsrichter“
c) Die Gründe des österreichischen Gesetzgebers für die Ausweitung der Strafbarkeit
d) Kritische Stimmen aus der österreichischen Literatur zur Ausweitung der Strafbarkeit
3. Die Wiedereinschränkung der Strafbarkeit der Vorteilsannahme und der Vorteilsgewährung durch das Korruptionsstrafrechtsänderungsgesetz 2009
a) Die Tatbestände der Vorteilsannahme und der Bestechlichkeit
aa) Der Wortlaut der Tatbestände der Vorteilsannahme und der Bestechlichkeit
bb)Die Änderungen der §§ 305, 304 öStGB n. F. gegenüber dem Tatbestand der „Geschenkannahme durch Amtsträger und Schiedsrichter“, § 304 öStGB (2008)
(1) Die Unterscheidung zwischen pflichtgemäßem und pflichtwidrigem Handeln des Amtsträgers
Читать дальше