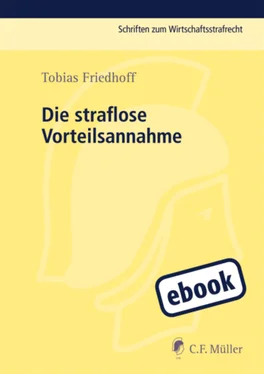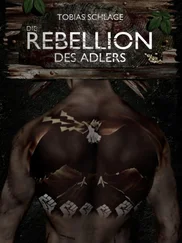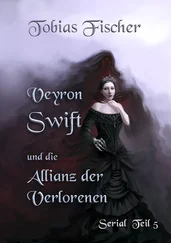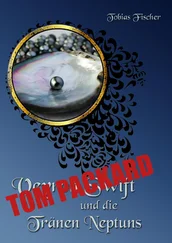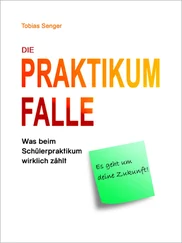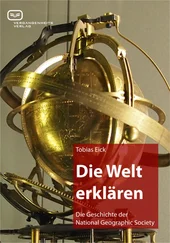III. Unbestimmtheit durch Auslegung der Tatbestandsmerkmale trotz Bestimmtheit des Tatbestandes
B. Steigen die Bestimmtheitsanforderungen an einen Straftatbestand proportional zu dessen Strafandrohung?
I. Der gedankliche Hintergrund zur Ansicht des BVerfG – das Verhältnismäßigkeitsargument
II. Der erhöhte „Risikobereich“ bei Tatbeständen mit niedriger Sanktionsdrohung
III. Folgerungen für die Kriterien des BVerfG zur Bewertung der Bestimmtheit von Tatbeständen
C. Die Sozialadäquanz als strafbarkeitsbegrenzendes Merkmal im Konflikt mit dem Bestimmtheitsgebot
I. Die Unrechtsvereinbarung als das unbestimmte Merkmal des § 331 Abs. 1 StGB?
II. Die fehlende Erkennbarkeit des Strafbarkeitsrisikos bei unklaren Kriterien für eine Tatbestandsrestriktion für Bürger und Strafverfolgungsorgane
1. Keine sichere Einschätzungsmöglichkeit für den Bürger hinsichtlich der strafrechtlichen Relevanz seines Verhaltens
2. Keine sichere Einschätzungsmöglichkeit für die Strafverfolgungsbehörden und daraus resultierende Gefahr der „Verfolgung Unschuldiger“ – der EnBW-Fall
III. Die Verletzung des Bestimmtheitsgrundsatzes durch das Kriterium der Sozialadäquanz und durch das Fehlen nicht abschließender Kriterien für deren Annahme bzw. Verneinung
IV.Keine geringeren Bestimmtheitsanforderungen aufgrund des tatbestandsbeschränkenden Charakters der Sozialadäquanz
1. Sozialadäquanz vergleichbar mit der Verwerflichkeitsklausel?
2. Die Sozial(in)adäquanz als strafbarkeitsbegründendes Merkmal
V. Die Genehmigungsmöglichkeit des § 331 Abs. 3 StGB im Konflikt mit dem Bestimmtheitsgebot
1. Geringere Erkennbarkeit einer möglichen Strafbarkeit durch die mutmaßliche und nachträgliche Genehmigung
2. Probleme hinsichtlich der Tatsache, dass die Bestimmung der Strafbarkeit Aufgabe des Gesetzgebers ist
VI. Die §§ 332, 334 StGB als Beispiel für eine gute Tatbestandsformulierung
VII. Fazit und Schlussfolgerungen
Teil 5 Die Vorteilsannahme in Österreich und der Schweiz
A. Strafrechtsvergleichender Teil – Österreich
I.Die Entwicklung der in Österreich den Tatbeständen der Vorteilsannahme und Vorteilsgewährung entsprechenden Tatbestände seit 2007 bis zum Korruptionsstrafrechtsänderungsgesetz 2009
1. Die in Österreich den Tatbeständen der Vorteilsannahme und Vorteilsgewährung entsprechenden Tatbeständen vor 2008
a) Die Geschenkannahme durch Beamte für pflichtgemäße Vornahmen oder Unterlassungen eines Amtsgeschäfts
aa) Der Wortlaut des Tatbestandes „Geschenkannahme durch Beamte“
bb) Die Tatbestandsmerkmale, insbesondere das Erfordernis einer konkreten Amtshandlung
b)Die Bestechung für pflichtgemäße Vornahmen oder Unterlassungen eines Amtsgeschäfts
aa) Der Wortlaut des Tatbestandes „Bestechung“
bb) Der Tatbestand im Vergleich zu § 304 öStGB (vor 2008)
2. Die Ausweitung des Tatbestandes der Vorteilsannahme und Vorteilsgewährung durch das Strafrechtsänderungsgesetz 2008
a)Der Tatbestand der „Geschenkannahme durch Amtsträger oder Schiedsrichter“
aa) Der Wortlaut des Tatbestandes „Geschenkannahme durch Amtsträger oder Schiedsrichter“
bb) Die Änderungen gegenüber dem Tatbestand vor 2008
b)Der Tatbestand der „Bestechung“
aa) Der Wortlaut des Tatbestandes der „Bestechung“
bb) Die Unterschiede zwischen dem Tatbestand der „Bestechung“ und dem Tatbestand der „Geschenkannahme durch Amtsträger oder Schiedsrichter“
c) Die Gründe des österreichischen Gesetzgebers für die Ausweitung der Strafbarkeit
d) Kritische Stimmen aus der österreichischen Literatur zur Ausweitung der Strafbarkeit
3. Die Wiedereinschränkung der Strafbarkeit der Vorteilsannahme und der Vorteilsgewährung durch das Korruptionsstrafrechtsänderungsgesetz 2009
a) Die Tatbestände der Vorteilsannahme und der Bestechlichkeit
aa) Der Wortlaut der Tatbestände der Vorteilsannahme und der Bestechlichkeit
bb)Die Änderungen der §§ 305, 304 öStGB n. F. gegenüber dem Tatbestand der „Geschenkannahme durch Amtsträger und Schiedsrichter“, § 304 öStGB (2008)
(1) Die Unterscheidung zwischen pflichtgemäßem und pflichtwidrigem Handeln des Amtsträgers
(2) Das Erfordernis einer „strengen Unrechtsvereinbarung“
(3) Der notwendige Verstoß gegen dienst- oder organisationsrechtliche Vorschriften bei § 305 öStGB n. F.
(4) Der Wegfall der Geringfügigkeitsklausel und die Einführung einer zweiten Qualifikationsstufe
b) Die Tatbestände der Vorteilszuwendung und der Bestechung
c) Die neuen Tatbestände zur Erfassung von Vorfeldhandlungen – Die Tatbestände „Vorbereitung der Bestechlichkeit und der Vorteilsannahme“ und „Vorbereitung der Bestechung“
aa) Der Wortlaut des Tatbestandes „Vorbereitung der Bestechlichkeit oder Vorteilsannahme“ und seine tatbestandlichen Voraussetzungen
bb) Der Wortlaut des Tatbestandes „Vorbereitung der Bestechung“ und seine tatbestandlichen Voraussetzungen
d) Die Gründe des österreichischen Gesetzgebers zur Wiedereinschränkung der Strafbarkeit
aa) Das Primärziel: Präzisierung der Tatbestände durch bessere Beschreibung des strafbaren Verhaltens, insbesondere für den Bereich des Anfütterns
bb) Die Einführung der Verwaltungsakzessorietät zur Begrenzung der Strafbarkeit und die Widerspiegelung des erhöhten Unrechtsgehalts bei der Annahme von Vorteilen für pflichtwidriges Handeln
e) Kritik an der Eingrenzung der Strafbarkeit durch die österreichische Strafrechtsliteratur
aa) Die Kritik an der akzessorischen Verweisung auf dienst- und organisationsrechtliche Vorschriften
bb) Die Kritik an den Vorbereitungstatbeständen
cc) Die Bewertung der Wiedereinführung der Unterscheidung zwischen pflichtwidrigem und pflichtgemäßem Amtshandeln und der Tatbestandsqualifikationen wegen hoher Zuwendungswerte
II. Stellungnahme zur geschichtlichen Entwicklung der Tatbestände
1. Die Erweiterung der Tatbestände 2008 – eine gute Idee in schlechter Umsetzung
2. Die Wiedereinschränkung der Tatbestände 2009 – ein korruptionsstrafrechtlicher Rückschritt mit interessanten Ansätzen
3. Zusammenfassung und Ergebnis der Entwicklung der Strafbarkeit der Vorteilsannahme in Österreich
III. Überlegungen und Schlussfolgerungen für den Tatbestand der Vorteilsannahme in Deutschland
1. Eine größere Bestimmtheit der strafbaren Handlung, insbesondere im Bereich der korruptiven Vorfeldhandlungen
2. Die Sanktionierung von korruptiven Vorfeldhandlungen – Zuwendungen zur Klimapflege und das Anfüttern
3. Die Verweise auf feste Wertgrenzen in den Tatbeständen
4. Der Verweis auf dienst- und organisationsrechtliche Verbots- und Erlaubnissätze
B. Strafrechtsvergleichender Teil – Schweiz
I. Die Tatbestände der Vorteilsannahme und Vorteilsgewährung und ihre Tatbestandsmerkmale
1. Der Wortlaut des Tatbestandes der Vorteilsannahme
2. Der Wortlaut des Tatbestandes der Vorteilsgewährung
3. Die Ausführungen des schweizerischen Gesetzgebers zur Ausgestaltung der Tatbestände der Vorteilsannahme und Vorteilsgewährung
4. Das Tatbestandsmerkmal des nicht gebührenden Vorteils und der Bezug zwischen Annahme des Vorteils und Amtsführung und deren Auslegung durch Wissenschaft und Rechtsprechung
a) Der nicht gebührende (Dritt-) Vorteil
b)Der Bezug zwischen Annahme des Vorteils und Amtsführung
aa) „Im Hinblick auf die Amtsführung“ – Wesen und Ziel dieses Konstrukts in Art. 322sexies schwStGB
(1) Der „verdünnte“ Äquivalenzbezug
(2) Strafbarkeit von korruptiven Vorfeldhandlungen als Ziel des „verdünnten“ Äquivalenzbezugs
bb) Erfasst der Tatbestand der Vorteilsannahme nur Vorteile für zukünftiges Amtshandeln oder auch Belohnungen für vergangene Tätigkeiten?
Читать дальше