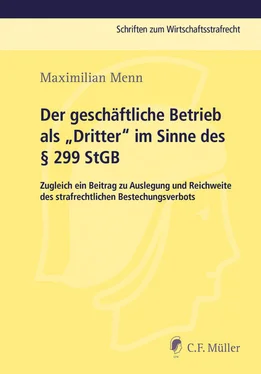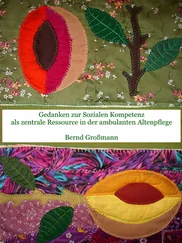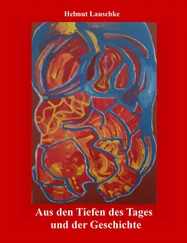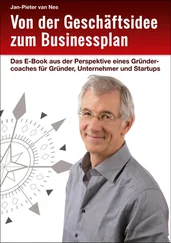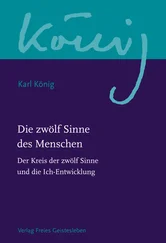Teil 2 Grundsätzliche Erwägungen› A› II. Die Einführung der Gewerbefreiheit
II. Die Einführung der Gewerbefreiheit
17
Die Französische Revolution von 1789 brachte schließlich eine durchgreifende Befreiung vom bisher nach wie vor vorherrschenden Zunftwesen. In Frankreich wurde die allgemeine Gewerbefreiheit am 1.4.1791 gesetzlich eingeführt. Damit einher ging ihre Einführung in den mit Frankreich verbundenen deutschen Ländern.[25] Die meisten anderen deutschen Staaten übernahmen die Gewerbefreiheit im Jahr 1797 nach französischem Vorbild.
18
In Preußen hingegen führte erst das Gewerbesteueredikt vom 28.10.1810 zur Einführung der Gewerbefreiheit. Das Edikt regelte, dass die Ausübung eines Gewerbes lediglich von der Lösung eines Gewerbescheins abhängig war. Ausgenommen waren lediglich einige wenige Berufe, wie beispielsweise der des Apothekers, des Arztes und des Gastwirts.[26] Der Zunftzwang wurde aufgehoben und die Zünfte behielten fortan lediglich noch den Charakter freier Vereine.[27] Alle zu diesem Zeitpunkt bestehenden Gewerbeabgaben – insbesondere die Konzessionsgelder – wurden abgeschafft und durch die Einführung einer allgemeinen Gewerbesteuer ersetzt.
19
Der Sieg über Napoleon hatte jedoch zunächst eine rückläufige Entwicklung zur Folge. In denjenigen deutschen Staaten, die 1797 die Gewerbefreiheit verabschiedet hatten, wurde die Zunftherrschaft wieder eingeführt. Preußen behielt zwar die Gewerbefreiheit für seine alten Gebiete, übertrug diese jedoch nicht auf die neu dazugewonnenen. Erst 1845 wurde durch den Erlass der Gewerbeordnung für ganz Preußen die Gewerbefreiheit eingeführt. Allerdings erfuhr diese auf ständiges Drängen der Handwerkerschaft schon kurz darauf durch das sog. Notgewerbegesetz von 1849 erneut teils erhebliche Einschränkungen. So wurde beispielsweise das Recht zum Betrieb eines Gewerbes abermals an die Zugehörigkeit zu einer Zunft geknüpft und die Aufnahme in diese von einer Prüfung im Anschluss an eine dreijährige Gesellenzeit abhängig gemacht.[28] Die erneuten Beschränkungen konnten jedoch den Drang der Zeit und die zu diesem Zeitpunkt bereits seit fast vierzig Jahren bestehende Gewerbefreiheit nicht mehr stoppen, und so fand das Gesetz auch kaum Beachtung.[29] Nach Erlass der österreichischen Gewerbeordnung von 1859 folgten nun schrittweise auch die deutschen Staaten, die 1815 zunächst zur Zunftherrschaft zurückgekehrt waren. Schließlich brachte der Norddeutsche Bund mit seinem Freizügigkeitsgesetz von 1867 die Gewerbefreiheit in die übrigen deutschen Staaten.[30] Dem Freizügigkeitsgesetz folgten das Notgewerbegesetz von 1868 und schließlich die Gewerbeordnung von 1869, die 1870 in Hessen, 1872 in Baden und Württemberg, 1873 in Bayern und 1889 in Elsass-Lothringen eingeführt wurde.[31]
20
Die Einführung der Gewerbefreiheit bedeutete zugleich eine wesentliche Ausweitung des Wettbewerbs und Verstärkung des Konkurrenzkampfes. Das Recht auf Ausübung der Gewerbetätigkeit wurde als Ausfluss der allgemeinen Handlungsfreiheit angesehen und nicht, wie es das französische Recht annahm, als besonderes subjektives Recht zur Mitbewerbung.[32] Daraus folgte zwangsläufig, dass im Wettbewerb alles erlaubt war, soweit es nicht ausdrücklich per Gesetz verboten wurde. Die liberale Wirtschaftsauffassung der Epoche, die eine Wirtschaftsordnung ohne jedwede staatliche Einflussnahme vorsah, verhinderte nicht das zunehmende unlautere Verhalten im starken Konkurrenzkampf.[33] Abgesehen von einigen Vorschriften im Warenzeichengesetz von 1874 herrschte ein „freies Spiel der Kräfte“.[34] In einer im Schrifttum viel kritisierten Entscheidung des Reichsgerichts vom 30.11.1880 wurde der unlautere Wettbewerb sogar indirekt gedeckt.[35] Das Reichsgericht ging davon aus, dass aus der Schaffung eines Markenschutzgesetzes folge, dass im Wettbewerb alles erlaubt sei, was dieses Gesetz nicht ausdrücklich verbiete, und bestätigte damit die aus der Entwicklung der Gewerbefreiheit entstandene Rechtsauffassung. Das Urteil des Reichsgerichts war in Bezug auf den unlauteren Wettbewerb exemplarisch für die Zeit von 1880 bis zum Erlass des UWG im Jahre 1896.
21
Zunehmend wurde jedoch Kritik an diesem Verständnis geübt. Namentlich Kohler wendete ein, es könne schon denklogisch nicht sein, dass das Markenrecht das gesamte Wettbewerbsrecht abschließend regele.[36] Auch in einem freien Wettbewerb benötige man gewisse Spielregeln. Die liberale Rechtsauffassung bezeichnete er als „so formalistisch und kleinbürgerlich wie möglich“.[37] Es bildete sich in der Folge eine Bewegung, deren Ziel der Schutz des gewerblichen Eigentums war. So wurde am 19.12.1891 in Berlin aus mehreren Vertretern der Industrie ein „Verein für den Schutz des gewerblichen Eigentums“ gegründet, dessen Ziel die Bekämpfung unlauterer Geschäftsmethoden war und der bestrebt war, eine Gesetzesänderung herbeizuführen.[38] Verschiedene Handelskammern forderten von der Politik ein entschiedeneres Einschreiten gegen unlautere Geschäftspraktiken. Die Bewegung fand schließlich Gehör. Erste Entwürfe des späteren Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb („UWG“) wurden seit 1894 im Reichstag beraten und führten schließlich zu dem Erlass des Gesetzes im Jahr 1896. Allerdings fanden sich in dieser ersten Fassung noch keine Bestimmungen zur Verhinderung der Angestelltenkorruption.
Teil 2 Grundsätzliche Erwägungen› A› III. Neufassung des UWG vom 7.6.1909
III. Neufassung des UWG vom 7.6.1909
22
Dennoch wurde durch den Erlass des UWG die Diskussion um den Umgang mit unlauteren Geschäftsmethoden verstärkt. Um die Jahrhundertwende nahmen die schon in den Gründerjahren nach der Einführung der Gewerbefreiheit bedingten Auswüchse im Wirtschaftsverkehr weiter zu. Durch den mächtigen Aufschwung des deutschen Handels- und Verkehrswesens wuchs sowohl die Anzahl der Betriebe als auch deren Größe in einem erheblichen Umfang.[39] Die Betriebe wurden seltener von Einzelkaufleuten geführt und waren im zunehmenden Maße von einer weitverzweigten Unternehmensstruktur geprägt.[40] Der Geschäftsinhaber war durch die stetig steigende Betriebsgröße nicht mehr in der Lage, sich alleine um die Entgegennahme und die Erteilung von Aufträgen zu kümmern, sondern musste diese Aufgaben vermehrt an seine Angestellten delegieren.[41] Während für den Inhaber des Geschäfts als Beurteilungsfaktoren für ein zu beziehendes Produkt in der Regel der Preis, die Qualität sowie die Lieferfrist eine entscheidende Rolle spielten, bestand bei dem Angestellten die erhöhte Gefahr, dass dieser mehr an persönlichen Vorteilen, die der Bezug einer bestimmten Ware mit sich brachte, interessiert war. Beim Geschäftsinhaber jedoch war zumindest nach damaliger einhelliger Auffassung der persönliche Vorteil aus dem Abschluss des Vertrags stets auch ein Vorteil des Geschäfts.[42] Beim Angestellten hingegen schien es möglich, dass eine Divergenz zwischen persönlichem Vorteil und dem Vorteil für das Unternehmen bestand. In Folge der Delegation des Einkaufs für die Unternehmen vom Geschäftsinhaber an seine Vertrauenspersonen setzten Lieferanten oftmals alles daran, die Gunst des für den Einkauf verantwortlichen Mitarbeiters zu erlangen. Das „Schmieren“ der Angestellten des Unternehmers wurde zunehmend zu einer gängigen Praxis.
23
Auf diese erheblichen Missstände wies erstmals die Frankfurter Halbmonatsschrift „Das freie Wort“ am 5.11.1901 in einem Artikel mit dem Titel „Innere Ursachen für den Niedergang der Industrie in Deutschland“ hin.[43] Darin wurden nicht nur die Missstände angesprochen, sondern auch die negativen Folgen von Bestechung und Bestechlichkeit für Wirtschaft und Gesellschaft aufgeführt. So schädige die Bevorzugung minderwertiger Ware die deutsche Exportwirtschaft in beachtlicher Weise und könne in sicherheitsrelevanten Bereichen auch zu erheblichen Gefahren für die Endverbraucher führen.[44] Deshalb enthielten die Beiträge die Forderung nach dem Erlass einer strafrechtlichen Sanktionsnorm. Auf die Veröffentlichungen folgten zahlreiche Leserzuschriften aus der Bevölkerung, die ebenfalls ein Einschreiten der Politik forderten. Die Aufmerksamkeit der Bevölkerung für das Thema der Angestelltenkorruption war geweckt.
Читать дальше