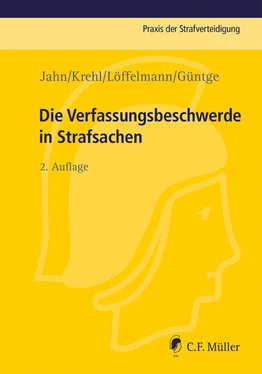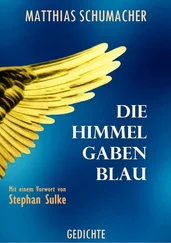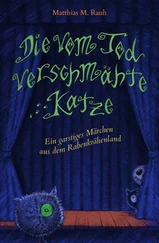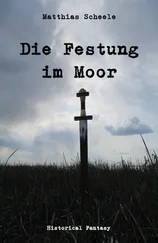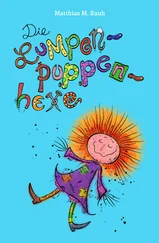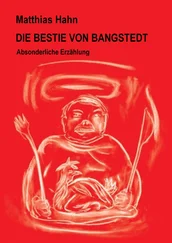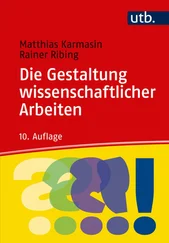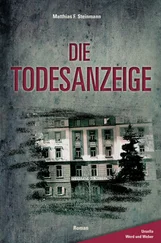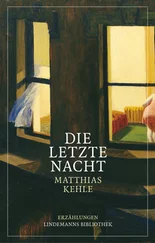[1]
Gekürzter Vorabdruck in ZIS 2009, 511-518.
[2]
Bereits von den im Jahre des Erscheinens der Vorauflage dieses Buchs – 2011 – eingegangenen 2.183 Verfassungsbeschwerden gegen Gerichtsentscheidungen der ordentlichen Gerichte betrafen 1.412 Strafsachen. Erst dann folgten – mit weitem Abstand – 771 Zivilsachen, vgl. Stüer DVBl. 2012, 751 (753). Zu praktischen Konsequenzen der Eingangszahlen für das Annahmeverfahren siehe unten Rn. 54.
[3]
Schorkopf in: Ambos (Hrsg.), Europäisches Strafrecht post-Lissabon, 2011, S. 111, wirft auch gleich noch einige die tatsächliche Situation gut ausleuchtende Schlaglichter: „Haftsachen, bei denen eine überlange Verfahrensdauer gerügt wird; Verurteilungen, die auf der Grundlage überkommener oder neuer Tatbestände ergangen sind; Vollstreckungssachen, in denen Einzelheiten des JVA-Alltags bemängelt werden und die zahllosen Klageerzwingungsverfahren, mit denen Bürgern meistens nach Gehör und Zuspruch für Leid und Kränkungen suchen“.
[4]
Niemöller/Schuppert AöR 107 (1982), 389. Der Satz geht zurück auf das Vorwort von Henkel zur 1. Aufl. (1953) seines Lehrbuches zum Strafverfahrensrecht: „Es lässt sich daher […] der Standpunkt vertreten, dass das Strafverfahrensrecht in seinen Grundlagen ‚angewandtes Verfassungsrecht‚ darstelle“. Zusf. HStR- Möstl VIII, § 179 Rn. 51; Jahn FS Paul Kirchhof, 2013, § 128 Rn. 21; ders. in: Tiedemann u.a. (Hrsg.), Die Verfassung moderner Strafrechtspflege, 2016, S. 63 (66 f.).
[5]
Vgl. Roxin JöR n.F. 59 (2011), 1 (28); Jahn in: Tiedemann u.a. (Hrsg.), Die Verfassung moderner Strafrechtspflege, 2016, S. 63 (73 ff.) m. w. N.
[6]
Lehrkommentar I, Rn. 92. Immerhin wurde schon wenige Jahre nach diesem Diktum in Untersuchungen der Rechtstatsachenforschung herausgestellt, dass (jedenfalls im Jahr 1967) die anteilmäßig größte Gruppe von Beschwerdeführern strafprozessuale Justizgrundrechte geltend machte, vgl. die Angaben bei Treiber FS Rüping, 2009, S. 211; zurückhaltender aber Bryde Verfassungsentwicklung: Stabilität und Dynamik im Verfassungsrecht der Bundesrepublik Deutschland, 1982, S. 157 f.; siehe erg. Rn. 58.
[7]
Zuck NJW 2017, 35 (36 ff.); Kirchberg JA 2007, 753 (756); speziell zum Strafrecht Sommer in: Brüssow/Gatzweiler u.a., § 14 Rn. 3.
[8]
Zur Verfassungsmäßigkeit s. nur BVerfGE 1, 89 f.; krit. C. Bäcker RW 2014, 482 (499 f.). De lege ferenda nicht überzeugend Bytomski ZRP 2011, 88 (89).
[9]
Zutreffende Einordnung von bedeutsamen Beispielsfällen („Sedlmayr“, „Brechmittel“) dieses Entscheidungstyps bei MAH Strafverteidigung- Eschelbach § 30 Rn. 13. Stüer DVBl. 2012, 751 (755) weist aber zu Recht darauf hin, dass die mit Gründen versehene Entscheidung aus Anwaltssicht im Einzelfall auch nicht ganz „ungefährlich“ sein kann. Dies gilt etwa dann, wenn dem Verfassungsbeschwerdeführer bescheinigt wird, dass die Sache keinerlei Aussicht auf Erfolg hatte. Hier mag ein unbegründeter Beschluss, in den der Anwalt einen positiven Inhalt hineinlesen kann, „besser sein als die eingehend begründete Aussage, dass die Beschwerde unzulässig oder offensichtlich unbegründet ist – vor allem, wenn in einer Tenorbegründung auf die Schwachstellen der Verfassungsbeschwerde hingewiesen wird“.
[10]
Voßkuhle NJW 2013, 1329 (1335), nach der redaktionellen Notiz aus Anlass einer DAI-Tagung.
[11]
Dazu grds. S. Walther in: Weigend/Walther/Grunewald (Hrsg.), Strafverteidigung vor neuen Herausforderungen, 2008, S. 329 (342 f., 350); weitere Nachw. zu den verschiedenen Auffassungen bei LR- Lüderssen/Jahn StPO, § 137 Rn. 2.
[12]
BVerfG , 2. Kammer des 1. Senats NJW 1996, 3268, vgl. dazu Jahn ZRP 1998, 103 (104); ders. NStZ 1998, 389 (392).
[13]
Inhaltlich weitgehend übereinstimmend Zuck NJW 2013, 2248 (2251). Zur Entstehungsgeschichte im Einzelnen Jahn StV 2014, 40 (46).
[14]
Da der oben erwähnte Beschluss des BVerfG (NJW 1996, 3268) dem Inkrafttreten der Berufsordnung am 11.3.1997 (§ 35 Abs. 1 BO) zeitlich vorausging, ist davon auszugehen, dass das Gericht der damaligen Satzungsversammlung Formulierungshilfe geleistet hat. Siehe zur Entstehungsgeschichte auch Zuck NJW 1996, 3189 (3190).
[15]
BVerfGE 101, 312 (328) = NJW 2000, 347.
[16]
BGHSt 41, 69 (72) = NStZ 1995, 393.
[17]
Etwas überpointiert bezeichnet Zuck JZ 2007, 1036 (1039) die Bestimmung des § 90 Abs. 1 BVerfGG, nach der Jedermann Verfassungsbeschwerde erheben kann, als „irreführende Zusage“. Für Art. 93 Abs. 1 Nr. 4a GG dürfte dann nichts anderes gelten.
[18]
Siehe (bis zur 3. Aufl. 2006) Zuck Verfassungsbeschwerde, Rn. 1313. Die einschlägige Statistik (siehe Nachw. Voraufl. Rn. 4) wird auf der Homepage mittlerweile nicht mehr veröffentlicht. Im Jahre 2007 waren 41 (2006: 69) von 59 (2006: 81) Beschwerdeführer, deren Verfassungsbeschwerde vom für Strafsachen im Wesentlichen zuständigen Zweiten Senat stattgegeben wurde, anwaltlich vertreten.
[19]
Die durchaus vielstimmige Kritik an diesem Zustand ( Schoreit ZRP 2002, 148 [150]; Zuck NJW 1986, 968 [971]; ders. AnwBl. 2006, 95; Jahn FS Widmaier, 2008, S. 821 [837 f.]; anders aber Schorkopf AöR 130 [2005], 465 [489 ff.]) muss hier auf sich beruhen, siehe aber erg. Rn. 318.
[20]
Angabe bei Stüer DVBl. 2012, 751 (752).
Teil 1 Die Aufgaben des Strafverteidigers im Verfassungsbeschwerdeverfahren› A. Überlegungen vor Mandatsannahme
A. Überlegungen vor Mandatsannahme
5
Vor dem Entschluss, für (s)einen Mandanten Verfassungsbeschwerde beim BVerfG einzulegen, sollten vor diesem Hintergrund einige praktische Überlegungenangestellt werden.
Teil 1 Die Aufgaben des Strafverteidigers im Verfassungsbeschwerdeverfahren› A. Überlegungen vor Mandatsannahme› I. Der Verteidiger zwischen Mandant und Recht
I. Der Verteidiger zwischen Mandant und Recht
6
Der gemeinsame Weg an den Karlsruher Schlossplatz ist auch im Mandatsinnenverhältniskeine leichte Tour. Auf der einen Seite steht ein Bürger, der sich nach dem Durchlaufen des strafrechtlichen Instanzenzuges häufig emphatisch mehr denn je „im Recht“ fühlt,[1] und mit allen Mitteln doch noch eine Entscheidung zu seinen Gunsten herbeiführen möchte. Er ist mit den Besonderheiten des verfassungsgerichtlichen Verfahrens aber regelmäßig ebenso wenig vertraut wie mit den jedenfalls statistisch trüben Aussichten der tatsächlichen Realisierung seines Anliegens. Auf der anderen Seite steht das „gelebte“ Verfassungsrecht: Die Erfolgsquote sämtlicher ins Verfahrensregister eingetragener Verfassungsbeschwerden liegt im Mittel bei etwas über 2 %[2], heutzutage sogar „mit eher fallenderdenn steigender Tendenz“.[3] Betrachtet man isoliert die Erfolgsaussichten einer Urteilsverfassungsbeschwerde gegen eine letztinstanzliche Entscheidung des BGH, verringert sich die statistische Erfolgsquote bei einer Langzeitbetrachtung zwischen 1992 und 2010 zudem auf nur etwas über noch 1,5 %.[4] Es ist eine schwierige Aufgabe, dem Mandanten einerseits das Gefühl zu geben, ernst genommen zu werden, ihm aber andererseits trotz der generell besonders hohen Akzeptanz der Verfassungsgerichtsbarkeitin der Bevölkerung – in den letzten vierzig Jahren hatte jeder zweite Deutsche vom Gericht eine gute oder sehr gute Meinung[5] – gleichzeitig die erratischen Erfolgsaussichtendeutlich zu machen.[6] Dies kann gerade bei – wie in Strafsachen nicht selten – ausländischen Beschwerdeführern mit anderem kulturellen Hintergrund und Rechtsverständnis nicht nur im buchstäblichen Sinne zu Verständigungsschwierigkeiten führen. Im Ergebnis sollte dem Mandanten näher gebracht werden, dass es trotz des im Einzelfall hohen Aufwandes (und gegebenenfalls vergleichbarer Kosten) letztlich – mit den Worten einer früheren Verfassungsrichterin – nur darum gehen kann, das Unwahrscheinliche etwas wahrscheinlicherzu machen.[7]
Читать дальше