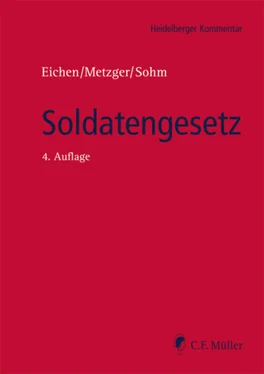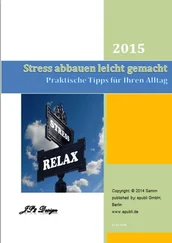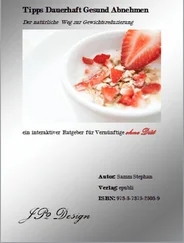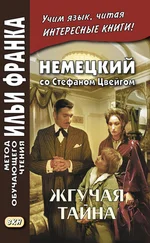I. Allgemeines
1. Entstehung der Vorschrift
1
Der REntw.[1] enthielt keine mit § 6vergleichbare Vorschrift.
2
Bei der 1. Lesungdes REntw. am 12.10.1955[2] führte der BMVg, Theodor Blank, aus:
„Es muss im Rechtsstaat als selbstverständlicher Grundsatz gelten, dass Freiheit nur so weit eingeschränkt wird und auch die Soldaten der Befehlsgewalt nur so weit unterworfen werden, als der besondere Zweck und die Aufgabe des Soldaten es notwendig machen. Auch dieser Grundsatz wird hier zum ersten Mal gesetzlich festgelegt. Wenn der Vorgesetzte Befehle nur zu dienstlichen Zwecken erteilen darf, wenn die Wahrheitspflicht des Soldaten auf die Aussage im dienstlichen Verkehr beschränkt wird, wenn der Soldat von der Befolgung eines verbrecherischen Befehls befreit wird, so leuchtet hier überall jener Grundgedanke hervor.
Am deutlichsten wird das aber bei den politischen Rechten und Pflichten, d.h. dort, wo die allgemeinen Staatsbürgerrechte berührt werden.“
3
Die BRegwollte es also dabei belassen, die Rechtsstellung des Soldaten in der konkreten Einzelpflichtzu regeln, und darauf verzichten, eine Generalklausel vor die Klammer zu ziehen.
4
Auf Antrag des Abg. Dr. Kliesing (CDU/CSU) fügte der VertAeinen neuen § 5a, den späteren § 6, in den Gesetzentw. ein. Der VertA war der Auffassung, „dass durch die Aufnahme des § 5a in das Gesetz der Standort des Soldaten in einem demokratischen Staat noch besonders verdeutlicht werden“ sollte.[3]
2. Änderungen der Vorschrift
5
§ 6gehört zu den wenigen Normen des SG, die seit ihrer Erstfassung nie geändertworden sind. Im Hinblick auf die oben dargestellte Verdeutlichungsfunktion besteht hierfür auch kein Bedarf, da der Gesetzgeber durch die Verwendung des Wortpaares der „staatsbürgerlichen Rechte“ die über bloße Bürgerrechte hinausgehenden Grundrechte des GG zweifellos mit einschließen wollte.[4]
3. Bezüge zu anderen rechtl. Vorschriften; ergänzende Dienstvorschriften
6
Eine mit § 6 vergleichbare Vorschriftexistiert im Beamtenrecht nicht. Die im Soldatengesetz normierte Rechtsstellung soll dahingehend abschließend geregelt sein, dass sie einer ergänzenden Auslegung durch die Normen des Beamtenrechts nicht zugänglich ist.[5]
7
Wesentliche Aussagen für die Anwendung des Gedankens des § 6in der mil. Praxis/Ausbildung enthalten die
| – |
ZDv A-2600/1„Innere Führung – Selbstverständnis und Führungskultur“ |
| – |
ZDv A-2620/1„Politische Bildung in der Bundeswehr“. |
II. Erläuterungen im Einzelnen
1. § 6und Grundgesetz
8
Die Norm führt einfachgesetzlich einen Grundgedanken von Art. 133 Abs. 2 Satz 2 WRV fort. Bereits dort war geregelt, dass „ … zur Erfüllung [der] Aufgaben und zur Erhaltung der Manneszucht einzelne Grundrechte… “ der Soldaten durch das Reichswehrgesetz einschränkbar waren, obwohl zu dieser Zeit die Vorstellung des besonderen Gewaltverhältnisses für Staatsdiener die generelle Nicht-Geltung von Grundrechten enthielt.[6]
9
Der Soldat ist Grundrechtsträgerwie jede andere Person, die sich auf das GG berufen kann. Ihn als rechtloses Instrument des Staatszweckes anzusehen, verstieße gegen das Menschenwürdeprinzip. Weiterhin hat sich die Rechtsfigur eines „besonderen Gewaltverhältnisses“, in dem Grundrechte ohne Gesetzesvorbehalt einschränkbar sein sollten, überlebt.[7] Für Grundrechtseinschränkungen aus der „Natur der Sache“ oder aus dem Wehrdienstverhältnis als solchem ist kein Raum.[8] Aber auch für Soldaten sind Grundrechte durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes einschränkbar, wenn und soweit dies nach der Verfassung für jedermann möglich ist oder im Fall des Art. 17a Abs. 1 GG speziell ermöglicht wird. Außerdem stellt sich das Soldatenverhältnis immer noch als ein Näheverhältnis zum Dienstherrn dar – kein übliches Distanzverhältnis von Staatsbürger zum Staat.[9] Das zeigt sich insbes. daran, dass jede Tätigkeit des einzelnen Soldaten grds. dem Staat zugerechnet wird; der Soldat ist nicht frei in seiner Tätigkeit – bewegt er sich aber im zugewiesenen Rahmen, ist er frei von Verantwortung. Das bedeutet, dass der Soldat Grundrechtsträger bleibt, Grundrechtseinschränkungen einem (modifizierten) Gesetzesvorbehalt unterliegen, aber trotzdem der Staatszweck regelnde Wirkung hat. Damit eröffnet sich die in diesem Zusammenhang relevante Frage einer Unterscheidung vom Grund- und Betriebsverhältnis(vgl. die Komm. zu § 82). Dabei geht es nicht darum, ob Grundrechte Geltung entfalten – es geht um die Reichweite grundrechtlicher Betätigung, abhängig von dessen Sinnzusammenhang. Innerhalb des Grundverhältnisses (= Beziehung von Soldat gegenüberdem Staat) gilt das allgemeine Staat-Bürger-Verhältnis.[10] Demgegenüber ist innerhalb des Betriebsverhältnis zu differenzieren: vollzieht der Soldat unmittelbar staatlichen Willen (= „Soldat als Staat“), stellt sich die Frage nach rechtlicher Gewährleistung grds. nicht – bspw. ist im Moment der Schussabgabe der Soldat ganz Funktionsträger, der nur die Staatsaufgabe Verteidigung wahrnimmt; seine bürgerliche Rechtssphäre tritt in diesem Moment hinter die Staatsaufgabe zurück. Lediglich in den Bereichen, wo der Soldat zwar nicht unmittelbar staatlichen Willen formt und exekutiert, dem Staat aber auch nicht gegenübersteht (= „Soldat im Staat“), bleibt Raum für die Ausübung von Grundrechten. Diese werden dann nur und soweit beschränkt, als eine Gewährleistung mit der Erfüllung der soldatischen Pflichten unvereinbar ist.[11] So ist dem Soldaten bspw. im Rahmen der Unterkunft, zu deren Inanspruchnahme er nach § 18verpflichtet ist, ein Mindestmaß an Rückzugsmöglichkeit zu gewährleisten, um seinem (aus Art. 2 Abs. 1 i.V.m. Art. 1 Abs. 1 GG resultierenden) Anspruch auf Privatsphäre[12] gerecht zu werden.
10
Ob ohne Weiteres die allg. Regeln gelten,[13]ist zumindest streitig.[14] Das besondere Rechtsverhältnis[15] spricht eher dagegen. Denn bei der Frage, inwieweit der Soldat zwecks Funktionsfähigkeit in die SK eingebunden ist, geht es gerade nicht um die (aus staatsbürgerlicher Sicht übliche) Frage nach etwaigem staatlichen Zwangseingriff in eine grundrechtlich geschützte Freiheitssphäre. Vielmehr ist der Staatsbürger als Soldat inden Staatsapparat eingebundenund soll diesem nach Möglichkeit störungsfrei zur Zweckerreichung dienen. Zwar ist dieses Näheverhältnis – zurecht – kein rechtsfreier Raum und also der Staat keineswegs frei in der Ausgestaltung des innerbetrieblichen Umgangs mit seinem Staatsdienstpersonal. Jedoch sind Regelungen des Gesetzgebers nur soweit erforderlich, als sie das Wesentliche regeln müssen;[16] weil es aber nicht das übliche Schema vom Eingriff in einen Schutzbereich ist, müssen diese Normen auch nur bedingt den Vorgaben von Art. 19 GG Abs. 1 gerecht werden.[17] Es stehen sich vielmehr im Einzelfall die Pflichtenforderungdes Dienstherrn und die (mittels § 6 SGin das Näheverhältnis eingebrachten) staatsbürgerlichen Rechtegegenüber – beides muss nach Lage des Einzelfalls in einen schonenden Ausgleichgebracht werden.
11
Auch dass unbeschränkte Grundrechte stets Vorrang genießen, kann ebenfalls gerade nicht angenommen werden (sonst dürften sich auch bspw. Strafgefangene gem. Art. 8 Abs. 1 GG uneingeschränkt in geschlossenen Räumen versammeln)[18]. Für Soldaten gelten ungeschriebene, immanente Schrankenaus dem Zweck des Näheverhältnisses. Das führt auch bei unbeschränkten Grundrechten innerhalb des Näheverhältnisses zu einem Abwägungsprozess zwischen dem Recht und der in der soldatischen Pflicht konkretisierten Zweckforderung. Dabei ist jede Pflicht hinsichtlich ihrer Bedeutung und grundrechtsbegrenzenden Wirkung, aber auch zur Gewährleistung wirksamer Streitkräfte auszulegen[19] – eine generell restriktive Auslegung der Pflichtenbindung ist ausgeschlossen.[20]
Читать дальше