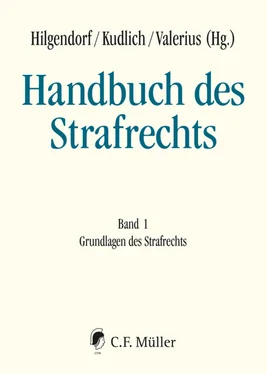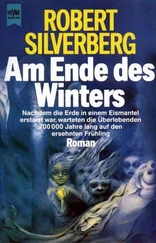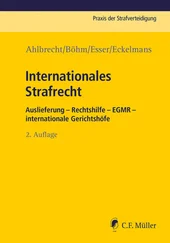c) Erweiterung der Verständnismöglichkeiten
34
Demgegenüber wirken historisch-genetische Kontexte bedeutungserweiternd, wenn nach grammatischer Auslegung und insbesondere anderen Kontexten die Anwendbarkeit einer Norm auf einen bestimmten Sachverhalt eher nicht gegeben erscheint, sich aber aus der Gesetzgebungsgeschichte ergibt, dass dieser Sachverhalt durchaus erfasst sein sollte. In diesen Fällen ist zu prüfen, ob der gesetzgeberische Wille im Gesetz nicht doch so weit Ausdruck gefunden hat, dass die Bedenken gegen die Anwendung der Norm überwunden werden können, bzw. ob die Vorschrift nicht wenigstens auf so viele Fälle angewendet werden sollte, wie mit Blick auf die anderen Kontexte noch vertretbar ist. Dieses Zusammenspiel lässt sich anhand einer Entscheidung des BGH zur Auslegung des § 177 StGB i.d.F. durch das 33. StrÄndG verdeutlichen: Danach lag ein besonders schwerer Fall der sexuellen Nötigung (Vergewaltigung) u.a. in Fällen vor, in denen „der Täter mit dem Opfer den Beischlaf vollzieht oder ähnliche sexuelle Handlungen an dem Opfer vornimmt, die dieses besonders erniedrigen, insbesondere wenn sie mit einem Eindringen in den Körper verbunden sind (Vergewaltigung)“.[80] Der 3. Strafsenat hatte nun zu entscheiden, ob der Tatbestand dieses Regelbeispiels in einem Fall erfüllt war, in dem der Täter das Opfer gewaltsam zur Ausübung des Oralverkehrs zwang, indem er es am Kopf packte und mit beiden Händen zu seinem Geschlechtsteil zog.[81] Der Senat verneinte diese Frage mit grammatischen und systematischen Argumenten, weil im Falle des erzwungenen Oralverkehrs nicht der Täter am Opfer, sondern das Opfer (gezwungenermaßen) am Täter sexuelle Handlungen vornehme. Diese Unterscheidung ergebe sich aus anderen Vorschriften über den strafrechtlichen Schutz der sexuellen Selbstbestimmung, die allesamt sowohl die Handlungen des Täters am Opfer als auch diejenigen des Opfers am Täter explizit erwähnten.
35
Historisch-genetische Kontexte allerdings deuten in eine andere Richtung:[82] Im Gesetzesentwurf zum 33. StrÄndG wurde offenbar auch der vom Täter erzwungene Oralverkehr durch das Opfer als erfasst betrachtet: Dies ergibt sich nicht nur aus dem nicht näher differenzierenden Sprachgebrauch, sondern auch aus der Erläuterung als „Eindringen des Geschlechtsgliedes (. . .) als orale oder anale Penetration“,[83] welche als Bild für den vom Täter am Opfer durchgeführten Oralverkehr eher schief ist bzw. zumindest nicht die statistisch bedeutsameren Fälle erfassen dürfte. Auch in den – für den bereits abgeschlossenen Gesetzgebungsvorgang freilich weniger ausschlaggebenden – Materialien der kurze Zeit später erfolgenden Ergänzung um eben jenes „oder an sich von ihm vornehmen lässt“, maß der Rechtsausschuss der Ergänzung nur klarstellenden Charakter bei.[84] Um den in den Materialien zum Ausdruck gebrachten gesetzgeberischen Willen möglichst zu berücksichtigen, ohne die normtextnäheren systematischen und grammatischen Kontexte unzulässig zu überspielen, sprechen daher gute Gründe dafür, wenigstens solche Handlungen noch als Vornahme „am Opfer“ zu erfassen, in denen keine (wenngleich auf Zwang beruhende) „passive Inanspruchnahme“ des Opfers vorliegt, sondern die Aktivität zumindest auch beim Täter liegt.[85] Im konkret zu entscheidenden Fall nun hatte sich der Täter nicht etwa weitgehend passiv verhalten und nur durch die Kraft einer Drohung das Opfer zur Durchführung des Oralverkehrs genötigt, sondern vielmehr dessen „Kopf in beide Hände“ genommen und „zu seinem Geschlechtsteil“ gezogen. Jedenfalls diese Vorgehensweise kann selbst unter Berücksichtigung der systematischen Einwände als sexuelle Handlung am Opfer gesehen werden.
d) Beispiele aus der Rechtsprechung
36
| – |
In BGHSt 19, 109 tauchte die Frage auf, was ein „Rädelsführer“ i.S.v. § 90a StGB a.F. sei. Der Senat verwies auf die parlamentarischen Beratungen, in denen zum Ausdruck gekommen sei, dass wohl die „Drahtzieher“, nicht aber die „Mitläufer“ erfasst sein sollten (S. 110). Der Wille des Gesetzgebers hat sich eigentlich schon im Ausdruck „Rädelsführer“ niedergeschlagen; der BGH stellte überdies klar, dass für eine besonders weite Auslegung kein rechtspolitischer Grund besteht (S. 111). |
| – |
Die reichsgerichtliche Rechtsprechung entschied die Frage, ob § 251 StPO a.F. (jetzt § 252 StPO) für den Fall, dass ein vor der Hauptverhandlung vernommener Zeuge nachträglich von seinem Zeugnisverweigerungsrecht Gebrauch macht, nur ein Verlesungs verbot oder ein darüber hinausgehendes Verwertungs verbot enthält, noch mit Verweis auf den klaren Wortlaut. Einzig RGSt 10, 374 wich davon ab und argumentierte mit der Entstehungsgeschichte (Beratungen im Plenum u.a.), die Gesetzesverfasser hätten in der Beweisaufnahme über den Inhalt einer Aussage eine unzulässige Gesetzesumgehung gesehen. Der BGH schloss sich in BGHSt 2, 99 dieser Ansicht an und zitierte dazu eine Aussprache im Reichstag, die genau die vorliegende Konstellation behandelt hatte und nach Ansicht des Senats zu dem Ergebnis gekommen war, dass man das Verlesungsverbot als generelles Verbot verstehen müsse, die frühere Aussage in irgendeiner Form zu verwerten und zum Gegenstand der Beweisaufnahme in der Hauptverhandlung zu machen. |
| – |
Gemäß § 2 Abs. 2 HackfleischVO a.F. war der Verkauf von Hackfleisch nur in Schlächtereien und Fleischereibetrieben erlaubt. Laut BGHSt 17, 267 war es die Intention des Gesetzgebers, den Verkauf von Hackfleisch aus hygienischen Gründen nur dort zuzulassen, wo das Frischfleisch handwerksmäßig bearbeitet wird; Zweigstellen müssten also selbst alle Voraussetzungen eines Fleischereibetriebes erfüllen. Dass der Besorgnis um Hygiene durch moderne Kühltechnik heutzutage ausreichend begegnet werden kann, sodass die Anforderungen an die Zweigstellen heruntergeschraubt werden könnten, sieht der Senat ein, verweist aber auf die Kompetenz des Verordnungsgebers und behält diesem eine Reaktion vor. |
| – |
Der „objektivierte Wille des Gesetzgebers“ wird in den Entscheidungen BGHSt 36, 192 und 30, 52 als recht willfähriges Argument entlarvt. Die Frage, ob die Beschwerde nach § 304 Abs. 5 StPO auch zulässig ist, wenn sie sich gegen Erzwingungshaft richtet, wurde in BGHSt 30, 52 mit Hinweis auf die Entwurfsbegründung noch knapp verneint. BGHSt 36, 192 argumentiert im gegenteiligen Sinn, § 304 Abs. 5 StPO sei nach Sinn und Zweck der gesetzgeberischen Konzeption (also nach dem „objektivierten Willen des Gesetzgebers“), nicht nach dem engeren Begriffsverständnis der historischen Gesetzesverfasser, auszulegen (S. 195). |
4. Teleologische Auslegung
a) Der Kontext des „wahren“ Gesetzeszweckes
37
Die teleologische Auslegung erschließt den Regelungszweck des Gesetzes, so wie er sich dem Interpreten – idealerweise: auch unter Berücksichtigung weiterer Kanones, nicht selten aber: kraft seiner vermeintlich überlegenen Erkenntnis – darstellt. Dahinter steht der Gedanke, dass der Gesetzgeber Normen so gestalten bzw. verstanden wissen möchte, dass die mit dem Gesetz bzw. der einzelnen Norm verfolgten Ziele möglichst gut erreicht werden. Soweit – wie häufig – durch die Förderung eines dieser Ziele andere an sich schützenswerte Interessen zwangsläufig beeinträchtigt werden, kann der teleologische Kontext auch Anhaltspunkte dafür geben, wie restriktiv eine Norm zum Nutzen dieser anderen Interessen noch ausgelegt werden darf, ohne dass der Regelungszweck der Norm gefährdet wird. In Fällen, in denen dabei die Anwendung einer Vorschrift gewissermaßen über die Wortlautgrenze hinaus zurückgenommen wird, wird üblicherweise nicht mehr von teleologischer Auslegung, sondern von einer teleologischen Reduktion gesprochen.[86]
Читать дальше