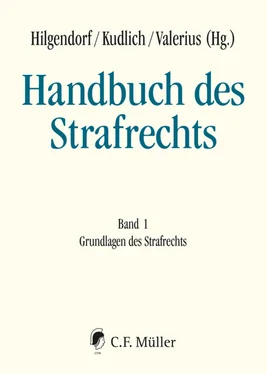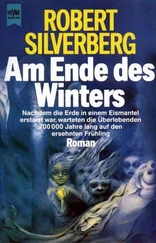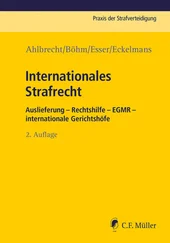51
Soll geprüft werden, ob eine bestimmte „kämpferische“ Äußerung im Wahlkampf eine Beleidigung i.S.d. § 185 StGB darstellt, ist nicht problematisch, ob § 185 StGB als solcher mit Art. 5 Abs. 1 GG vereinbar ist, sondern ob bei der Auslegung der Vorschrift die Garantie der Meinungsfreiheit angemessen berücksichtigt wurde. Geht es um die Frage nach der Strafbarkeit neutraler, berufsbedingter Verhaltensweisen wegen Beihilfe (die unten nochmals als Beispiel herangezogen werden wird), so ist auch nicht ernsthaft erwägenswert, ob vielleicht § 27 StGB generell gegen Art. 12 Abs. 1 GG verstößt, sondern nur, wie die Berufsfreiheit bei der Auslegung von § 27 StGB zu berücksichtigen ist, wenn berufliches Verhalten in Rede steht. Dies gilt auch und insbesondere im Bereich „diesseits harter Verfassungswidrigkeit“, d.h. wenn es gerade nicht (wie bei der verfassungskonformen Auslegung) darum geht, ob eine bestimmte Auslegung verfassungswidrig ist, sondern wenn überlegt wird, ob ein anderes Ergebnis etwa die betroffenen Grundrechte noch besser zur Geltung bringen könnte (vgl. dazu unten Rn. 54 ff.).
b) Vorbehalte gegen die Berücksichtigung
verfassungsrechtlicher Überlegungen?
52
Bevor näher auf die verfassungsorientierte Auslegung und ihr Verhältnis zur verfassungskonformen Auslegung eingegangen wird, sind einige wenige Sätze zur Berechtigung einer Berücksichtigung verfassungsrechtlicher Erwägungen angezeigt,[110] die in der älteren Literatur vereinzelt in Frage gestellt wird,[111] weil wegen des naturrechtlichen Gedankens des „neminem laedere“ Rechtsgarantien für illegitime Verletzungen ausgeschlossen seien.[112] Zumindest Strafrechtsnormen für solche Delikte, die „sich im Bewußtsein der Volksgenossen als ‚crimen‘ darstellen“, wurden von Dürig als „immanente Schranken“ aller Grundrechte gesehen.[113] Eine solche Restriktion des Schutzbereiches kann trotz der Suggestivkraft der herangezogenen Beispiele – besonders beliebt in diesem Zusammenhang: Grundrechtsschutz auch für den „kaltblütigen Killer“? – nicht überzeugen: Dass Straftatbestände nicht generell der umfassenden Grundrechtsbindung der öffentlichen Gewalt nach Art. 1 Abs. 3 GG entzogen sein können, ist evident. Der beschränktere Ansatz hinsichtlich der Handlungen, die den „Volksgenossen“ als „crimen“ erscheinen, ist in seiner mangelnden Klarheit[114] für eine so grundlegende Weichenstellung schon zu Beginn der Prüfung methodisch ungeeignet. Zuletzt sind auch solche Überlegungen nicht erforderlich, da sich die vielleicht intuitiv für richtig gehaltenen Ergebnisse unproblematisch auch bei einem weiten Schutzbereichsverständnis mit der gesicherten Grundrechtsdogmatik begründen lassen – wäre es doch mehr als erstaunlich, wenn sich gerade für solche Verhaltensweisen, die einem erhöhten sozialethischen Vorwurf ausgesetzt sein sollen, keine überzeugende Begründung für die Zulässigkeit und Angemessenheit ihrer Beschränkung finden ließen.[115]
53
Ernster wiegen daher Einwände, die sich nicht gegen die Zulässigkeit , sondern gegen die Ergiebigkeit einer verfassungsrechtlichen Argumentation richten, insbesondere bei einem Vergleich der detaillierteren Vorschriften des Strafrechts und seiner ausdifferenzierten und elaborierten Dogmatik mit den relativ allgemein gehaltenen Normen des GG,[116] die etwa Naucke als nur „verfassungsrechtlich ein(gekleidete)“[117] Argumentationsstränge bezeichnet, bei der die Verfassung die „Überpositivität gegenüber dem relativistischen Positivismus“ vertrete. Indes dürfte der zugegebenermaßen oft knappe Verfassungstext insbesondere durch die Spruchpraxis des BVerfG mittlerweile vielfach in einem Maße an Substanz gewonnen haben, das durchaus reichhaltiges Argumentationsmaterial an die Hand gibt. Zudem gilt es eben, die beschränkte Leistungsfähigkeit einer verfassungsrechtlichen Beurteilung realistisch einzuschätzen und diese Beschränktheit auch bei der Gewichtung des Arguments redlich zu berücksichtigen – indes ist dies kein Problem allein der verfassungsorientierten Auslegung, sondern gilt auch für das klassische Methodenquartett (mal mehr, mal weniger). Und gewiss ist die Erkenntnis, wie ein Auslegungsergebnis auf keinen Fall aussehen darf , zur Minimierung verfassungsrechtlicher „Risiken“ möglichst nicht aussehen sollte oder zu einer möglichst optimalen Verwirklichung verfassungsrechtlich begründeter Postulate sogar wünschenswert wäre , schon ein Fortschritt.
c) Die Wirkweise verfassungsorientierter Auslegung
54
Während eine Vorschrift als solche nur verfassungsgemäß sein kann oder eben nicht,[118] können verschiedene Lesarten der Vorschrift aus grundgesetzlicher Sicht wünschenswerter oder bedenklicher sein.[119] Daraus folgt, dass die verfassungsrechtliche Perspektive nicht nur zu der oben beschriebenen verfassungskonformen Auslegung in Fällen „harter Verfassungswidrigkeit“ herangezogen werden kann. Vielmehr kann die Ausstrahlungswirkung der Verfassung auch – bei genauerer Einordnung dann als Akt der systematischen Auslegung – als Argument bei der Entscheidung für die eine oder andere Lesart diesseits des Verdikts der Verfassungswidrigkeit fruchtbar gemacht werden:[120] Wenn etwa durch eine bestimmte Interpretation die Wirkkraft der tangierten Grundrechte optimiert wird, ist dies ein Argument für diese Interpretation. Dieses ist dann freilich – und darin liegt ein Unterschied zur verfassungskonformen Auslegung i.e.S. – nicht zwingend bzw. unüberwindbar, sondern muss mit den anderen Argumenten, die für oder gegen eine bestimmte Lesart sprechen, abgewogen und diskursiv verarbeitet werden.
55
Die Intensität der systematisch-grundgesetzlichen Argumentation wird dabei umso größer, je problematischer eine bestimmte Interpretation sub specie constitutionis wird;[121] denn das Grundgesetz gebietet nicht kategorisch eine optimale Verwirklichung eines Grundrechtes[122] (was auf Grund der steten Kollisionen verfassungsrechtlicher Rechtspositionen ohnehin nicht möglich ist), verbietet aber die völlige Vernachlässigung eines Grundrechts zugunsten anderer Interessen. Anders als bei der verfassungsrechtlichen Beurteilung einer Strafnorm als solcher ist bei der Auslegung eine Aussage über eine mehr oder weniger gute Berücksichtigung von verfassungsrechtlichen Garantien also durchaus sinnvoll. Lassen sich hier signifikante Unterschiede feststellen, ist auch diesseits „harter Verfassungswidrigkeit“ die nähere Orientierung an den Grundrechten ein gewichtiges systematisches Argument bei der Rechtsfindung.
bb) Insbesondere die Anwendung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes
56
(1)Die Einschlägigkeit des jeweiligen grundrechtlichen Schutzbereichs ist ebenso wie sich daraus etwa ergebende qualifizierte Anforderungen an die Rechtfertigung stets eine Frage des Einzelfalls. Gewisse allgemeine Aussagen sind aber zur Prüfung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes als einem wichtigen Bestandteil jeder Grundrechtsprüfung möglich.[123] Dieser besagt bekanntlich, dass Eingriffe in verfassungsrechtlich geschützte Positionen nur erlaubt sind, wenn sie zur Verfolgung eines legitimen Zwecks geeignet, erforderlich (d.h. das relativ mildeste Mittel) und angemessen (verhältnismäßig i.e.S.) sind.
57
(2)Geht es nun um die Operationalisierung dieses Prinzips bei der Auslegung, wird die erste Stufe der Verfolgung eines legitimen Zweckes regelmäßig unproblematisch sein. Unabhängig davon, wie man das insbesondere mit der „Inzest-Entscheidung“ des BVerfG und der nachfolgenden Diskussion[124] wieder verstärkt ins Blickfeld geratene Verhältnis zwischen „legitimem Zweck“ und „strafrechtlichem Rechtsgut“ exakt definiert, wird für den Regelfall davon auszugehen sein, dass mit der Anwendung einer Strafnorm ein solcher legitimer Zweck verfolgt wird.
Читать дальше