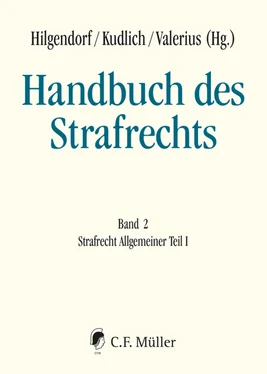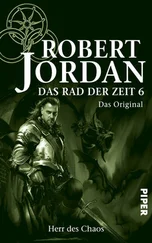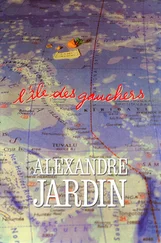[140]
Es geht also nicht darum, (gar letztverbindlich) vom Eintritt eines Erfolges automatisch auf ein objektiv pflichtwidriges Verhalten zu schließen , was Otto , Hirsch-FS, S. 291, 304 (in anderem Zusammenhang) zu Recht als „mit den Grundsätzen der heute weithin anerkannten personalen Unrechtskonzeption (. . .) nicht vereinbar“ bezeichnet.
[141]
Ein Beispiel wäre die eigenverantwortliche Selbstgefährdung des Opfers.
[142]
Vgl. Roxin , Honig-FS, S. 133, 147.
7. Abschnitt: Geltungsbereich des Strafrechts
Inhaltsverzeichnis
§ 30 Zeitlicher Geltungsbereich
§ 31 Räumlicher Geltungsbereich
7. Abschnitt: Geltungsbereich des Strafrechts› § 30 Zeitlicher Geltungsbereich
Gerhard Dannecker
§ 30 Zeitlicher Geltungsbereich
A.Historische Entwicklung2 – 14
I. Vorgeschichte des Grundsatzes „nullum crimen, nulla poena sine lege“ und des „lex mitior“-Prinzips bis zur Aufklärung2 – 4
II.Entwicklung des Rückwirkungsverbots und des Milderungsgebots unter dem Einfluss der Aufklärung bis zur Weimarer Reichsverfassung5 – 11
1. Rückwirkungsverbot5, 6
2. Milderungsgebot7 – 11
III. Das Rückwirkungsverbot und das Milderungsgebot im Nationalsozialismus12
IV. Wiedereinführung des Milderungsgebots nach dem Zweiten Weltkrieg und Regelung im Einigungsvertrag13, 14
B.Hauptteil15 – 85
I. Grundsätzliches15
II. Ausgestaltung des intertemporalen Strafrechts in § 2 StGB16 – 85
1. Prinzipien des intertemporalen Strafrechts17 – 23
a) Konkretisierung des verfassungsrechtlichen Rückwirkungsverbots durch § 2 Abs. 1 und 2 StGB18
b) Meistbegünstigungsprinzip19, 20
c) Durchbrechung des Meistbegünstigungsprinzips für Zeitgesetze21
d) Sonderregelung für Verfall, Einziehung und Unbrauchbarmachung22
e) Sonderregelung für Maßregeln der Besserung und Sicherung23
2. Zeitlicher Geltungs- und Anwendungsbereich von Strafgesetzen24 – 38
a) Inkrafttreten und Derogation von Gesetzen25, 26
b) Dogmatische und systematische Konzeption des § 2 StGB27 – 32
c) Regelung des zeitlichen Anwendungsbereichs durch § 2 StGB33 – 35
d) § 2 StGB als Rechtsgeltungsregel für das frühere Gesetz36
e) Grundsätzliche Geltung des Urteilszeitrechts37
f) Praktische Bedeutung der unterschiedlichen Konzeptionen des § 2 StGB38
3. Regelungsgehalt des § 2 Abs. 1 StGB: limitierende Funktion der aufgehobenen Rechtsnormen39 – 56
a) Anwendungsbereich des § 2 Abs. 1 StGB40
b) Materielles Strafrecht41 – 45
c) Strafverfahrensrecht46 – 52
d) Änderungen der Rechtsprechung53
e) Geltung des Gesetzes „zur Zeit der Tat“54, 55
f) Änderungen der Strafbarkeit während der Begehung der Tat56
4. Regelungsgehalt des § 2 Abs. 2 StGB: Änderungen der Strafart und Strafdrohung zwischen Beginn und Beendigung der Tat57 – 59
5. Regelungsgehalt des § 2 Abs. 3 StGB: Meistbegünstigungsprinzip60 – 76
a) Anwendung des mildesten Gesetzes bei Gesetzesänderungen zwischen Beendigung der Tat und Entscheidung61, 62
b) Bestimmung des mildesten „Gesetzes“63 – 73
aa) Anforderungen an die Unrechtskontinuität64 – 66
bb) Anwendbarkeit des Milderungsgebots auf Blankettvorschriften67 – 72
cc) Anwendbarkeit des Milderungsgebots auf rechtsnormative Tatbestandsmerkmale73
c) Feststellung des mildesten Gesetzes74, 75
d) Mehrfache Gesetzesänderungen und Zwischengesetze76
6. Sonderregelungen für Zeitgesetze77 – 81
a) Grundlagen78
b) Begriff des Zeitgesetzes79, 80
c) Vorbehalt für abweichende Regelungen81
7. Verfall, Einziehung und Unbrauchbarmachung82
8. Ausnahme für Maßregeln der Sicherung und Besserung83 – 85
C.Internationalisierung, vornehmlich Europäisierung des Strafrechts86 – 114
I. Rückwirkungsverbot86 – 88
1. Art. 7 EMRK87
2. Art. 49 Abs. 1 S. 3 GRCh88
II.Lex mitior89 – 100
1. Verortung des Milderungsgebots im Grundsatz „nullum crimen sine lege“ (Art. 7 EMRK) durch den EGMR89 – 93
2. Art. 49 Abs. 1 S. 3 GR-Charta94 – 100
a) Eröffnung des Anwendungsbereichs der Grundrechtecharta95
b) Erstreckung des Milderungsgebots auf Richtlinien, Verordnungen und Rahmenbeschlüsse96, 97
c) Erstreckung des Milderungsgebots auf den Anwendungsvorrang des Unionsrechts?98, 99
d) Verdrängung der Sonderregelung für Zeitgesetze in § 2 Abs. 4 StGB durch Art. 49 Abs. 1 S. 3 GRCh?100
III.Klassische Fragestellungen101 – 114
1. Rückwirkungsverbot101 – 106
a) Tötungen an der innerdeutschen Grenze102, 103
b) Geltung des Rückwirkungsverbots für Maßregeln der Besserung und Sicherung?104 – 106
2.Milderungsgebot und intertemporale Ahndungslücken107 – 114
a) Anforderungen an eine Ahndungslücke107 – 109
b) Möglichkeiten zur Schließung einer intertemporalen Ahndungslücke durch den Gesetzgeber110 – 114
Ausgewählte Literatur
1
Der zeitliche Geltungsbereich des Strafrechts ist in § 2 StGB geregelt. Dort legt der Gesetzgeber fest, welches Recht bei einer Änderung des Gesetzes zwischen der Begehung der Straftat und der Entscheidung der Strafverfolgungsorgane anzuwenden ist. Hierfür enthält § 2 StGB verschiedene Einzelbestimmungen, die in ihrer Gesamtheit das „ intertemporale Strafrecht“[1] konstituieren. Damit bildet § 2 StGBneben § 1 StGB, der unter anderem das Rückwirkungsverbot für nachträgliche Strafschärfungen enthält, die zweite wichtige Säule für die Anwendung des Strafrechtsim Hinblick auf Gesetzesänderungen nach Begehung einer Straftat. Im Rahmen des § 2 StGB kommen folgende vier Prinzipien zum Tragen: das Rückwirkungsverbot(§ 2 Abs. 1 und 2 StGB), das Meistbegünstigungsprinzip(§ 2 Abs. 3 StGB), die Einschränkung des Meistbegünstigungsprinzips für Zeitgesetze(§ 2 Abs. 4 StGB) und die Einschränkung des Rückwirkungsverbots für Maßregeln der Besserung und Sicherungim Interesse einer zeitgerechten Prävention (§ 2 Abs. 6 StGB).[2] Daher kann § 2 StGB nicht als bloße Konkretisierung des Rückwirkungsverbots charakterisiert werden,[3] zumal dieses Verbot ohnehin bereits in § 1 StGB geregelt ist und durch § 2 StGB erheblich modifiziert, für bestimmte Fälle sogar ganz aufgehoben wird.[4]
7. Abschnitt: Geltungsbereich des Strafrechts› § 30 Zeitlicher Geltungsbereich› A. Historische Entwicklung
A. Historische Entwicklung
I. Vorgeschichte des Grundsatzes „nullum crimen, nulla poena sine lege“ und des „lex mitior“-Prinzips bis zur Aufklärung
2
Das Rückwirkungsverbotwar im Ansatz bereits im späten römischen Reichanerkannt.[5] Es wurde zum einen auf den Schuldgrundsatz gestützt, weil der Täter die übertretene Norm gekannt haben muss, wenn er bestraft werden soll, zum anderen auf die Beschränkung auf konstitutive Gesetze, die ein an sich indifferentes Verhalten unter Strafdrohung stellen. Wenn hingegen ein Gesetz bei delicta per se lediglich ein als Unrecht gewertetes Verhalten deklaratorisch als strafwürdig erklärte, wurde darin keine Rückwirkung gesehen. Normkonstituierende Gesetze kamen erst in der späten Zeit der Republik auf.[6] Unter Berufung auf den Rechtsgrund für das Verbot rückwirkender Pönalisierungen wird überwiegend angenommen, dass ein strafrechtliches Rückwirkungsverbot nicht bestanden hat.[7]
3
Bezüglich des Rückwirkungsgebots des milderen Rechtsbesteht Einigkeit, dass angesichts der wenigen bekannten Quellen kein allgemeines Gebot rückwirkender Anwendung des milderen Rechts bestand, sondern nur als ein kaiserlicher Gnadenaktbestand.[8]
Читать дальше