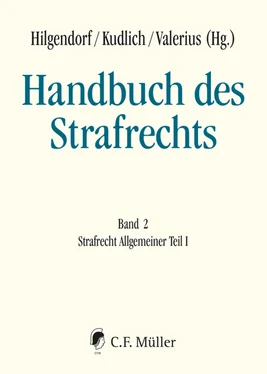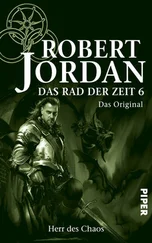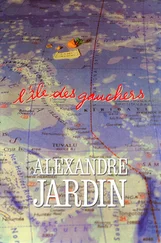IV. Wiedereinführung des Milderungsgebots nach dem Zweiten Weltkrieg und Regelung im Einigungsvertrag
13
Nach dem Zusammenbruch des Dritten Reiches erließen die Besatzungsmächte im Londoner Abkommen vom 8. August 1945sowie im Kontrollratsgesetz Nr. 10 vom 20. Dezember 1945 selbst teilweise rückwirkende Strafvorschriften.[27] Die deutschen Länderverfassungen und das Grundgesetz vom 23. Mai 1949knüpften für das Rückwirkungsverbot im Hinblick auf die Formulierung wie auch auf den Gehalt an den Stand der Weimarer Reichsverfassung an[28], und auch das Milderungsgebot wurde wieder eingeführt. Der durch das 3. StRÄndG eingeführte § 2 StGB (1953)lautete:
| (1) |
Eine Handlung kann nur dann mit einer Strafe belegt werden, wenn die Strafe gesetzlich bestimmt war, bevor die Handlung begangen wurde. |
| (2) |
Die Strafe bestimmt sich nach dem Recht, das zur Zeit der Tat gilt. Bei Verschiedenheit der Gesetze von der Zeit der begangenen Handlung bis zu deren Aburteilung ist das mindeste Gesetz anzuwenden. |
| (3) |
Ein Gesetz, das nur für eine bestimmte Zeit erlassen ist, ist auf die während seiner Geltung begangenen Straftaten auch dann anzuwenden, wenn es außer Kraft getreten ist. |
| (4) |
Über Maßregeln der Sicherung und Besserung ist nach dem Gesetz zu entscheiden, das zur Zeit der Entscheidung gilt. |
Seine heutige Fassung erhielt § 2 StGB durch das EGStGB vom 2. März 1974.[29]
14
§ 2 StGB gilt nach dem Einigungsvertragauch für Straftaten, die noch in der ehemaligen DDR begangen worden sind, modifiziert durch Art. 315 Abs. 1 bis 3 EGStGB.[30] Allerdings finden diese Absätze nach Art. 315 Abs. 4 EGStGB keine Anwendung für Taten, für die das deutsche Strafgesetzbuch aufgrund der allgemeinen Vorschriften über das Strafanwendungsrecht bereits vor dem 3. Oktober 1990 anwendbar war. Inzwischen ist diese Regelung weitestgehend bedeutungslos geworden.
7. Abschnitt: Geltungsbereich des Strafrechts› § 30 Zeitlicher Geltungsbereich› B. Hauptteil
B. Hauptteil
15
§ 2 StGB definiert den zeitlichen Anwendungsbereich des Strafgesetzesund regelt damit die Frage, welches Recht anwendbar ist, wenn sich nach der Tatbegehung die strafrechtlich relevante Rechtslage geändert hat. Dabei umfasst der praktische Anwendungsbereich des intertemporalen Strafrechtsneben den Änderungen des Strafgesetzbuchsselbst, die sowohl auf Entkriminalisierung als auch auf Ausweitung und Verschärfung des Strafrechts gerichtet sein können, auch außerstrafrechtliche Regelungen, die durch Strafgesetze in Bezug genommen werden ( blankettausfüllende Gesetze). Neben Rechtsänderungen innerhalb einer kontinuierlichen Ordnungbestimmt sich auch die Ablösung einer Rechtsordnung durch eine neue, wie dies mit dem Beitritt der DDR zur Bundesrepublik der Fall war, nach den Vorgaben des § 2 StGB.
II. Ausgestaltung des intertemporalen Strafrechts in § 2 StGB
16
§ 2 StGB regelt den zeitlichen Geltungsbereich der Straftatbeständemittels Einzelbestimmungen zur zeitlichen Geltung, die in ihrer Gesamtheit das intertemporale Strafrechtausmachen.[31] Die Absätze 1 bis 4 regeln, ob und wonach der Täter bestraft werden kann; die Absätze 5 und 6 regeln, welche Nebenfolgen möglich sind. § 2 StGB greift ein, wenn es erst nach der Begehung der Tat zu einer Gesetzesänderung gekommen ist. Wenn ein Strafgesetz zwischen der Begehung und der Verurteilung einer Straftat geändert worden ist, stellt sich die Frage, welche der beiden Fassungen – das Gesetz zur Tatzeit oder das zur Entscheidungszeit – der gerichtlichen Entscheidung zu Grunde zu legen ist ( Rn. 18 ff.). Wenn das Strafgesetz zwischenzeitlich mehrfach geändert worden ist, stellt sich die Frage, ob und wie das Zwischengesetz zu berücksichtigen ist, obwohl es weder bei der Tatbegehung noch zurzeit der Entscheidung in Kraft war ( Rn. 63).
1. Prinzipien des intertemporalen Strafrechts
17
Im Rahmen des § 2 StGB kommen folgende vier Prinzipien zum Tragen: das Rückwirkungsverbot(§ 2 Abs. 1 und 2 StGB; siehe unten Rn. 39 ff.und Rn. 57 ff.), das Meistbegünstigungsprinzip(§ 2 Abs. 3 StGB; siehe unten Rn. 60 ff.), die Einschränkung des Meistbegünstigungsprinzips für Zeitgesetze(§ 2 Abs. 4 StGB; siehe unten Rn. 77 ff.) und die Einschränkung des Rückwirkungsverbots für Maßregeln der Besserung und Sicherungim Interesse einer zeitgerechten Prävention (§ 2 Abs. 6 StGB; siehe unten Rn. 83 ff.).[32]
a) Konkretisierung des verfassungsrechtlichen Rückwirkungsverbots durch § 2 Abs. 1 und 2 StGB
18
§ 2 Abs. 1 StGBerklärt für Gesetzesänderungen zwischen Tatzeit und Entscheidungszeit das Tatzeitrechtfür anwendbar und enthält damit eine einfachrechtliche Bestätigung des verfassungsrechtlichen Rückwirkungsverbots(Art. 103 Abs. 2 GG), die neben § 1 StGB tritt. In der Mauerschützen-Entscheidung hat das Bundesverfassungsgericht das Rückwirkungsverbot sogar als „absolut“ bezeichnet und darin ein „Spezifikum unter den Garantien der Rechtsstaatlichkeit“ gesehen.[33] Das Rückwirkungsverbot „bietet die Grundlage“ für den Einzelnen, „sein Verhalten eigenverantwortlich so einzurichten, dass er eine Strafbarkeit vermeidet“.[34] Das zur Entscheidungszeit geltende Gesetz darf deshalb die Strafe und die Nebenfolgen für die frühere Tat nicht rückwirkend bestimmen. Der Inhalt des § 2 StGB reicht insofern weiter als § 1 StGB und Art. 103 Abs. 2 GG, als in § 2 Abs. 2 StGBfür Änderungen der Strafart und der Strafdrohung der Begriff „zur Zeit der Tat“ auf den Zeitpunkt bei „ Beendigung der Tat“ festgelegt wird, der bei zeitlich gestreckter Tatbestandsverwirklichung zu Grunde zu legen ist; insoweit handelt es sich um eine verfassungsrechtlich nicht unproblematische Ergänzung des § 2 Abs. 1 StGB (näher dazu Rn. 58 ff.).
b) Meistbegünstigungsprinzip
19
§ 2 Abs. 3 StGBordnet für den Fall, dass das zur Zeit der Tat geltende Gesetz vor der Entscheidung geändert worden ist, die Anwendung des mildesten Gesetzesan. Da sich das Rückwirkungsverbot für nachträgliche Strafschärfungen schon aus § 1 und § 2 Abs. 1 und 5 StGB i.V.m. Art. 103 Abs. 2 GG ergibt, liegt die Bedeutung des § 2 Abs. 3 StGB darin, für nachträgliche Milderungen der Gesetzeslage ein Gebot der Rückwirkungfür das mildeste, dem Tatzeitrecht nachfolgende Änderungsgesetz aufzustellen. Zugunsten des Täters ist danach vom Prinzip der Meistbegünstigung[35] auszugehen. Durch dieses Prinzip wird zum Ausdruck gebracht, dass das Rückwirkungsverbot des Art. 103 Abs. 2 GG und des § 1 StGB einer rückwirkenden Anwendung des Strafgesetzes nur dann entgegensteht, wenn dies für den Betroffenen ungünstiger wäre als das Entscheidungszeitrecht (Rückwirkungsverbot in malam partem; unten Rn. 37).
20
Das Meistbegünstigungsprinzip ist in Art. 15 Abs. 1 S. 3 IPbpRals Menschenrecht garantiert; auch Art. 49 Abs. 1 S. 3 GRChenthält ein Rückwirkungsgebot für mildere Gesetze.[36] Umstritten ist allerdings, ob das zum Zeitpunkt geltende mildere Gesetz anzuwenden ist, wenn zwischenzeitlich ein milderes Gesetz in Kraft war.[37]
c) Durchbrechung des Meistbegünstigungsprinzips für Zeitgesetze
Читать дальше