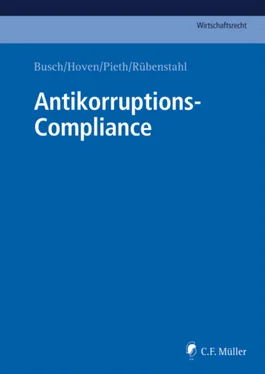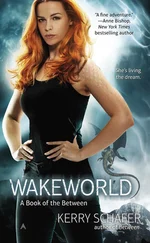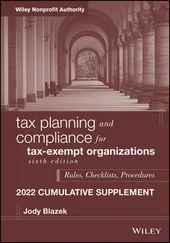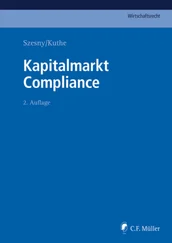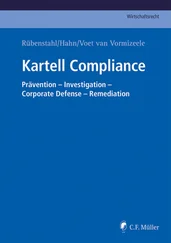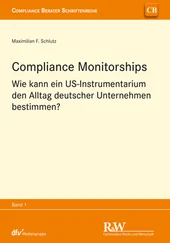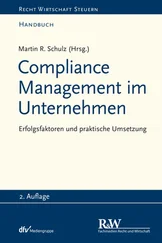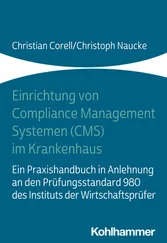2. Stadien der Deliktsverwirklichung (Versuch, Vollendung, Beendigung)
3. Rechtfertigung
4.Rechtsfolgen
a) Strafrahmen
b) Sonstiges
5. Strafanwendungsrecht
6. Konkurrenzen
VI. Prozessuales
C. Vorteilsannahme und Vorteilsgewährung (§§ 331, 333 StGB)
I. Tatbild und Unrechtskern
II. Täterkreis
III.Korruptive Konnexität (gelockerte Unrechtsvereinbarung)
1. Allgemeines
2.Inhalt der gelockerten Unrechtsvereinbarung
a) Leistung des Gebers (Vorteil)
b) Bezugspunkt des Vorteils (Dienstausübung)
c) Ungeschriebenes Merkmal: Beeinflussungswille
3. Gründe für den Ausschluss einer gelockerten Unrechtsvereinbarung (Regelkonformität)
a) Gesetzliche Erlaubnisse
b) Vorherige Zustimmung
4. Treffen der gelockerten Unrechtsvereinbarung (Tathandlungen)
IV. Subjektiver Tatbestand (Vorsatz und Irrtum)
V.Sonstiges
1. Unterlassen
2. Stadien der Deliktsverwirklichung (Versuch, Vollendung, Beendigung)
3. Straffreistellungsgründe
4.Rechtsfolgen
a) Strafrahmen
b) Einziehung
5. Strafanwendungsrecht
6. Konkurrenzen
7. Prozessuales
2. Kapitel Mandatsträgerbestechung
A. Einleitung
B. Der Begriff des Mandatsträgers
C.Nichtstrafrechtliche Antikorruptionsregelungen, insbesondere für Mitglieder des Bundestages
I. Überblick
II.Die für Mitglieder des Bundestags geltenden Regelungen
1. Einleitung
2. Nebentätigkeiten
3.Materielle Zuwendungen
a) Überblick
b) Abgeordnetenspenden (§ 4 Abs. 1 bis 5 VR)
c) Zuwendungen zur privaten oder freien Verfügung (§ 44a Abs. 2 S. 1 bis 3 AbgG)
d) Gastgeschenke mit Bezug zum Mandat (§ 4 Abs. 6 VR)
D.Der Straftatbestand des § 108e StGB
I. Überblick
II.Ungerechtfertigter Vorteil für sich oder einen Dritten
1. Überblick
2. Einklang mit Mandatsträgerrechtsstellungsvorschriften (§ 108e Abs. 4 S. 1 StGB)
3. Zulässige Spenden (§ 108e Abs. 4 S. 2 Nr. 2 StGB)
4. Politische Mandate und Funktionen (§ 108e Abs. 4 S. 2 Nr. 1 StGB)
5. Sonstige „gerechtfertigter“ Vorteile
III. Als Gegenleistung für eine Handlung im Auftrag oder auf Weisung
IV. Bei der „Wahrnehmung des Mandats“
V. Vorsatz, Rechtswidrigkeit, Schuld
3. Kapitel Bestechung und Bestechlichkeit im geschäftlichen Verkehr (§ 299 StGB)
I.Einführung
1. Praktische Bedeutung und kriminologischer Hintergrund
2. Entwicklung des Tatbestands; europäische und internationale Vorgaben
3. Struktur der Vorschrift
4. Schutzzwecke der Vorschrift
5. Anwendbarkeit der Vorschrift bei Auslandsbezug
II.Tatbestände des § 299 StGB
1.„Nehmerseite“: Bestechlichkeit im geschäftlichen Verkehr (Abs. 1)
a) Täterkreis: Angestellter oder Beauftragter eines Unternehmens
b) Tatsituation: im geschäftlichen Verkehr
c) Tathandlung: Fordern, Versprechen-Lassen oder Annehmen eines (Dritt-)Vorteils
d) Unrechtsvereinbarung beim Bezug von Waren und Dienstleistungen
e) Gegenstand der Unrechtsvereinbarung
f) Tatbestandsausschluss bei Einwilligung
g) Subjektiver Tatbestand
h) Rechtfertigung
i) Schuld
2. „Geberseite“: Bestechung im geschäftlichen Verkehr (Abs. 2)
3. Praxisrelevante Strafbarkeitsrisiken und problematische Fallkonstellationen
III.Rechtsfolgenseite
1. Konkurrenzen und Begleittatbestände
2. Rechtsfolgen
IV.Strafverfolgung und Prozessuales
1. Verjährung
2. Strafantrag
3. Strafprozessuale Besonderheiten
V. Prävention und Compliance
4. Kapitel Korruption im Gesundheitswesen
I.Einführung
1. Praktische Relevanz
2. Gesetzgebungsgeschichte
3. Regelungszweck
II.Der Tatbestand
1. Erfasste Berufe
2. Vorteilsbegriff
3.Tathandlungen
a) Zusammenhang mit Berufsausübung
b) Handlungen nach § 299a StGB
c) Handlungen nach § 299b StGB
d) Unrechtsvereinbarung
e) Unlautere Bevorzugung im Wettbewerb
4. Subjektiver Tatbestand
5. Besonders schwerer Fall, § 300 StGB
III.Praxisrelevante Fallkonstellationen
1.Konstellationen betreffend alle Berufsgruppen
a) Geschenke und Einladungen
b) Überlassung von Räumlichkeiten
c) Referententätigkeiten und Beraterverträge
d) Unternehmensbeteiligungen
2.Kooperation von Ärzten mit Ärzten
a) Zusammenschlüsse von Ärzten
b) Laboruntersuchungen
3.Kooperation von Ärzten mit anderen Heilberufsangehörigen
a) Kooperation von Ärzten mit Krankenhäusern
b) Kooperation von Ärzten mit Pharmafirmen
c) Kooperation von Ärzten mit andere Berufsgruppen
IV.Praktische Hinweise
1. Konkurrenzen
2. Verjährung
3. Steuerrechtliche Konsequenzen
4. Approbationsrechtliche und vertragsarztrechtliche Konsequenzen
a) Widerruf der Approbation
b) Entziehung der vertragsärztlichen Zulassung
5.Das Ermittlungsverfahren
a) Anonyme Anzeigen
b) Erkenntnisse aus Betriebsprüfungen und aufgrund von Finanzermittlungen
c) Hinweise von den Stellen zur Bekämpfung von Fehlverhalten im Gesundheitswesen
d) Verfahrensfragen
6. Compliance
5. Kapitel Sport und Korruption
A. Einführung und thematische Abgrenzung
B. Erscheinungsformen korrupten und korrumpierenden Verhaltens im Sport
I. Sponsoren und Einladungen
1. Sponsoren
2. Einladungen
a) Einladungen an Amtsträger
b) Einladungen an professionelle Kontakte („Landschaftspflege“)
c) Einladungen an Dritte
II. Wahlen in Gremien und Ämter
1. Erlangung des Amtes
2. Interessenkollisionen
III. Vergabe von Sportereignissen
IV. Ticketvergabe
V. Vergabe von Fernsehrechten
VI. Ehrenamtler und Aufwandsentschädigung
VII. Zusammenarbeit mit Beratern und Vermittlern
VIII. Zusammenarbeit mit Business Partnern/Abhängigkeiten von Geschäftspartnern
IX. Geldwäsche
X. Interessenkonflikte im Tagesgeschäft
XI. Kartellrecht
XII. Datenschutz
XIII. Tax Compliance
XIV. Wettbewerb- und Spielmanipulation
XV. Internationale Embargos
C. Sonderfall Doping
D. Fazit und Ausblick
6. Kapitel Steuerstrafrechtliche Aspekte der Antikorruptions-Compliance
A. Einführung
B.Materielles Steuerstrafrecht
I.Grundlagen des § 370 AO
1. Täuschung über Besteuerungsgrundlagen
a) Steuerhinterziehung durch unrichtige oder unvollständige Tatsachenangaben
b) Steuerhinterziehung durch pflichtwidriges In-Unkenntnis-lassen der Finanzbehörde, § 370 Abs. 1 Nr. 2 AO
2.Taterfolge der Steuerhinterziehung
a) Verhältnis von Steuerverkürzung und ungerechtfertigter Steuervorteil
b) Steuerverkürzung
c) Erlangung nicht gerechtfertigter Steuervorteile
d) Kompensationsverbot
e) Verjährung
C.Korruption und die Auswirkungen auf die Steuerpflicht
I.Steuerhinterziehung durch Verschweigen von erhaltenen Bestechungsgeldern
1. Wertneutralität des Steuerrechts
2. Verstoß gegen die Selbstbelastungsfreiheit?
II.Steuerhinterziehung wegen Betriebsabgabenabzug gezahlter Bestechungsgelder
1.Das Abzugsverbot nach § 4 Abs. 5 Nr. 10 EStG
a) Keine Notwendigkeit einer Verurteilung
b) Sachlicher Anwendungsbereich des Abzugsverbots
c) Rechtfolge des § 4 Abs. 5 Nr. 10 EStG
d) Steuerhinterziehung bei Geltendmachung eines unberechtigten Abzugs
2. Empfängerbenennung und Versagung des Betriebskostenabzugs nach § 160 AO
III. Umsatzsteuerhinterziehung
D.Steuerstrafverfahren
I. Zuständigkeit
II.Durchbrechung des Steuergeheimnisses durch Mitteilungspflichten
1. Steuergeheimnis
Читать дальше