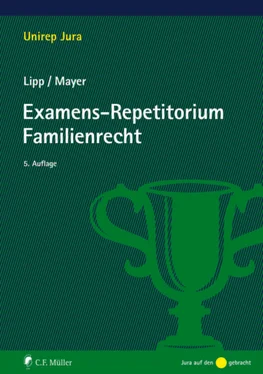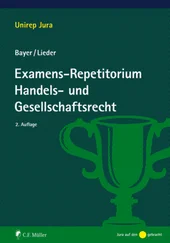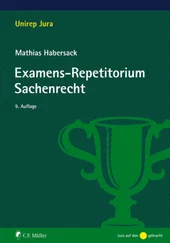Erster Teil Grundlagen› § 2 Verfassungsrechtliche Implikationen› II. „Familie“
Erster Teil Grundlagen› § 2 Verfassungsrechtliche Implikationen› II. „Familie“ › 1. Dogmatisch-begriffliche Selbstständigkeit der „Familie“
1. Dogmatisch-begriffliche Selbstständigkeit der „Familie“
36
Art. 6 Abs. 1 GG stellt auch die Familieunter den besonderen Schutz des Staates. Daraus ergibt sich eine begrifflich-dogmatische Selbstständigkeitder „Familie“ gegenüber der „Ehe“, aber auch umgekehrt. Die Trennung von Ehe und Familie und die damit getroffene Festlegung beider Rechtsinstitute als jeweils eigenständige, voneinander unabhängige Schutzgüter war nach den Erfahrungen mit der nationalsozialistischen Indienstnahme der Ehe für eine rassistisch orientierte staatliche Bevölkerungspolitik eine bewusste Entscheidung des Grundgesetzes gegenüber der Weimarer Reichsverfassung (WRV), die die Ehe noch als Grundlage der Familie unter Schutz gestellt hatte.[74]
37
Auch wenn eine Ehe nicht mehr besteht oder nie bestanden hat, existiert – heute unbestritten – zwischen einem Kindund dem mit ihm zusammenlebenden[75] Elternteileine Familie,[76] sei dieser Elternteil ein geschiedener Ehepartner, sei es die Mutter oder der Vater eines nichtehelichen Kindes.[77] Der Familienschutz schließt auch die nichteheliche Familieein; Art. 6 Abs. 1 GG garantiert insbesondere das Zusammenleben der Familienmitglieder und die Freiheit, über die Art und Weise der Gestaltung des familiären Zusammenlebens selbst zu entscheiden.[78] Den Schutz des Art. 6 Abs. 1 GG hat das BVerfG inzwischen von der rechtlichen Elternstellung gänzlich gelöst: Familie ist die „tatsächliche“ Lebens- und Erziehungsgemeinschaft zwischen Kindern und Eltern, die für jene die Verantwortung tragen; entscheidend ist die tatsächliche Verbundenheit zwischen den Familienmitgliedern. Auch der leibliche (nicht rechtliche) Vater bildet deshalb mit seinem Kind eine Familie, die unter den Schutz des Grundgesetzes fällt, wenn er mit seinem Kind zusammenlebt und tatsächliche Verantwortung übernommen hat (vgl. aber auch Rn. 39).[79] Gegenüber der Ehe als der „Vereinigung eines Mannes und einer Frau zur grundsätzlich unauflöslichen Lebensgemeinschaft“[80] ist die Familie die „umfassende Gemeinschaft von Eltern und Kindern.“[81] Maßgebliche Voraussetzung ist aber, dass es sich um eine „von der staatlichen Rechtsordnung anerkannte Gemeinschaft von Eltern und Kindern“ handelt.[82] Den Schutz des Art. 6 Abs. 1 GG genießen alle „sozialen Familien“,[83] also auch Adoptiv-[84] und Pflegefamilien[85] sowie die Gemeinschaft von Ehepartnern mit Stiefkindern[86] und die sozial-familiäre Gemeinschaft von eingetragenen Lebenspartnern mit dem leiblichen oder angenommenen Kind eines der Partner.[87] – Davon strikt zu trennenist die Frage, ob den Familienmitgliedern, die die elterliche Erziehungs- und Betreuungsfunktion wahrnehmen, auch das Elternrechtdes Art. 6 Abs. 2 S. 1 GG zukommt.[88]
38
Geschützt wird von Art. 6 Abs. 1 GG nicht nur die Kleinfamiliebestehend aus den Eltern und Kindern, sondern auch die Großfamilie(insb. die Beziehung zwischen Großeltern und Enkeln),[89] wobei die Einbeziehung der Großfamilien in den Familienbegriff des Art. 6 Abs. 1 GG nicht ausschließt, Abstufungen der Intensität des Schutzes zwischen Klein- und Großfamilie vorzunehmen.[90]
39
Schließlich unterfällt dem Schutzbereichder Familieauch die Beziehung zwischen einem Elternteil und seinem nichtmit ihm in häuslicher Gemeinschaft lebendenKind, sofern tatsächliche Verantwortung übernommen wird.
Beispiel:
Schutz des Art. 6 Abs. 1 GG für den geschiedenen, nicht sorgeberechtigten Elternteil, der aber Umgang mit dem Kind i.S.d. § 1684 Abs. 1 pflegt.[91]
Ausschlaggebend für diese Überlegungen ist ein von der jüngeren Rechtsprechung des BVerfG entwickelter und inzwischen mehrfach bestätigter materiell-funktionaler Familienbegriffdes Art. 6 Abs. 1 GG.
Erster Teil Grundlagen› § 2 Verfassungsrechtliche Implikationen› II. „Familie“ › 2. Materiell-funktionaler Familienbegriff
2. Materiell-funktionaler Familienbegriff
40
Fall 2[92]:
Der in Deutschland lebende Ausländer A ist nach mehrmals gescheitertem Asylverfahren ausreisepflichtig und befindet sich in Abschiebehaft. Bis dahin lebte er längere Zeit mit der deutschen F in nichtehelicher Lebensgemeinschaft zusammen. Ihr gemeinsames Kind, für das A die Vaterschaft anerkannt hat, ist ein Jahr alt. A und F wehren sich gegen die Abschiebung. – Abwandlung:A und F sind geschieden. Das Kind wohnt bei F, die auch sorgeberechtigt ist. A bezahlt regelmäßig Unterhalt für das Kind und nimmt die vereinbarten Umgangstermine wahr.
41
A selbst kann (im Ausgangsfall von Fall 2 ) gegen seine Abschiebung Art. 6 Abs. 1 GG in Anspruch nehmen. Er lebt mit seinem Kind zusammen, schafft damit die Voraussetzung, seine Elternverantwortung tatsächlich wahrzunehmenund bildet deshalb mit ihm eine Familie. Gegenüber einem Eingriff des Staates in diese Gemeinschaft schützt das Grundrecht aus Art. 6 Abs. 1 GG. Der Charakter einer wertentscheidenden Grundsatznorm verpflichtet die Ausländerbehörden, diese – möglicherweise auch erst nach Abschluss des Asylverfahrens geschaffene – familiäre Situation zu berücksichtigen. Ist die Lebensgemeinschaft zwischen Vater und Kind nur in Deutschland zu verwirklichen, weil diesem (etwa wegen der Beziehungen zu seiner deutschen Mutter) eine Ausreise nicht zugemutet werden kann, „so drängt die Pflicht des Staates, die Familie zu schützen, regelmäßig einwanderungspolitische Belange zurück“.[93]
42
Strittig ist aber, in welchem Umfang hier die F den Familienschutz des Art. 6 Abs. 1 GG für sich in Anspruch nehmen kann. Sie kann es jedenfalls, soweit es um den Schutz der Lebensgemeinschaft zwischen ihr und dem Kind geht. In Fall 2 beruft sie sich aber auf ihre nichteheliche Lebensgemeinschaftmit A als einer geschützten Familiengemeinschaft der Elternteile. Ein Teil des Schrifttums verneint einen solchen Schutz und geht bei zusammenlebenden, nicht miteinander verheirateten Eltern und ihren Kindern von zwei Familien (zwei Eltern-Kind-Beziehungen) aus.[94] Dagegen wird für eine Familie geltend gemacht, dass sich der verfassungsrechtliche Schutz der „Familie“ aus der tatsächlichen Lebensgemeinschaft der Eltern mit den Kindern in Wahrnehmung von Pflege und Erziehung herleite. Diese Lebensgemeinschaft umfasse als Einheit auch die beiden Elternteile.[95]
43
Das BVerfGhatte lange keinen verbindlichen Familienbegriff formuliert. Es hat zwar davon gesprochen, dass „Konkubinate“[96], auch wenn sie „[…] jahrelang bestanden haben, […] keinen verfassungsrechtlichen Schutz beanspruchen“[97] können, aber diese Entscheidung war „aus dem Gesichtspunkt des Schutzes der Institution Ehe“[98] getroffen worden. Andererseits hat es den Familienbegriff nicht statisch-definitivumrissen, sondern begreift ihn funktional.
44
In einer Leitentscheidung[99] hat das Gericht die funktionale Stufung der Familie i.S.d. Art. 6 Abs. 1 GG näher dargelegt und dabei die unterschiedliche Schutzdichtedes Grundgesetzes für die jeweils vorliegende Familienfunktion hervorgehoben. Der Familienschutz des Grundgesetzes bezieht sich als erstes und in seinem Kern auf die Familie als Lebens- und Erziehungsgemeinschaft. Diese Familie wird „als verantwortliche Elternschaft […] von der prinzipiellen Schutzbedürftigkeit des heranwachsenden Kindes bestimmt“.[100] Mit zurückgehender Erziehungs- und Pflegebedürftigkeit wandelt sich die Familie von einer Lebens- zu einer bloßen Hausgemeinschaft, in der die Mitglieder trotz gemeinsamen Haushalts ein weithin individuelles Leben führen. Nach Auflösung dieser Hausgemeinschaft bleibt die Familie als Begegnungsgemeinschafterhalten.[101] Die Entfaltung des verfassungsrechtlichen Schutzes(Institutsgarantie, Freiheitsrecht, wertentscheidende Grundsatznorm) wirkt nicht auf jede Familie in vollem Umfang, sondern in dem Maße, in dem von ihren Mitgliedern (Eltern) die beschriebenen Familienfunktionen wahrgenommenwerden. So hat das BVerfG im Falle der Adoption eines (auszuweisenden) erwachsenen Ausländers den Maßstab des Art. 6 Abs. 1 GG auf eine bloße Begegnungsgemeinschaft reduziert, die auch durch Besuche, Brief- und Telefonkontakte aufrechterhalten werden könne.[102] Diese vom BVerfG entwickelte funktionale Stufung von „Familie“ und die damit einhergehende, sich im Laufe der Zeit funktionsbedingt ändernde Schutzwirkungdes Art. 6 Abs. 1 GG sprechen dafür, (bei gelebter Hausgemeinschaft) gegebenenfalls auch Dritte in den Schutzbereich der Norm einzubeziehen und als Mitglieder der „Familie“ anzuerkennen, sofern auf Dauer von ihnen Familienfunktionen wahrgenommen werden. Die Institutsgarantiegewährleistet (wie beim Eheschutz) ein Recht zu einer Familiengemeinschaft im Bundesgebiet aber nur, wenn sich alle Familienmitglieder rechtmäßig auf Dauer im Bundesgebiet aufhalten.[103] Aufenthaltsrechtliche Schutzwirkung geht dagegen zunächst nur von Art. 6 Abs. 1 GG als wertentscheidender Grundsatznorm aus, der bei ermessensfehlerhafter Rechtsausübung ein Grundrechtsschutz nachfolgt.
Читать дальше