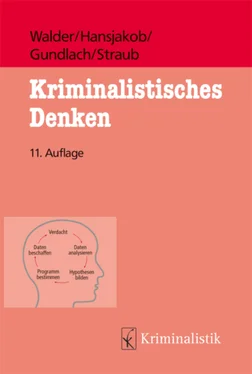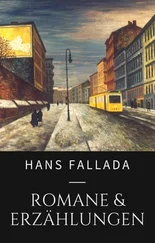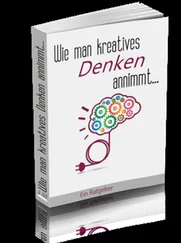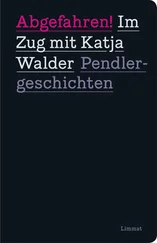4.1 Widersprüche erkennen
4.2 Unrichtige Daten erkennen
4.3 Vorgetäuschte Daten erkennen
5. Der Ausschluss irrelevanter Daten
6. Der Ausschluss unwahrscheinlicher Daten
IV.Hypothesen bilden
1. Grundsätzliche Überlegungen
2. Ereignisversionen und Tathypothesen
3.Hypothesenbildung
3.1 Der Weg zur Hypothese
3.2 Der Gegenstand von Hypothesen
3.3 Erfahrung als Voraussetzung von Einfällen
3.4 Rückschaufehler
4. Strukturiertes Analysieren
5. Von der Operativen Fallanalyse zur Hypothesenbildung
6. Täterprofile
7. Beispiele für Hypothesen
8. Die Überprüfung von Hypothesen
V.Das Programm bestimmen
1. Tatbestände bestimmen
2.Der Umfang des Programms
2.1. Grundsätzliches
2.2 Das vollendete vorsätzliche Begehungsdelikt
2.3 Das versuchte Begehungsdelikt
2.4 Das fahrlässige Begehungsdelikt
2.5 Das Unterlassungsdelikt
2.6 Die Beteiligung mehrerer Personen
2.7 Der Beweis strafzumessungsrelevanter Faktoren
3. Programm und Ermittlungsplan
4. Beispiel eines Ermittlungsplans
VI.Daten beschaffen
1. Das Programm als Ausgangspunkt
2. Die Reihenfolge der Erhebung von Daten
3. Grundsätzliches zu Vernehmungen
3.1 Grenzen der Wahrnehmung
3.2 Grenzen der Erinnerung
3.3 False Memory
3.4 Verbal Overshadowing
3.5 Falsche Spurenlegung bei Befragungen vermeiden
3.6 Die zuverlässige Wiedergabe des Erinnerten
3.6.1 Das PEACE-Modell
3.6.2 Das Kognitive Interview oder erweiterte Kognitive Interview
3.6.3 Die strukturierte Vernehmung
3.6.4 Die Vernehmungsuhr
3.6.5 Die SUE-Technik
3.7 Das Protokoll
3.8 Wahrheit und Lüge
3.8.1 Kriterien der Glaubhaftigkeit
3.8.2 Die Gründe für ein bestimmtes Aussageverhalten
4.Besonderheiten der Vernehmung nach prozessualer Stellung
4.1 Die Vernehmung des Anzeigeerstatters
4.2 Die Vernehmung von weiteren Zeugen
4.3Die Vernehmung des Beschuldigten
4.3.1 Die Vorbereitung der Erstvernehmung
4.3.2 Bedingungen für ein Geständnis
4.3.3 Die Rolle von Rechtsanwälten
4.3.4 Daten vom geständigen Täter
4.3.5 Daten vom nicht geständigen Beschuldigten
4.3.6 Daten zum subjektiven Tatbestand
VII. Zu wenig Daten
1. Grundsätzliche Überlegungen
2. Abwarten und hoffen
3. Fahnden in der Öffentlichkeit
4. Verdeckte Beweiserhebungen
4.1 Die Überwachung der Telekommunikation
4.2 Der Einsatz technischer Überwachungsgeräte
4.3 Der Einsatz von Informanten
4.4 Der Einsatz von Vertrauenspersonen
4.5 Der Einsatz nicht offen ermittelnder Polizeibeamter
4.6 Der Einsatz Verdeckter Ermittler
4.7 Kontrollierte Lieferungen
5. Die Provokation zu unüberlegten Handlungen
6. Besondere Fahndungsmaßnahmen
6.1 Zielfahndung
6.2 Schleppnetzfahndung
6.3 Rasterfahndung
3. Kapitel Das Ergebnis
I.Der strafprozessuale Beweis
1. Das Programm der Beweisführung
2.Schritte der Beweisführung
2.1 Die beweisformalistische Säuberung des Ausgangsmaterials
2.2 Die materielle Säuberung des Ausgangsmaterials
3. Der Indizienbeweis
3.1 Belastungsindizien
3.2 Entlastungsindizien
3.3 Von den Indizien zum Beweis
4. Alternativanklagen und Alternativbeweise
5. Beweiskraft und Beweiswert
II. Der Zweifel
1. Gegenstand des Zweifels
2. Überwundene Zweifel
III. Häufige Fehler beim kriminalistischen Arbeiten
1. Übersehen einer Straftat
2. Unkenntnis über die kriminalistischen Mittel
3. Fehlende oder fehlerhafte Daten
4. Mangelnde Ordnung und Sichtung von Daten
5. Unkenntnis über das anwendbare Recht
6. Unzulängliche Vernehmungen
7. Fehlende Übersicht über die Beweislage
8. Ermittlungsfehler
9. Ratlosigkeit über das weitere Vorgehen
IV. … und zum Schluss
Literatur- und Quellenverzeichnis
1. Kapitel Aufgabe und Mittel
1. Kapitel Aufgabe und Mittel
Inhaltsverzeichnis
I. Einleitung
II. Die kriminalistische Aufgabe
III. Die Mittel
1. Kapitel Aufgabe und Mittel› I. Einleitung
I. Einleitung
1. Über das kriminalistische Denken
Ziel des vorliegenden Buches ist es, Hinweise zu Überlegungen und Denkleistungen zu geben, welche nötig sind, um eine Straftat zu erkennen, eine vermeintliche bzw. tatsächliche Straftat aufzuklären oder nachzuweisen, dass keine Straftat begangen wurde. Die beschriebene Tätigkeit kann man als kriminalistisches Denken bezeichnen. Diese Art des Denkens verbessert die Arbeitsweise all derjenigen, die mit der Aufdeckung, Aufklärung und Verfolgung von Straftaten beruflich betraut sind, und das sind nicht nur Mitarbeitende der Strafverfolgungsbehörden und der Gerichte. Das kriminalistische Denken ist gewissermaßen die Basis kriminalistischen Arbeitens; man könnte auch sagen, das kriminalistische Denken ist die DNA des Kriminalisten.
Die Frage liegt nahe, ob die Methoden des kriminalistischen Denkens jenen ähnlich sind, welche Forscher im Bereich der Natur- oder Geisteswissenschaften anwenden, um Probleme zu analysieren und zu lösen. Die Frage ist einerseits zu bejahen: Systematisches Überlegen, das Denken in Hypothesen und die Methode des Verifizierens oder Falsifizierens können Kriminalisten durchaus von Mathematikern oder Sozialwissenschaftlern lernen und übernehmen, und sie sollten es auch tun. Die Frage muss anderseits aber in Teilbereichen auch verneint werden: Vor allem haben es Kriminalisten nicht mit Laborsituationen zu tun, sondern mit dem wirklichen Leben. Sie müssen deshalb oft rasch unter hohem Zeitdruck und bei bescheidener Faktenlage Entscheidungen treffen, welche sich dann nicht wieder rückgängig machen lassen. Kriminalisten können die Ergebnisse ihrer Ermittlungen auch nicht beliebig reproduzieren: Fehler, die etwa bei der Erstvernehmung des in flagranti erwischten Gewalttäters gemacht werden, lassen sich später überhaupt nicht oder nur mit erheblichen Schwierigkeiten beheben. Es lohnt sich deshalb, über das kriminalistische Denken und seine Besonderheiten nachzudenken.
Kriminalistisches Denken kann man lernen und üben. Forschungen haben gezeigt, dass die Anwendung gewisser Methoden bei der Lösung von kriminalistisch relevanten Sachverhalten zu deutlich besseren Ergebnissen führt. So ist empirisch belegt, dass Befrager, welche die Technik des Kognitiven Interviews anwenden, zu deutlich besseren Resultaten bei Vernehmungen kommen als diejenigen, die nicht nach dieser Methode vorgehen (allerdings brauchen sie dazu etwas mehr Zeit). Henriette Haas hat nachgewiesen, dass Kriminalisten, die mit der Technik des systematischen Beobachtens vertraut sind, signifikant bessere Lösungen von kriminalistischen Aufgaben produzieren als Personen, die diese Technik nicht kennen.[1]
Nicht nur die Auswertung von Personenbeweisen[2], sondern auch die von Sachbeweisen verspricht eher Erfolg, wenn Kriminalisten die neusten Techniken der Beweiserhebung kennen und sie in der richtigen Art und Reihenfolge Schritt für Schritt anwenden. Gerade die modernen, hochpräzisen und sehr zuverlässigen Beweiserhebungen (DNA-Analysen und andere Techniken der Spurenauswertung; Überwachungen der Telekommunikation; Auswertungen technischer Aufzeichnungsgeräte) führen in vielen Fällen zu klaren Beweisergebnissen, deren Beweiswert kaum mehr angezweifelt werden kann.
Ob man eine Lösung auf diesem Wege findet, ist allerdings nicht sicher. Schwierigkeiten entstehen dann, wenn man davon ausgehen muss, alle verfügbaren Beweise erhoben zu haben, ohne dass sich ein bestimmter Sachverhalt vollständig beweisen lässt. Immerhin: Die saubere und möglichst vollständige Anwendung der verschiedenen Techniken der Beweiserhebung ist auch in schwierigen Fällen eine notwendige Basis. Bisweilen sind allerdings speziellere und weiterführende Überlegungen notwendig. Wie dann vorzugehen ist, spüren erfolgreiche Kriminalisten intuitiv. Weil aber Intuition nicht lern- oder trainierbar ist, muss man sie manchmal herbeizwingen. Wie man das zustande bringt, kann sich zum Beispiel aus der Überlegung ergeben, wieso man einen schwierigen Fall auf überraschende Weise doch noch gelöst hat. Blieb der Erfolg anfangs versagt, weil man scheinbar harmlose Kleinigkeiten übersehen hat, oder hat man ungewöhnliche, nicht ins Bild passende Einzelheiten verdrängt, ohne ihnen besondere Beachtung zu schenken? Ging man von einer besonders raffinierten Täterschaft aus, weil der deliktische Schaden besonders hoch war, und übersah dabei naheliegende Versionen, weil nicht der Täter besonders professionell, sondern das Opfer besonders unbedarft war?
Читать дальше