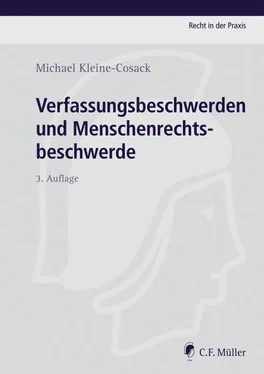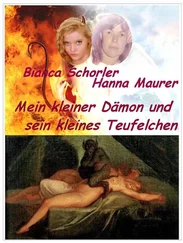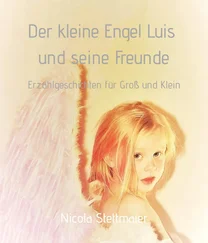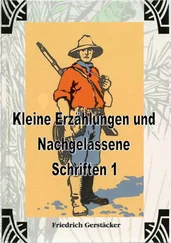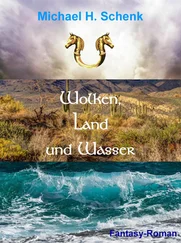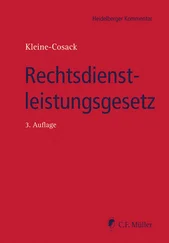ders. Menschenrechtsbeschwerde im Berufsrecht der freien Berufe, AnwBl. 2009, 326 ff.
Kunkel Aktuelle Rechtsprechung des EGMR zum Kindschaftsrecht unter besonderer Berücksichtigung der Interessenvertretung für Kinder, FPR 2012, 358
Meyer-Ladewig 50 Jahre Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte, NJW 2009, 3749
ders. Trivialbeschwerden in der Rechtsprechung des EGMR, NJW 2011, 3126
Nußberger Zur Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte zur Sicherung der Medienfreiheit in Europa, OstEuR 2012, Beil. zu Heft 1, 14 ff.
Satzger Der Einfluss der EMRK auf das deutsche Straf- und Strafprozessrecht, Grundlagen und wichtige Einzelprobleme, JURA 2009, 759 ff.
Stephan/Yamato Schwerpunktbereichsklausur- Internationales Öffentliches Recht: Individualbeschwerde wegen „Whistleblowing“, JuS 2012, 821
Walter Kirchliches Arbeitsrecht vor den Europäischen Gerichten, ZevKR 57, 233 (2012)
Wanitzek Die Rechtsprechung zum Recht der elterlichen Sorge und des Umgangs im Jahre 2011, FamRZ 2012, 1344
1. Kapitel Grundrechtsschutz im europäischen
und staatlichen Rechtsraum
Inhaltsverzeichnis
I. Öffnung der nationalen Rechtsordnungen
II. Überblick
III. Grundrechtsschutz auf staatlicher Ebene
IV. Grundrechtsschutz auf europäischer Ebene
V. Resume
1
Der Schutz von Grund- und Menschenrechten ist heutzutage nicht mehr auf den Nationalstaat und dessen Gerichte wie z.B. in Deutschland das Bundesverfassungsgericht beschränkt.[1]
[1]
Vgl. zum Folgenden den Überblick bei Bergmann Das BVerfG in Europa, in: Umbach u.a., BVerfGG, S. 129 ff. mit umfangreichen Literaturnachweisen.
1› I. Öffnung der nationalen Rechtsordnungen
I. Öffnung der nationalen Rechtsordnungen
2
Die Vielfalt der Gerichte zur Wahrung der Grund- und Menschenrechte hat ihre Ursache in dem Umstand, dass die nationalen Rechtsordnungen sich verstärkt international geöffnet haben. Die intensive Verflechtung der Staaten, die Globalisierung der Märkte wie auch die Übertragung von nationalen Zuständigkeiten an inter- bzw. supranationale Organisationen haben erhebliche, bisher nur unzureichend registrierte bzw. untersuchte Auswirkungen auf den Bestand wie auch die Geltungskraft der Grund- und Menschenrechte.
3
Ihr bisheriger Garant – der nationale Staat – bildet nur noch einen Teil eines größeren Ganzen. Seine Verfassung einschließlich der darin verbürgten Grundrechte haben ihre bisherige Suprematie und Reichweite verloren.[1] Sie können nicht durch eine wirklichkeitsfremde Wiederbelebung nationalstaatlicher Gedanken zurückgewonnen werden. Wer – wie manche deutsche Staatsrechtslehrer und unter ihrem Einfluss das BVerfG – im Hinblick auf die Europäische Union darauf wartet, dass die unterschiedlichsten Formen internationaler Zusammenarbeit Staatsqualität erlangen, und erst dann Grundrechte in diesen Bereichen einfordert, verharrt letztlich in einem abstrakten Modelldenken. Er verkennt die für potenzielle Beschwerdeführer entscheidende praktische, aber auch politische sowie rechtswissenschaftliche Frage, wie in einer durch Globalisierung und Abbau der Nationalstaaten gekennzeichneten Entwicklung den Grund- und Menschenrechten auch auf internationaler Ebene – letztlich im Rahmen einer sich bildenden Weltrechtsordnung – Geltung verschafft und damit der Funktionsverlust auf der nationalstaatlichen Ebene kompensiert werden kann.
[1]
Vgl. auch Hesse Grundzüge des Verfassungsrechts, 20. Aufl. 1995, Rn. 105 ff.
1› II. Überblick
4
Angesichts der auf inter- bzw. supranationale sowie nationale Gerichte verteilten Grundrechtsverantwortung stellt sich im Einzelfall für Beschwerdeführer die Frage, welche Gerichte mit der Rüge einer Verletzung von Grund- und Menschenrechten angerufen werden können. Die „Konkurrenz der Grundrechtswahrer“ innerhalb Deutschlands, in der Europäischen Union sowie mit dem EGMR wirft in der Praxis zahlreiche Probleme auf, deren Kenntnis für Beschwerdeführer unverzichtbar ist, sollen sich nicht Karlsruhe, Straßburg und Luxemburg als „Bermudadreieck“ erweisen.[1]
5
Auf staatlicher Ebene sind neben der meist mehrinstanzlichen Fachgerichtsbarkeit – z.B. der Amts- und Landgerichte, der Oberlandesgerichte und des BGH – in Deutschland speziell für die Sicherung des Verfassungsrechts und damit der Grundrechte das BVerfG und in vielen Bundesländern auch Landesverfassungsgerichte zuständig. Sie können z.T. mit Verfassungsbeschwerden nach der Erschöpfung des Rechtswegs angerufen werden.
6
Auf der internationalen Ebene ist für den Grundrechtsschutz am bedeutendsten der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg, der nach der Erschöpfung des Wegs zu den nationalen Gerichten einschließlich der (erfolglosen) Einlegung einer Verfassungsbeschwerde angerufen werden kann. Supranational kommt zwischenzeitlich auch dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) in Luxemburg eine erhebliche Bedeutung bei der Wahrung von Grund- und Menschenrechten zu. Er kann aber im Prinzip nicht von Bürgern direkt angerufen werden. Im Regelfall kommt er nur im Vorabentscheidungsverfahren der nationalen Gerichte zum Zuge, welche unter bestimmten Voraussetzungen zur Vorlage verpflichtet sind, was durch eine Verfassungsbeschwerde erzwungen werden kann.
[1]
Vgl. Kleine-Cosack Grund- und Menschenrechtsschutz im „Bermuda-Dreieck“, AnwBl. 2011, 501 ff.; vgl. auch Landau/Trésoret Menschenrechtsschutz im europäischen Mehrebenensystem, DVBl. 2012, 1329; Bogdandy u.a. Ein Rettungsschirm für europäische Grundrechte, ZaöRV 72, 45 (2012); Raue Die Verdrängung deutscher durch europäische Grundrechte im gewerblichen Rechtsschutz, GruR Int 2012, 402.
1› III. Grundrechtsschutz auf staatlicher Ebene
III. Grundrechtsschutz auf staatlicher Ebene
7
Da bisher nur in beschränktem Umfang von einem Schutz von Grund- und Menschenrechten auf der internationalen Ebene gesprochen werden kann, auch innerhalb Europas noch sichtbare Defizite in diesem Bereich bestehen, bestimmt sich der Schutz dieser Rechte vorrangig – noch – nach nationalem Recht und sind es primär staatliche Gerichte, welchen zu ihrer Durchsetzung berufen sind. Das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland enthält einen umfangreichen Katalog von Grundrechten und grundrechtsgleichen Rechten in den Art. 1–19, 20 Abs. 4, 33, 38, 101, 103 und 104 GG, zu deren Beachtung die Gerichte nach Art. 1 Abs. 3 GG verpflichtet sind. Gleiches gilt in unterschiedlichem Umfang für viele Landesverfassungen.
1› III› 1. Fachgerichte
8
In Deutschland sind zur Grundrechtswahrung vorrangig die Fachgerichte verpflichtet wie z.B. das AG, LG, OLG oder der BGH.
9
Es ist ein weit verbreiteter Irrtum bei Beschwerdeführern wie auch Rechtsanwälten, dass allein das BVerfG eine Grundrechtskompetenz besitze. Auch wenn selbstverständlich vermieden werden sollte, dass jeder Fachgerichtsprozess zu einem „Verfassungsprozess umfunktioniert“ wird, eine solche „Flucht in das Verfassungsrecht“ nicht selten anwaltliche Inkompetenz im einfachen Recht kompensieren soll, so muss schon wegen der Subsidiaritätsregelung des § 90 Abs. 2 BVerfGG mit dem Gebot der Rechtswegerschöpfung alles vor den allgemeinen Gerichten Mögliche getan werden, um eine Grundrechtsverletzung zu verhindern oder zu beseitigen, wenn auch verfassungsgerichtlich im Regelfall nicht gefordert wird, Grundrechtsrügen schon vor der Erhebung der Verfassungsbeschwerde geltend zu machen.[1] Die Verfassungsbeschwerde kann – auch aus Zeit- wie Kostengründen sowie wegen der geringen Erfolgsquote von unter 2 % – nur als ultima ratio in Betracht kommen. Dies entspricht ihrer Funktion als außerordentlichem Rechtsbehelf.
Читать дальше