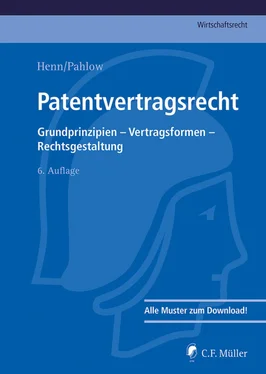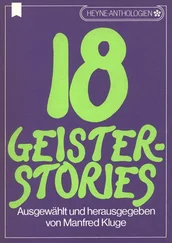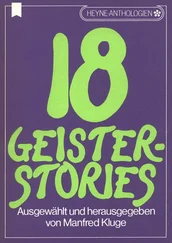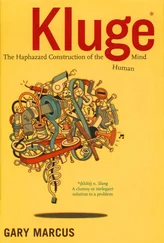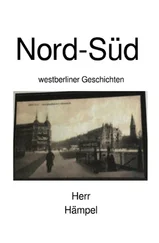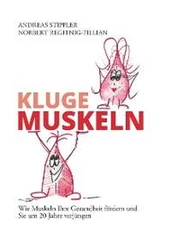28
Diese Abweichungen sind bei genauerem Hinsehen auch kein Verstoß oder Widerspruch mit den Grundsätzen des Bürgerlichen Rechts.[48] Schon die im Sachenrecht des BGB normierten beschränkt dinglichen Rechte sind keineswegs abschließend, sondern wurden von der Rechtsprechung um zusätzliche Rechte und Rechtsfiguren erweitert, wie etwa das Anwartschaftsrecht des Vorbehaltskäufers, besondere Treuhandformen oder das Sicherungseigentum. Das Sicherungseigentum steht sogar in einem gewissen Spannungsverhältnis zu den §§ 1204 ff. BGB, die ein besitzloses Pfandrecht an beweglichen Sachen gerade ausschließen. Eine Erweiterung der von den Parteien wählbaren Typen dinglicher oder verdinglichter Rechtspositionen im Wege der Rechtsfortbildung ist also durchaus zulässig.[49] Diese Möglichkeit der Rechtsfortbildung hat der BGH letztlich auch im Immaterialgüterrecht genutzt. Folgerichtig sieht es inzwischen sogar die Zivilrechtswissenschaft als möglich an, dass auch im gewerblichen Rechtsschutz das Prinzip fest ausgeprägter eigenständiger Rechte eine weitere Auflockerung erfährt.[50]
29
Das gilt auch für den Bereich der technischen Schutzrechte. Bei der ausschließlichen Patentlizenzin Form eines teilweise verdinglichten bzw. quasidinglichen Rechts handelt es sich nicht – wie bei den beschränkt dinglichen Rechten des BGB – um ein gesetzlich typisiertes Recht, sondern um eine richterrechtlich anerkannte Form eines absoluten Nutzungsrechts (§ 9 Rn. 39). Auch im Patentrecht können die §§ 9 ff. PatG, § 11 GebrMG als gesetzliche Inhaltsbestimmung des Schutzrechts angesehen werden. Der ausschließlichen Patentlizenz wird – in Anlehnung an die urheberrechtlichen Regelungen der §§ 31 Abs. 2 UrhG bzw. § 9 Abs. 2 VerlG – neben dem positiven Benutzungsrecht auch ein negatives Verbotsrecht zugewiesen.[51] Zudem wird die ausschließliche Lizenz als insolvenzfest anerkannt, wenn sie im Rahmen einer Verfügung eingeräumt wurde und für den Insolvenzverwalter keine Möglichkeit mehr bestand, sie aufgrund alleiniger Entscheidung wieder zurückzuverlangen.[52] Gemeinsam mit dem gesetzlich normierten Sukzessionsschutz (§ 15 Abs. 3 PatG; unten Rn. 37 ff.) erfüllt die ausschließliche Patentlizenz insoweit die elementaren Merkmale dinglicher Rechte.[53] Die Anwendung der Zweckübertragungslehre stellt sicher, dass die einzelnen Benutzungsarten präzise im Vertrag normiert und zur Grundläge möglicher Verfügungsgeschäfte gemacht werden; § 31 Abs. 5 UrhG begründet insoweit eine Spezifizierungslast für die Parteien ( Rn. 10). In diesem Rahmen können die Parteien Umfang und Rechtsqualität einer ausschließlichen Lizenz auch ohne gesetzlich typisierte Regelung durch den Lizenzvertrag mit dinglicher Wirkung vereinbaren.
30
Das BGB erlaubt in den §§ 932 ff. bzw. §§ 892, 893 BGB auch die Verfügung über Rechte an beweglichen oder unbeweglichen Sachen durch einen Nichtberechtigten. Ebenso kann in Ausnahmefällen an unkörperlichen Gegenständen, wie z.B. Forderungen, ein gutgläubiger Erwerb stattfinden, wenn der Veräußerer sich durch einen Rechtsschein, z.B. eine Urkunde (§ 405 BGB), legitimieren kann.[54] Das wirft die Frage auf, ob entsprechende Grundsätze auch in Immaterialgüterrechten gelten können. Die Möglichkeit eines gutgläubigen Erwerbs von Immaterialgüterrechten und den Rechten daran haben einige Autoren – teilweise unter entsprechender Anwendung von § 892 BGB – angenommen.[55]
31
Gegen einen gutgläubig, auch lastenfreien Erwerb sprechen aber die Vorschriften der § 15 Abs. 3 PatG, § 30 Abs. 5 MarkenG oder § 33 UrhG, die einen Bestandsschutz der Lizenz gegenüber Erwerbern des Schutzrechts wie auch späteren Lizenznehmern normieren. Darüber hinaus können aber auch die Registervorschriften keinen gutgläubigen Erwerbbegründen. Während einer Eintragung im Grundbuch konstitutive Bedeutung zukommt, weil der Erwerb von Grundstücksrechten ins Grundbuch eingetragen werden muss (vgl. § 873 Abs. 1 BGB),[56] besteht im Patentrecht diese Wirkung einer konstitutiven Registereintragung nicht. Sowohl für die Erteilung als auch den späteren Erwerb eines Patents ist die Eintragung keine Voraussetzung des Rechtserwerbs. Eine Eintragung im Patentregister hat demzufolge keinen Einfluss auf die materielle Rechtslage; sie wirkt weder rechtsbegründend noch rechtsvernichtend.[57] Ihre Legitimationswirkung beschränkt sich allein auf die Befugnis zur Führung von Rechtsstreitigkeiten.[58] Hat ein Patentinhaber sein Patent verkauft, ist der Erwerber aber noch nicht ins Register eingetragen worden, kann der noch eingetragene Veräußerer über das Patent keine wirksamen Rechtsgeschäfte vornehmen. Ein gutgläubiger Erwerb scheidet insoweit aus. Das schließt freilich eine Ermächtigung (§ 185 BGB)zu entsprechenden Verfügungen nicht aus.
3. Verpflichtungs- und Verfügungsgeschäfte, Trennungs- und Abstraktionsprinzip
32
Verpflichtungen und Verfügungen sind nach den Grundprinzipien des Privatrechts nicht nur zu trennen, sondern auch in ihrer Wirksamkeit voneinander unabhängig. Im deutschen Bürgerlichen Recht gilt das Abstraktionsprinzip, wonach das Verfügungsgeschäft vom Bestehen und von der Wirksamkeit des zugrunde liegenden Verpflichtungs- und Kausalgeschäfts unabhängig ist.[59] Da § 15 PatG eine beschränkte und unbeschränkte „Übertragung“ und damit einen Verfügungstatbestand vorsieht und z.B. auch ausschließliche Lizenzen nach h.A. die Einräumung eines quasidinglichen Nutzungsrecht ermöglichen (oben Rn. 29), muss die Frage beantwortet werden, ob und inwieweit das Abstraktionsprinzip auch für das Patentvertragsrecht Geltung beanspruchen kann.
33
Das Urhebervertragsrechtordnet in mehreren Bestimmungen eine rechtliche Verknüpfung von Verpflichtungs- und Verfügungsgeschäft an. Nach § 9 Abs. 1, 2. Alt. VerlG erlischt das ausschließliche Nutzungsrecht des Verlegers (Verlagsrecht) mit der Beendigung des Vertragsverhältnisses. Nach § 40 Abs. 3 UrhG wird die Verfügung über Rechte an künftigen, noch nicht abgelieferten Werken unwirksam, wenn der zugrunde liegende Vertrag endet. Schließlich betrifft der Rückruf nicht nur das Verpflichtungsgeschäft, sondern bewirkt zugleich das Erlöschen des Nutzungsrechts durch Heimfall (§§ 41 Abs. 5, 42 Abs. 5 UrhG).
34
Die Literaturist in dieser Frage zerstritten. Einige[60] sehen in diesen Regelungen im Zuge eines Umkehrschlusses eine Ausnahme des im Übrigen bestehenden Abstraktionsgrundsatzes; andere[61] begründen über diese Regelung gerade die grundsätzliche Geltung eines Kausalitätsprinzips. Dieser letzteren Auffassung hat sich auch der BGHangeschlossen. Im Urheberrecht wie auch im gewerblichen Rechtsschutz sei davon auszugehen, dass das dem Lizenznehmer eingeräumte Recht mit der Beendigung des Lizenzvertrags an den Lizenzgeber zurückfällt und dementsprechend die Fortsetzung der Benutzung eine Schutzrechtsverletzung darstellt (vgl. § 15 Abs. 2 S. 2 PatG). Umfang und Inhalt von Lizenzen richten sich nach dem Lizenzvertrag und den darin vereinbarten Nutzungsarten. Die Verfügung erfahre ihren Gegenstand und dessen Umfang also erst aus dem Lizenzvertrag und ist mit diesen Vereinbarungen im Lizenzvertrag dementsprechend kausal verbunden.[62]
35
Die Rechtsprechung erkennt damit die Theorie abgeleiteter, konstitutiver oder gebundener Rechtsübertragungenan, die auch den Besonderheiten des Patentlizenzvertragsrechts unter Berücksichtigung der Interessen der Parteien am ehesten gerecht wird.[63] Diese Grundsätze gelten nicht nur im Zeitpunkt, sondern auch für den Zeitraum nach der Verfügung. Das steht auch mit den urheber- und verlagsrechtlichen Ausnahmeregelungen im Einklang. Da die Beendigung des Verlagsvertrages das Nutzungsrecht nach § 9 Abs. 1, 2. Alt. VerlG bereits zu Fall bringt, muss das erst recht auch für den Fall des anfänglich unwirksamen Vertrages gelten. Entsprechend der Zweckbindung im Verlagsrecht, die aus dem Verlagsvertrag abzuleiten ist, sei auch bei anderen Verträgen anzunehmen, „dass Gültigkeit und Bestand des Vertragsverhältnisses sowohl für das Entstehen wie für das Erlöschen der abgeleiteten Rechte entscheidend sind“.[64] Der BGH stützt sich dazu auch auf die im Immaterialgüterrecht anerkannte Zweckübertragungslehre.[65] Eine kausale Verknüpfung von Verpflichtungs- und Verfügungsgeschäft entspricht weit mehr der generell im Immaterialgüterrecht geltenden Besonderheit, dass der Inhalt der Lizenz im Hinblick auf die begrenzten Gestaltungsmöglichkeiten und das Fehlen vorgeformter gesetzlicher Typen erst durch den schuldrechtlichen Vertrag seine nähere Bestimmung und Ausformung erfährt.[66] Bei der ausschließlichen Patentlizenzin Form eines teilweise verdinglichten bzw. quasidinglichen Rechts handelt es sich also nicht – wie bei den beschränkt dinglichen Rechten des BGB – um ein gesetzlich typisiertes Recht, sondern um eine richterrechtlich anerkannte Form eines absoluten Nutzungsrechts ( Rn. 29). Aufgrund der dogmatischen Verwandtschaft mit dem Verlagsrecht als „Urform“ immaterieller Verwertungsrechte folgt aus der entsprechenden Anwendung des § 9 Abs. 1, 2. Alt. VerlG, dass das dem Lizenznehmer eingeräumte Recht mit der Beendigung des Lizenzvertrages an den Lizenzgeber zurückfällt.[67] Eine Fortsetzung der Benutzung trotz Beendigung des Vertrages stellt folgerichtig nicht nur eine Vertrags-, sondern auch eine Schutzrechtsverletzung dar (vgl. § 15 Abs. 2 S. 2 PatG).
Читать дальше