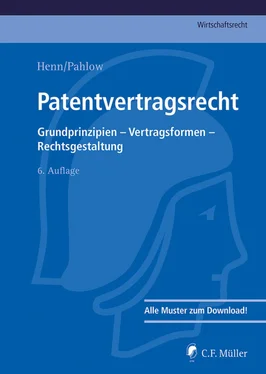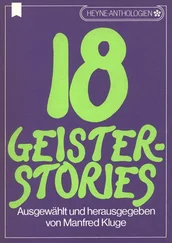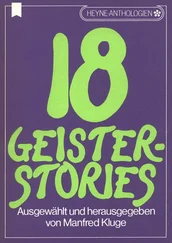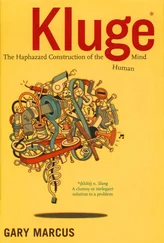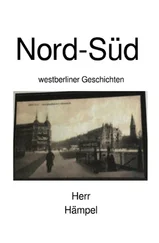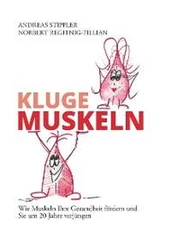11
Daraus folgt freilich keine Einschränkung der Vertragsfreiheit. Der Zweckübertragungsgrundsatz überlässt es grundsätzlich den Vertragsschließenden, wie und wie weitreichend sie sich verpflichten; auch eine Vereinbarung, die außer Acht lässt, wie unter größtmöglicher Berücksichtigung der Interessen des Erfinders an dem Schutzrecht eine sinnvolle Geschäftstätigkeit des zu Begünstigenden erreicht werden kann, ist danach ohne weiteres möglich. Der anerkannte Erfahrungssatz kann daher nur eingreifen, wenn der Tatrichter sich nicht von einem derartigen Vertragsinhalt überzeugen kann; er führt nur im Zweifel dazu, dass eine Verpflichtung zur Einräumung von Rechten an einem Patent oder an einer Patentanmeldung lediglich in dem Umfang angenommen werden kann, indem ihre Verschaffung den feststellbaren Umständen nach unabdingbar ist.[12]
3. Risiko- und Wagnisgeschäft?
12
Verträgen über gewerbliche Schutzrechte, insbesondere Lizenzverträgen, wurde in der Vergangenheit häufig ein besonderer Risiko- oder „Wagnischarakter“zugeschrieben. Da weder Erlangung oder Bestand eines technischen Schutzrechts während der Vertragslaufzeit mit Sicherheit vorausgesagt noch die wirtschaftliche Verwertbarkeit im Voraus abgeschätzt werden können, haben u.a. bei Lizenzverträgen andere Haftungsmaßstäbe zu gelten.[13] Allerdings ist hier zu differenzieren.
13
Die Gefahr eines „gewissen Wagnisses“ oder „Risikos“ kann zunächst dann keinen Einfluss auf die Haftung haben, wenn damit das Risiko der wirtschaftlichen Verwertbarkeitbeschrieben wird, für die der Veräußerer oder Lizenzgeber ohnehin nicht einzustehen hat.[14] Zwischen den wirtschaftlichen Erwartungen und dem Bestehen von Sach- und Rechtsmängeln ist daher streng zu unterscheiden. Der Wagnischarakter patentbezogener Verträge beruht daher vor allem auf der rechtlichen Ungewissheit, ob sich technische Schutzrechte für die Dauer des Vertrages als beständig erweisen.
14
Wollte man Verträge über technische Schutzrechte aber tatsächlich für risikoreicher als andere Verträge halten, dann wäre es nur konsequent, diese Verträge als aleatorisch einzuordnen, vergleichbar mit einer Wette oder einem Börsentermingeschäft. Damit wird die außerordentliche Gewinnchance bzw. das Risiko eines Verlusts selbst Gegenstand des Vertrages. Im Falle eines Verkaufs einer Patentanmeldung hat der BGH dies tatsächlich angenommen, für Lizenzverträge an erteilten Patenten dagegen ausdrücklich abgelehnt.[15] Eine Einordnung von Patentverträgen als aleatorische Geschäftewürde voraussetzen, dass nach dem Willen der Vertragsparteien eine Gewinnchance realisiert werden soll. Das trifft aber allenfalls beim spekulativen Erwerb von Patenten und Schutzrechtslizenzen u.a. durch Fondsgesellschaften zu. In der Regel werden Patenterwerber bzw. Lizenznehmer das Schutzrecht selbst nutzen und gerade nicht spekulieren wollen.[16] Und selbst das Risiko einer erfolgreichen Nichtigkeitsklage macht gewerbliche Schutzrechte noch nicht zum Spekulationsobjekt. Eine Sonderform eines „gewagten Geschäfts“ außerhalb von Spiel und Wette ist dem BGB dagegen fremd.
15
Gegen einen besonderen „Wagnischarakter“ mit besonderen Rechtsfolgen sprechen auch historische Erwägungen. Die Annahme eines „gewagten Charakters“ ist aus einer ergänzenden Vertragsauslegung hervorgegangen, um der Garantiehaftungdes Veräußerers im Rahmen des § 437 BGB a.F.bzw. um die Folgen einer Nichtigkeit des Vertrages bei anfänglicher Unmöglichkeit gem. § 306 BGB a.F.auszuweichen, die den Veräußerer bei einer nachvertraglichen Nichtigkeitserklärung des Schutzrechts mit enormen Risiken belastet hätte. Unter Hinweis auf diese Risiken wollte man sich von einer als starr empfundenen Regelung befreien und stattdessen eine flexiblere Lösung finden, um die Haftungsrisiken des Veräußerers und Lizenzgebers zu begrenzen; dies waren nach überwiegender Meinung die Grundsätze über die Störung der Geschäftsgrundlage. Da § 437 BGB a.F. der Schuldrechtsreform 2002 zum Opfer gefallen und auch § 306 BGB a.F. durch § 311a BGB ersetzt worden ist, sollte man zugleich die Zwitterform des sog. gewagten Geschäfts damit begraben.[17]
16
Wer einen „gewagten Charakter“ eines Geschäfts als Grund dafür heranzieht, die Zuordnung dieses Rechtsgeschäfts in das Vertragsregime des BGB abzulehnen, übersieht zudem ein wesentliches Prinzip unserer Privatrechtsordnung. Der Schuldvertrag und seine Regelung finden ihre materielle Legitimation im privatautonomen Ausgleich der Einzelinteressen, d.h. in der Vermutung, dass jede der Parteien den Vertrag deshalb als bindend akzeptiert, weil und soweit die eigenen Interessen mit denen der Gegenseite in ein ausgewogenes Verhältnis gebracht worden sind und jeder der Beteiligten sich von der Durchführung des Vertrages eine Verbesserung der eigenen wirtschaftlichen Situation verspricht.[18] Dann ist es aber in erster Linie Aufgabe der Parteien, mögliche Risiken über die Ausgestaltung der Leistungspflichten wie z.B. Lizenzgebühren, die Vereinbarung von Vertragsstrafen u.Ä. im Wege der Vertragsverhandlungen aufzufangen. Es besteht keine Notwendigkeit, über abstrakte Risikobewertungen diese privatautonome Gestaltungsmacht aufzuheben.
4. Absichtserklärungen, Vorverträge, Optionsrechte
17
a) Wirtschaftlich bedeutende und komplexe Vertragswerke können durch eine Absichtserklärung (sog. Letter of Intent)eingeleitet werden, mit der dem Empfänger die Bereitschaft erklärt wird, in ernste Vertragsverhandlungen über einen Vertragsabschluss eintreten zu wollen.[19] Typisch ist, dass der „Letter of Intent“ nicht i.S. e. Willenserklärung oder eines Vertragsangebotes in Bezug auf den späteren Hauptvertrag rechtlich verbindlich sein soll („no binding clause“), sondern nur die Bereitschaft bekundet wird, über den geplanten Vertrag unter gewissen Bedingungen in ernsthafte Verhandlungen eintreten zu wollen. Die insoweit bestehende Unverbindlichkeit des „Letter of Intent“ kommt häufig darin zum Ausdruck, dass er eine Auflistung noch zu klärender Punkte enthält.[20] Möglich bleibt aber eine Haftung für die Verletzung von Schutz- und Informationspflichten nach §§ 311 Abs. 2, 241 Abs. 2, 280 Abs. 1 BGB.[21]
18
Abzugrenzen sind diese unverbindlichen Absichtserklärungen von verbindlichen Vorfeldvereinbarungen, etwa über die Kostentragung bei Vorleistungen, Exklusivbindungen und Informationspflichten, oder Teilen hiervon. Im Einzelfall kann ein von dem Empfänger akzeptierter „Letter of Intent“ bei zutreffender rechtlicher Würdigung daher durchaus als verbindlicher Vorvertrag oder sogar als Hauptvertrag aufzufassen sein.[22] Darüber hinaus können die im „Letter of Intent“ getroffenen Erklärungen auch für die Auslegung eines später geschlossenen Hauptvertrages von Bedeutung sein (oben Rn. 5). Nach Ansicht des BGH darf sich die Auslegung eines Vertrages nicht in der Auslegung seines Wortsinns erschöpfen, wenn in ihm auf mündliche Vorgespräche, etwa über den Begriff „vereinbarungsgemäß“ Bezug genommen wird. In diesem Fall kann auch ein „Letter of Intent“ zur Erläuterung oder Ergänzung der Beweggründe einer später getroffenen Vereinbarung herangezogen werden.[23]
19
b) Mit einem Vorvertragverpflichten sich die Vertragspartner, einen anderen schuldrechtlichen Vertrag (Hauptvertrag) abzuschließen.[24] Durch einen Vorvertrag wird demnach ein vertraglicher Kontrahierungszwangbegründet.[25] Der Abschluss eines Vorvertrages kommt etwa in Betracht, wenn bestimmte Fragen einvernehmlich noch offengelassen werden, etwa weil ihre Beantwortung von weiteren, derzeit noch nicht absehbaren Entwicklungen und den weiteren Verhandlungen abhängt,[26] gleichwohl aber nach dem Willen der Parteien (§§ 133, 157 BGB) die Verpflichtung begründet werden soll, einen Hauptvertrag zu schließen. Der Vorvertrag stellt einen eigenständigen Vertrag dar, der alle Voraussetzungen eines Vertrages erfüllen muss und vom Hauptvertrag zu unterscheiden ist. § 154 BGB gilt auch für Vorverträge. Diese Vermutung ist im Zweifel anzunehmen, wenn festgestellt werden kann, dass die Parteien ungeachtet der fehlenden Einigungin einer oder mehreren offenen Fragen bereits eine vorvertragliche Bindung eingehen wollten.[27] Der Vorvertrag muss dazu verpflichten, einen Hauptvertrag abzuschließen. Dafür genügt es, wenn eine Partei die Verpflichtung übernimmt, unter den im Vorvertrag genannten Voraussetzungen ein entsprechendes Hauptvertragsangebot der anderen Seite anzunehmen.[28]
Читать дальше