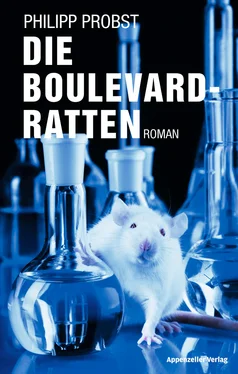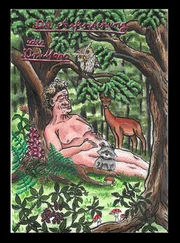1 ...7 8 9 11 12 13 ...22 Dass er nun ausgerechnet bei einem Einsatz als People-Fotograf in eine lebensbedrohliche Situation geraten war, kam Joël erbärmlich vor. Er war kein Paparazzo, wollte keiner sein, war aber doch einer. Die Sache war entweder ein Witz, oder er hatte etwas fotografiert, was er definitiv nicht hätte fotografieren sollen. Warum er wegen eines Bundesrats, für den sich ausserhalb der Schweiz kein Schwein und selbst in der Schweiz nur wenige interessierten, von einem Sessellift gekippt worden war, konnte er sich beim besten Willen nicht erklären. Weil die Kamera weg war, konnte er nur darauf hoffen, dass die Aufnahmen mit dem Handy noch verwertbar waren. Vorausgesetzt, das Handy beziehungsweise der Speicher würde die kommende Nacht überleben. Und er selbst auch.
In einem Survival-Buch hatte er einmal gelesen, wie man bei Minustemperaturen überleben kann. Ein Arbeiter war ein ganzes Wochenende in einem Tiefkühllager eingesperrt gewesen. Erst hatte er versucht, die Türe gewaltsam zu öffnen. Dann wollte er die Kühlung an der Decke beschädigen. Dazu hatte er sich mit den Paletten und Kartonschachteln Türme gebaut, war hinaufgeklettert und hatte gegen die Leitungen gehämmert. Alles half nichts. Er war müde, schlief fast ein und begann zu frieren. Dass er erst jetzt fror, rettete ihn: Statt zu schlafen, schleppte er das ganze Wochenende Kisten. Bis seine Kollegen am Montag ins Lager kamen.
Und auch aus den Himalaya-Büchern wusste Joël, dass Schlafen oder Sitzenbleiben den Tod bedeutete. Also musste er sich trotz seines gebrochenen Beins bewegen, am besten dorthin, wo er am ehesten gerettet würde.
Doch zuerst versuchte er, sein Bein mit einem Skistock und den Skiriemchen zu schienen. Das gelang nicht, da war die Theorie zu weit von der Praxis entfernt: Der Skistock war viel zu lang, die Riemchen waren zu kurz, und Joël spürte wegen der Kälte seine Hände nicht mehr. Er beschloss, mit den Skistöcken und mit Hilfe seines gesunden linken Fusses mitsamt dem dazugehörenden Ski dorthin zu robben, wo er die Piste vermutete. Denn wenn er auf einer Piste wäre, stiege die Chance, von einem Pisten-Bully-Fahrer entdeckt zu werden. Diese würden die Pisten entweder spätnachts oder frühmorgens präparieren …
Oder sollte er gleich zur Hütte, in der er den Bundesrat und die unbekannte Dame fotografiert hatte, auf einem Bein hinunterfahren? Aber was, wenn dort unten niemand mehr war, keiner dort übernachtete und alle Fenster, die er hätte einschlagen können, mit Läden verschlossen waren? Dieses Risiko wollte er nicht eingehen, denn er kannte das Skigebiet ziemlich gut. Dort unten steckte er noch tiefer im Schlamassel. Wenn er aber die Bergstation des Sessellifts erreichen würde, könnte er auf der anderen Seite des Passes hinunterfahren, notfalls bis ins Tal.
Dies schien Joël die beste Variante zu sein.
Er begann, sich kriechend durch den Schnee zu kämpfen. Doch er konnte machen, was er wollte – das Bein schmerzte in jeder Stellung höllisch. Also versuchte er aufzustehen. Das funktionierte zwar, doch an Fortbewegung war nicht zu denken. Der Neuschnee war zu tief, er hüpfte, kam aber keinen Zentimeter vorwärts.
Er liess sich wieder fallen und robbte weiter.
Das klappte einigermassen. Doch bereits nach wenigen Metern ging ihm die Puste aus. Er sackte zusammen und atmete schwer. Weiter zu kriechen, bedurfte schon einiger Überwindung.
Nach der zweiten Pause wuchsen Anstrengung und Frustration. Vor allem hatte er nicht die geringste Ahnung, wo er war und wohin er sich bewegte. Vielleicht robbte er einfach im Kreis herum. Auch das wusste er aus einem Buch: In einer Schneewüste verliert auch der beste Bergsteiger den Orientierungssinn.
Die dritte Pause dauerte sehr viel länger als die erste und die zweite. In der vierten Pause kam ihm der Gedanke, einfach liegen zu bleiben und zu schlafen.
«Ich muss diese verdammte Piste erreichen», rief er laut.
Er schrie. Das Echo war beeindruckend. Ansonsten passierte nichts.
Joël schaute auf die Uhr. Die weisse Swatch zeigte kurz vor 20 Uhr. Wo bleiben die verdammten Pistenfahrzeuge?, fragte er sich.
Er robbte weiter.
Er schwitzte, fror aber trotzdem. Nun spürte er auch, dass sein teurer Skianzug nach diesen langen Stunden im Schnee nicht mehr wasserdicht war. Es schneite immer noch, es windete immer noch, es war tiefste Nacht, und es wurde immer kälter. Joël bewegte sich schneller, geriet dadurch aber auch schneller ausser Atem.
Plötzlich glaubte er, sein Handy klingeln zu hören. Er wollte danach greifen, verhedderte sich aber in den Taschen, weil er in den Händen kein Gefühl mehr hatte. Und als er es schliesslich geschafft hatte, war das iPhone verstummt. Der Bildschirm war schwarz und blieb schwarz.
Joël verstaute das Gerät wieder in der Jackeninnentasche, obwohl auch diese feucht war. Das Innenfutter war nass, alle Taschen waren nass, vermutlich waren sogar die Skischuhe innen nass, aber das spürte er nicht, weil er seine Füsse, wie seine Hände, schon länger nicht mehr spürte.
Er ruhte sich aus. Er schloss die Augen.
Nur ganz kurz, sagte er sich.
GUTSHOF IM STÄDELI, ENGELBURG BEI ST. GALLEN
Das Essen, Gänsebraten mit Rotkohl und Knödeln, war deftig deutsch, aber lecker. Der Wein dazu, drei Flaschen Château Pétrus, war köstlich. Zu köstlich eigentlich für das Mahl, wie Myrta fand. Der Wein musste enorm teuer gewesen sein. Das schloss Myrta nicht nur, weil ihr «Château Pétrus» als Edelweingut bekannt war und ihr der Tropfen wirklich mundete, sondern weil ihr Vater ein Brimborium darum machte. Er bekam von ihr jedes Jahr den «Kleinen Johnson» zu Weihnachten geschenkt, die Weinbibel für den Amateur. Natürlich stand in der Tennemann’schen Bibliothek auch der «Grosse Johnson», sauber eingereiht zwischen anderen zahlreichen Weinbüchern. Myrta konnte als einzige der Familie mit ihrem Vater eine einigermassen fundierte Diskussion über Wein führen. Mama Eva disqualifizierte sich nicht ohne Stolz, indem sie in Gourmetlokalen gerne zu einem exorbitant teuren Essen und einem noch teureren Wein eine Cola light bestellte. Das Wein-Gen hatte sich auch nicht auf Myrtas Bruder Leon, geschweige denn auf ihre Schwester Leandra übertragen. Am allerschlechtesten schnitt in Myrtas Weinkennerrangliste Leons Frau Christa ab, zwar die einzig waschechte Schweizerin der Familie, aber ein Trampel sondergleichen. Myrta war sich bewusst, dass ihr Urteil nicht gerecht war, aber sie musste die erfolgreiche TV-Ärztin ja nicht mögen, nur weil sie die Frau ihres Bruders war. Christa war einfach dämlich und blöd und peinlich. Und zu dick. Jawohl, das auch noch.
Nachdem Eva und Christa das Dessert, Ananas mit einer undefinierbaren Crème, serviert hatten, fragte Eva plötzlich: «Sag mal, Myrta, wie geht es eigentlich deinem Freund Bernd?»
Das war die Frage aller Fragen, und Myrta kam es vor, als hingen selbst die Kinder ihres Bruders nun an ihren Lippen.
«Gut», antwortete Myrta knapp.
«Schön. Kommt er mal wieder in die Schweiz?»
«Er hat viel zu tun.»
«Natürlich», sagte darauf Eva Tennemann und fügte sofort hinzu: «Erzähl uns etwas über Martin, oder Lucky Luke, so hast du ihn doch früher immer genannt.»
«Mama, über Martin wisst ihr wahrscheinlich mehr als ich.»
«Er ist ein stattlicher Pferdezüchter und Pferdehändler geworden», warf Paul Tennemann ein.
«Er hat nicht nur eine Pferdepension?», fragte Myrta nach.
«Nein, er hat noch eine Zucht», antwortete Paul. «Er ist wirklich erfolgreich.»
“Oh…», machte Myrta nur. Martin hatte nichts davon erwähnt. Warum nicht?, fragte sie sich.
«Wie war denn dein Spaziergang mit Lucky Luke heute?», fragte Leandra plötzlich. «Der dauerte ja ewig.»
«Leandra, bitte!», antwortete Myrta.
«Dein Spaziergang dauerte wirklich lange», meinte auch Leon.
Читать дальше