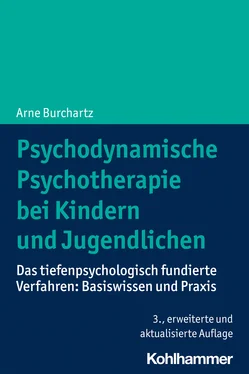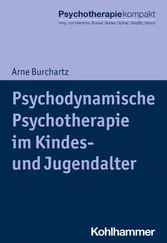3.7 Die Auffassung von Regression
Zeit unseres Lebens verläuft die Entwicklung nicht linear. Neue Entwicklungsaufgaben, neue Erfahrungen oder Statusübergänge rufen nicht allein Neugier und Kreativität auf den Plan, sondern auch Angst. Wir neigen dazu, vor angsterregenden Vorgängen und Phantasien zurückzuweichen (regressus, lat.: rückläufige Bewegung). Wir suchen damit einen sicheren inneren Ort auf, der uns vertraut ist, an dem wir uns auskennen, und nehmen alle Verhaltensweisen an, die zu dieser früheren Stufe der Entwicklung gehören.
Sehr augenfällig kann sich eine solche Regression zeigen, wenn ein Kind die Geburt eines Geschwisterkindes erlebt. Plötzlich verlangt der Vierjährige wieder nach einer Flasche, verfällt in Babysprache, verliert Alltagsfähigkeiten, wie etwa das Anziehen oder bestimmte Bewegungskoordinationen, kann nicht allein sein oder nässt wieder ein.
Auch die regressive Bewegung ist kein pathologisches Phänomen, sie kann ausgesprochen entwicklungsfördernd sein, indem sich die Psyche vor Überforderung schützt und gleichsam Kraft tankt für einen nächsten großen Schritt. So werden z. B. Kinder besonders dann krank, wenn sie einen Schutz- und Schonraum brauchen, bevor sie eine neue Entwicklungsaufgabe in Angriff nehmen können (vgl. Hopf 2007). Überhaupt ist psychische Entwicklung ein Schwanken auf einem Kontinuitätsspektrum von Regression und Progression, wobei die beiden Pole spiralförmig immer wieder durchlaufen werden. Problematisch wird eine einseitige Regression dann, wenn ein Mensch dauerhaft in ihr verharrt, sich in gewissen Aspekten auf eine Entwicklungsstufe fixiert und er damit dauerhaft die Angst vor progressiven Tendenzen zu binden versucht.
Der oben erwähnte vierjährige Junge hat es mit einem heftigen inneren Konflikt zu tun bekommen: Einerseits empfindet er Wut und Enttäuschung, dass er nun nicht mehr der allein Wichtige für seine Eltern sein kann, Rivalitätsgefühle zu dem Neugeborenen tauchen auf, nachdem nun feststeht, dass dieser kleine Schreihals nicht nur dauerhaft bleibt, sondern offenbar den Eltern, die dem Säugling natürlich besondere Aufmerksamkeit widmen müssen, auch besonders wichtig ist. Die Angst vor dem Verlust der elterlichen Liebe breitet sich in seinem inneren Erleben aus. Andererseits liebt er auch seine Eltern und möchte keinesfalls die Sicherheit und Geborgenheit verlieren, die sie ihm schenken. Als Lösung dieses Konflikts beginnt er sich zu einem braven, angepassten und hilfsbereiten kleinen Ritter zu entwickeln; unter seinem Altruismus werden seine aggressiven und feindseligen Regungen sorgfältig verborgen und verdrängt, freilich um den Preis der Symptombildung: Er klebt an der Mutter, kann nicht mehr in den Kindergarten gehen, schränkt sich also in seinen Ich-Fähigkeiten ein, dazu nistet sich eine Enuresis nocturna als dauerhaftes Symptom ein. Bei seiner Einschulung mit sieben Jahren hat sich an diesen Problemen nichts verändert, nur dass sie jetzt, unter dem Druck der sozialen Erwartungen, zu kaum mehr handhabbaren Schwierigkeiten führen. In der Entwicklung gesunder und ins Ich integrierter aggressiver Kräfte ist der Junge regrediert und fixiert auf eine frühere Entwicklungsstufe.
Wenn Kinder oder Jugendliche zur Therapie vorgestellt werden, beobachten wir immer solche Formen mehr oder weniger pathologischer Regression. Nun stellt die Therapie selbst auch ein regressives Milieu her: Indem sich Kinder und Jugendliche in einem geschützten Rahmen frei spielend, assoziierend oder kreativ gestaltend äußern können, finden sie sich in einer Situation wieder, welche zunächst von dem Druck, den die äußere Realität mit ihren Forderungen und Erwartungen erzeugt, entlastet. Dieses therapeutische Milieu fördert also per se schon regressive Tendenzen, resultierend verstärkt sich die Bereitschaft zu Übertragungen. Auch die Übertragung ist ein regressives Phänomen, insofern sie die Wahrnehmung des Therapeuten nach den inneren Repräsentanzen des Patienten organisiert und eben nur sehr eingeschränkt nach der Realität seiner Persönlichkeit. In der Analytischen Psychotherapie machen wir uns die Regression zunutze, indem wir mit dem Patienten an die früheren Fixationspunkte der Entwicklung zurückgehen und die dort entstandenen Konflikte reaktivieren und durcharbeiten. Hier liegt ein wesentlicher Unterschied zur Tiefenpsychologisch fundierten Psychotherapie: In dieser Behandlungsform grenzen wir durch ein spezifisches Setting regressive Prozesse ein, um einen aktuellen Konflikt realitätsnah zu bearbeiten, ohne jedoch die regressiven Bewegungen außer Acht zu lassen. Damit sei hier vorweggenommen, was weiter unten genauer ausgeführt wird: Die TfP eignet sich für solche Patienten, deren Leiden ohne eine tiefergehende therapeutische Regression gelindert oder geheilt werden kann oder bei denen aus bestimmten Gründen eine solche nicht angezeigt ist.
3.8 Das Ziel, Heilung durch Einsicht und Sinngebung in einer therapeutischen Beziehungsmatrix zu erreichen
Allen psychoanalytisch begründeten Verfahren ist gemeinsam, dass sie die Beziehung zwischen Patient und Therapeut als Kern der therapeutischen Wirkung auffassen. Neben der angeborenen psychischen Konstitution (etwa der Reizempfindlichkeit) ist die Beziehung zwischen Kind, Eltern, Geschwistern und weiterem sozialem Umfeld entscheidend für die Ausprägung der seelischen Entwicklung des Menschen und seiner adaptiven Möglichkeiten. Aufgrund seiner Plastizität bilden sich im menschlichen Gehirn insbesondere durch frühe Beziehungserfahrungen individuell geprägte Strukturen heraus. Umgekehrt können psychische Fehlentwicklungen auch durch eine spezifische neue, nicht alltägliche Beziehungserfahrung korrigiert werden. Dies umso mehr, da sich Kinder und Jugendliche noch in einer rasanten Entwicklung befinden und sie für solche korrigierenden Beziehungserfahrungen meist sehr empfänglich sind.
Damit kommt der therapeutischen Beziehungsgestaltung eine zentrale Stellung in der Therapie zu. In der TfP arbeiten wir näher an der Realbeziehung bzw. an den bewusstseinsfähigen Anteilen der szenischen Gestaltung unter Beachtung der Übertragung und Gegenübertragung, während die analytische Therapie die Übertragung in ihrer Intensität fördert und als zentrales therapeutisches Agens nutzt.
Von Beginn an formulierten psychoanalytische Verfahren den Anspruch, durch wachsende Einsicht des Patienten in seine Innenwelt und ihre dynamischen Vorgänge eine Integration der abgewehrten Inhalte ins Ich zu erreichen und damit die Symptombildung überflüssig zu machen. Freud: »Wo Es war soll Ich werden« (Freud 1933a, S. 86). Dieses Verfahren stößt, wie gezeigt, auf das Problem des Widerstandes. Die Funktion der neurotischen Symptombildung ist u. a., die abgewehrten Inhalte vom Bewusstsein fernzuhalten und damit Angst zu binden. Deshalb geht die fortschreitende Einsicht mit Entbindung von Angst einher, die wiederum abgewehrt werden muss – etwa durch die Intensivierung der Übertragung, die so gesehen die Funktion des Widerstandes annimmt, weil sie eine direkte Wunscherfüllung anstrebt anstatt einer psychischen Integration. (Dass anders das wesentliche Konfliktmaterial meist gar nicht in die Beziehung kommt, darauf hat – wie gezeigt – v. a. Ferenczi hingewiesen.) Eine andere Form des Widerstandes ist die Isolierung des Affekts von dem ursprünglichen Konflikt. Es entsteht dann eine theoretische Einsicht, die aber keine Veränderungen nach sich zieht. Deshalb gehört zu einer Einsicht im therapeutischen Sinne immer auch die zugehörige emotionale Erfahrung. Eine solche ist nur im Rahmen eines Beziehungsgeschehens möglich, das die Ängste aufnimmt, hält, versteht und ich-verträglich bearbeitet. Die »holding function« des Therapeuten bzw. seine Fähigkeit, sich als Container im Bion’schen Sinn zur Verfügung zu stellen (Bion 1959), ist in einer TfP deshalb unverzichtbare Grundlage.
Читать дальше