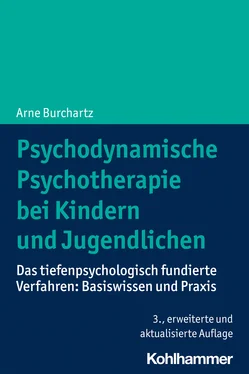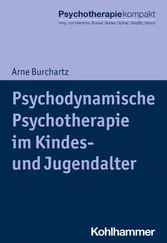Arne Burchartz - Psychodynamische Psychotherapie bei Kindern und Jugendlichen
Здесь есть возможность читать онлайн «Arne Burchartz - Psychodynamische Psychotherapie bei Kindern und Jugendlichen» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Psychodynamische Psychotherapie bei Kindern und Jugendlichen
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:5 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 100
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Psychodynamische Psychotherapie bei Kindern und Jugendlichen: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Psychodynamische Psychotherapie bei Kindern und Jugendlichen»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Psychodynamische Psychotherapie bei Kindern und Jugendlichen — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Psychodynamische Psychotherapie bei Kindern und Jugendlichen», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
• Sie entspringt Bemühungen, die Analyse in bestimmten Aspekten weiterzuentwickeln, etwa in der Frage der Aktivität des Analytikers oder der Konzentration des therapeutischen Prozesses.
• Sie ist das Ergebnis einer Suche nach einem technischen Vorgehen, das solchen Patienten hilft, die aus unterschiedlichen Gründen einer Analyse nicht zugänglich sind.
1Der Begriff »klassische Psychoanalyse« ist irreführend, impliziert er doch eine Festlegung, die der Psychoanalyse ihrem Wesen nach eigentlich widerspricht. Die psychoanalytische Technik war, ähnlich wie ihr jeweiliger wissenschaftlicher Erkenntnisstand, immer im Wandel. Seit Eissler ist man geneigt, ein bestimmtes Verfahren als »klassische Psychoanalyse« zu bezeichnen, das ist zur Unterscheidung von anderen psychoanalytischen Verfahren hilfreich, sollte aber nicht zu der Ansicht verführen, als sei dieses »Standardverfahren« schon immer die »eigentliche« Psychoanalyse gewesen. S. Freud (1919a): »… wir waren nie stolz auf die Vollständigkeit und Abgeschlossenheit unseres Wissens und Könnens; wir sind, wie früher so auch jetzt, immer bereit, die Unvollkommenheiten unserer Erkenntnis zuzugeben, Neues dazuzulernen und an unserem Vorgehen abzuändern, was sich durch Besseres ersetzen läßt« (S. 183).
2Zur Fokusbildung  Kap. 5.4 »Der Fokus in der Psychotherapie«.
Kap. 5.4 »Der Fokus in der Psychotherapie«.
2 Zum Begriff Tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie (TfP)
In Deutschland wurde die Psychotherapie 1967 als Heilungsverfahren in die Finanzierung durch die gesetzlichen Krankenkassen übernommen. Neben der psychoanalytischen Therapie wurden auch die Verfahren kassenrechtlich anerkannt, die bislang unter der Begrifflichkeit »Dynamische Psychotherapie« Eingang in die Sprachregelung gefunden hatten. Aus einer gewissen Verlegenheit heraus, wie man Kurzzeitpsychotherapie, Fokaltherapie, Dynamische Psychotherapie und langfristig stützende Verfahren unter einen Begriff fassen kann, wurde die gleichsam »künstliche« Wortkombination »Tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie« eingeführt und festgelegt. Damit entstand eine Begrifflichkeit, die zwar in Deutschland im Rahmen des Kassenrechts verständlich und zur Differenzierung von der Analytischen Psychotherapie notwendig und hilfreich ist, die allerdings keine Entsprechung im internationalen Psychotherapie-Diskurs hat. Von der Analytischen Psychotherapie werden solche Behandlungsverfahren unterschieden, die sich durch eine niedrige Behandlungsfrequenz, Begrenzung der Regression und die Fokussierung auf einen umschriebenen, bewusstseinsnahen Konflikt kennzeichnen lassen (Ermann 2004). Unklar blieb, wie weit sich in der Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie die TfP von der Analytischen Psychotherapie abgrenzen lässt. In einer früheren, der 6. Auflage des »Kommentar(s) Psychotherapie-Richtlinien« hieß es noch, dass eine »exakte Unterscheidung dieser Behandlungsarten – insbesondere in der Kinderpsychotherapie – nicht begründet werden konnte« (Rüdiger, Dahm & Kallinke 2003, S. 41). Die Tatsache aber, dass seit Einführung des Psychotherapeutengesetzes 1999 einerseits die Zahl der Anträge zur Tiefenpsychologisch fundierten Psychotherapie im Kindes- und Jugendalter wächst (vgl. Streek-Fischer 2002), andererseits – damit zusammenhängend – eine nennenswerte Zahl der zugelassenen Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten ausschließlich über eine Qualifikation in diesem Verfahren verfügt, sollte Anlass sein, über diese Auffassung neu nachzudenken. Diese Entwicklung hat ja nicht nur äußere, in der Verfassung des Gesundheitswesens und dessen Interessenkonflikten liegende Gründe. Vielmehr haben sich – wie gezeigt – auf dem Boden der Psychoanalyse eine Reihe von Behandlungsverfahren herausdifferenziert und haben an Bedeutung gewonnen, welche solchen Patientengruppen gerecht werden können, bei denen aufgrund ihrer Struktur, ihres Störungsbildes, ihrer Selbstreflexionsfähigkeit oder auch aus äußeren Gründen eine Analytische Psychotherapie nicht indiziert ist, die aber von einem psychodynamischen Vorgehen (Einsichtsförderung, positive Beziehungserfahrung, Affektdifferenzierung, intrapsychische Konfliktaufdeckung, Analyse der bewusstseinsnahen interpersonellen (Außen-)Konflikte des Patienten, Ressourcenaktivierung etc.) profitieren können (kurze Übersicht in: Wöller & Kruse 2020, S. 9–17, vgl. auch Rüger 2002, Burchartz 2004).
Der Versuch, Analytische und Tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie auch im Kindes- und Jugendalter schärfer voneinander zu unterscheiden und die jeweiligen Profile herauszuarbeiten, relativiert allerdings den Usus, beiden Verfahren die gleichen Stundenkontingente zuzuordnen. Es sollte neu begründet werden, welcher zeitliche Umfang bei den jeweiligen Verfahren im Rahmen des psychodynamischen Spektrums für sinnvoll gehalten wird. Dabei muss differenziert werden zwischen Kurzzeitpsychotherapien (wie bisher auch), tiefenpsychologisch fundierten und fokussierten Langzeittherapien und langfristig angelegten stützenden und strukturbezogenen Psychotherapien. In jedem Fall sollte beachtet werden, dass Patienten für Veränderungsprozesse ihrer psychischen Konstellationen auch unabhängig von der Frequenz ihren eigenen Zeitrahmen brauchen.
Merke
• Der Begriff »Tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie« entstand im Zusammenhang mit der Aufnahme der Psychotherapie ins deutsche Kassenrecht.
• Er bezeichnet von der Psychoanalyse abgeleitete Verfahren, die regressionsbegrenzend und konzentriert auf einen Aktualkonflikt oder auf strukturelle Funktionsstörungen arbeiten.
3 Theoretische Grundannahmen
Das vorliegende Werk versteht die Tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie (im Folgenden abgekürzt »TfP«) als ein psychoanalytisches Behandlungsverfahren. Wenn wir die Psychoanalyse als ein wissenschaftliches System begreifen, das von einer spezifischen Anthropologie und damit auch von einer beschreibbaren Metapsychologie ausgeht, so finden wir unter diesem Dach eine Reihe von Behandlungsverfahren, die sich im Laufe der psychoanalytischen Theorie- und Praxisentwicklung herausdifferenziert haben. Dazu gehören Krisenintervention, psychoanalytisch orientierte Beratung, Kurzzeitpsychotherapie, Fokaltherapie, Dynamische Psychotherapie, TfP, psychoanalytische Paar- und Familientherapie, strukturbezogene Psychotherapie, Analytische Psychotherapie, »tendenzlose« (Freud) Psychoanalyse u. a. Sie alle bilden hinsichtlich der technischen Handhabung von Übertragung und Gegenübertragung, Widerstand und Regression ein Kontinuum und sind nicht vorstellbar ohne die Grundannahmen der psychoanalytischen Theorie und Praxis, die im Folgenden skizziert werden. (Wer sich vertieft mit dem aktuellen Stand der psychoanalytischen Theoriebildung und Behandlungspraxis auseinandersetzen will, dem sei das dreibändige Werk von Mertens (2010–2012), Psychoanalytische Schulen im Gespräch empfohlen). Einen Überblick bietet Burchartz (2021) sowie Burchartz, Hopf und Lutz (2016).
3.1 Die Psychologie des Unbewussten
Die Psychoanalyse fußt auf der Erkenntnis, dass die Motive menschlichen Verhaltens, Fühlens und Denkens sowie deren Einordnung in einen individuellen und kollektiven Sinnzusammenhang der bewussten Wahrnehmung entzogen sind: Sie sind unbewusst. Wie der Mensch sein Leben gestaltet, hängt von einem psychischen Kräftespiel ab, das sich unserer direkten Beeinflussung entzieht. Dies betrifft unsere psychische Befindlichkeit, psychosomatische Phänomene, unseren Alltag, die Organisation unseres familiären und gesellschaftlichen Zusammenlebens und eben auch all das, was wir als psychische Störung oder Krankheit beschreiben. Das Unbewusste lässt sich nicht einfach »bewusst« machen (dann wäre es ja nicht mehr »unbewusst«) – dies wäre auch ein Missverständnis der psychoanalytischen Therapie. Es lässt sich allerdings anhand seiner Manifestationen erkennen und erforschen und teilweise in das Ich integrieren – ein Anliegen, dem sich S. Freud lebenslang gewidmet hat und das in der Geschichte der Psychoanalyse bis heute zu beeindruckenden Ergebnissen geführt hat. S. Freud selbst hat seine Auffassung vom Unbewussten anhand dreier Manifestationen, die auch die Themen seiner grundlegenden psychologischen Schriften bilden, entwickelt: Der Traum, die Fehlleistungen und -handlungen im Alltag und der Witz 3 . In diesen Untersuchungen konnte er wesentliche Funktionsweisen des Unbewussten herausarbeiten: Das Fehlen sprachlich-logischer Verknüpfungen, stattdessen assoziative Verknüpfungen, Bilder- und Symbolsprache; Verdichtung, Verschiebung und sekundäre Bearbeitung, um nur die wichtigsten zu nennen. Die Differenzierung in einen Primärprozess, in dem eine direkte Wunscherfüllung gesucht wird, und einen Sekundärprozess, in dem sich entwickelnde Ich-Strukturen und -Fähigkeiten zunehmend die Realitätswahrnehmung und -bewältigung durch Beherrschung der Motilität, Triebaufschub, frühe Denkprozesse, Symbolisierungsfähigkeit etc. übernehmen, gehört ebenfalls zu den ersten Erkenntnissen über das Unbewusste. In einer späteren Phase der Theoriebildung entwickelte Freud das strukturale Modell des Unbewussten: Es, Ich und Über-Ich, wobei ein Teil des Ich – mit der Grenzlinie des Vorbewussten – dem bewussten Erleben und Verhalten zuzuordnen ist. Erweiterungen erfuhr die Theorie des Unbewussten durch die Ich-Psychologie mit der Beschreibung von Abwehrmechanismen (A. Freud 1936) und durch die Objektbeziehungstheorie, v. a. durch M. Klein, D.W. Winnicott u. a., in der die Bildung innerer Objektrepräsentanzen aus dem frühen Austausch zwischen dem Individuum und seinen primären Bezugspersonen untersucht und beschrieben werden. Von den neueren Beiträgen zum Verständnis unbewusster Determinanten sind v. a. die Selbstpsychologie (Kohut 1977), Narzissmus-Theorien (Kohut 1971, Kernberg 1975, Kernberg & Hartmann 2006), die Bindungstheorie (Bowlby 1969, Ainsworth 1977, Grossmann & Grossmann 2004, Brisch 1999 u. a.) und die Untersuchung der Entwicklung der Mentalisierungsfunktion (Fonagy u. a. 2002) hervorzuheben. War lange Zeit in der psychoanalytischen Theoriebildung die Triebtheorie mit ihren Beschreibungen unbewusster Konflikte vorherrschend, so liegt heute ein großes Gewicht auf der Untersuchung psychischer Strukturen, die sich aus unbewussten Verarbeitungsweisen früher Erfahrungen ergeben und die wiederum die Funktionsweise des Ich und die Selbst- und Objektrepräsentanzen beeinflussen. Solche strukturellen Bedingungen sind z. B. die Differenzierung zwischen Subjekt und Objekt, die Fähigkeit, symbolische Repräsentanzen zu bilden, die Mentalisierungsfähigkeit, Affektwahrnehmung und -steuerung und einige mehr (vgl. OPD-KJ-2 2016).
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Psychodynamische Psychotherapie bei Kindern und Jugendlichen»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Psychodynamische Psychotherapie bei Kindern und Jugendlichen» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Psychodynamische Psychotherapie bei Kindern und Jugendlichen» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.