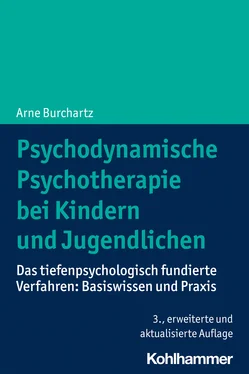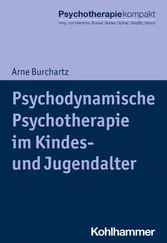Ein typischer intrapsychischer Konflikt ist derjenige zwischen dem Bedürfnis nach Anlehnung, Abhängigkeit und Zusammengehörigkeit mit signifikanten Anderen einerseits und dem Bedürfnis nach Autonomie, Abgrenzung und Eigenständigkeit andererseits. Die intrapsychische Regulation strebt eine Homöostase dieser beiden Antipoden an, dies schlägt sich auch in der Art der Beziehungsgestaltung nieder.
Die Reifung des Ich besteht dabei in der zunehmenden Fähigkeit, die antagonistischen intrapsychischen Strebungen zu integrieren, eine verträgliche Balance zwischen ihnen zu etablieren und die aus ihnen resultierenden Ängste in ich-verträglichen Abwehren zu binden sowie zwischen Innen und Außen, Wunschphantasien und Realität, Bedürfnissen und ihrer realen Befriedigung so zu vermitteln, dass ein dynamisches Gleichgewicht aus Assimilation an die gegebenen Realitäten, zunächst vermittelt durch die Eltern, und deren kreativer Gestaltung im Sinne eigener elementarer Bedürfnisse entsteht (Adaptation).
Psychische Krankheit auf der Konfliktebene entsteht, wenn die Integration des inneren und äußeren Konfliktgeschehens scheitert, wenn sich das Individuum etwa unter dem Ansturm übermäßiger innerer Affekte oder unter einem einseitigen Anpassungsdruck an äußere defizitäre (Beziehungs-)Realitäten genötigt sieht, einen Pol des Konfliktes abzuspalten, zu verleugnen oder zu verdrängen, und sich innerlich auf den antagonistischen Pol zurückzieht und dort in einer Fixierung verharrt. Die Psyche erstarrt dann in der Etablierung rigider Abwehren, die nicht Ich-verträglich und meist auch nicht sozialverträglich sind und welche die weitere Entwicklung behindern, wenn nicht sogar blockieren. Zur Aufrechterhaltung dieser pathologischen Konfliktlösungen und zur Angstbewältigung entwickeln sich Symptome als Kompromissbildungen.
3.4 Die psychodynamische Auffassung von Konflikt und Objektbeziehungen
Modelle des psychischen Geschehens gehen davon aus, dass dieses ein Feld verschiedener Kräfte (dynamis, griech.: Kraft) darstellt, die aufeinander einwirken. Das bezieht sich nicht allein auf Es, Ich und Über-Ich in den ersten psychoanalytischen Modellen, in der weiteren Theoriebildung auf die Abwehrleistungen des Ich, sondern auch, wie gezeigt, auf primäre Bedürfnisse aus den grundlegenden motivationalen Strebungen sowie auf die frühen Regulationsvorgänge in der Ausbildung der psychischen Struktur. Mit der psychodynamischen Sichtweise lassen sich auch Objektbeziehungen beschreiben sowie deren Niederschlag als innere Repräsentanzen. Gerade für das Verständnis der inneren Objektwelt ist entscheidend, dass diese nicht einfach als Abbild realer Objekte anzusehen sind, sondern vielmehr die Modi einer dynamischen Verarbeitung des Beziehungsgeschehens mit den primären Bezugspersonen enthalten, also durch subjektives Erleben, Wünsche und Affekte geprägt sind. Psychisches Geschehen ist also mit – bewussten und unbewussten – Bedeutungen versehen, die das Individuum seinen lebensgeschichtlichen Erfahrungen mit der Objektwelt verleiht. Psychische Krankheit hat es somit immer mit einem subjektiven Bedeutungsgefüge zu tun, das die Lösung innerer und äußerer Konfliktfelder behindert.
3.5 Das therapeutische Beziehungsgeschehen als Übertragung und Gegenübertragung
Der Mensch gestaltet die Beziehung zu einem anderen Menschen in Entsprechung zu seinen früheren Beziehungserfahrungen, die sich als Objektbeziehungsphantasien in seiner Psyche sedimentiert haben. Er überträgt also mehr oder weniger umfangreiche Anteile oder Aspekte, die auf frühere Objekte gerichtet waren, z. B. Wünsche, Bedürfnisse, Befürchtungen, Phantasien, Gefühle und Affekte, auf den gegenwärtigen Anderen. Er wiederholt so unbewusst die Beziehungsmuster, die sich durch frühe Regulationsprozesse in seiner psychischen Struktur niedergeschlagen haben. Dieser Vorgang der Übertragung ist ubiquitär und in allen Beziehungen zu beobachten; Übertragung ist also nicht per se pathologisch. In der Regel stellt sich durch den realen reziproken Austausch in aktuellen alltäglichen Beziehungserfahrungen eine Korrektur der Übertragung ein, so dass wir – bis auf einige Reste abgesehen – meist zu realistischen Objektbeziehungen fähig sind oder immer wieder fähig werden. Voraussetzung ist freilich, dass auch der Andere seine Reaktion auf unsere Übertragung und seine eigene Übertragung auf uns zu korrigieren imstande ist.
In der therapeutischen Beziehung spielt die Übertragung eine zentrale Rolle, denn der Therapeut wird unweigerlich zu einem Übertragungsobjekt.
Die siebenjährige Ines, die den Vater durch Trennung verloren hat, malt ein Herz und schenkt es dem Therapeuten. Der Therapeut wird so zu einem Objekt der Sehnsucht wie der Vater. Übertragen wird aber auch die Verlustangst (die durch den Erweis der Liebe beruhigt wird) und die Enttäuschungswut (»wem ich meine Liebe erweise, der könnte mich verlassen; das erzürnt mich schon jetzt – aber ich schenke ihm etwas Schönes, dann bemerkt er meine böse Aggression nicht und behält mich lieb«).
S. Freud hatte dies zunächst als eine Störung der psychoanalytischen Therapie identifiziert, denn eine intensive Übertragung trat immer auf in Verbindung mit einer Stagnation des Auftauchens und der Erinnerung verdrängten Materials. Freud erkannte, dass der Patient in der Übertragung die infantile Situation und die damit verbundenen verpönten Regungen mit der Person des Therapeuten wiederholt, anstatt sie zu erinnern und in die Persönlichkeit zu integrieren. Damit war auch eine Erklärung gefunden für die ungewöhnliche Heftigkeit der Übertragung in der therapeutischen Situation: Sie dient dem Widerstand, ja ist Teil desselben, der gegen das Eindringen verdrängter Inhalte ins Bewusstsein aufgerichtet werden muss. Je gelockerter die Abwehr (s. u.) in der therapeutischen Situation, desto intensiver also muss die Übertragung werden. Was anfänglich als Störung empfunden wurde, erwies sich für Freud schon bald von höchstem Nutzen. Denn in der Übertragung sammelt sich das Verdrängte in einer aktuellen Wiederauflage in einer lebendigen, gegenwärtigen Beziehung; die Bearbeitung der Übertragung ermöglicht dem Patienten ein unmittelbares Erleben, das dem Bewussten als psychische Wirklichkeit zugänglicher ist als blasse Erinnerungen.
Die Übertragung wurde zu dem eigentlichen und wichtigsten Agens der Psychoanalyse. »Das entscheidende Stück der Arbeit wird geleistet, indem man im Verhältnis zum Arzt, in der ›Übertragung‹, Neuauflagen jener alten Konflikte schafft, in denen sich der Kranke benehmen möchte wie er sich seinerzeit benommen hat, während man ihn durch das Aufgebot aller verfügbaren seelischen Kräfte zu einer anderen Entscheidung nötigt. Die Übertragung wird also das Schlachtfeld, auf welchem sich alle miteinander ringenden Kräfte treffen sollen« (Freud 1916–1917, S. 472). Indem sich die Krankheit in der Beziehung mit der Person des Therapeuten wiederholt, sich in ihr konzentriert, entsteht die »Übertragungsneurose« – also eine in der psychoanalytischen Therapie erwünschte Verschiebung des Krankheitsgeschehens weg von den Alltagssituationen und ihren dortigen Objekten in das »Hier und Jetzt« des therapeutischen Beziehungsraumes. Parallel zu diesem Vorgang ist häufig tatsächlich ein Rückgang der Symptomatik im Alltagsleben des Patienten zu beobachten, es wäre jedoch falsch, eine solche »Übertragungsheilung« schon als den eigentlichen Heilungserfolg anzusehen. Eine Therapie, die zu einem solchen Zeitpunkt beendet würde, brächte nichts anderes zustande als ein Wiederaufflackern aller Krankheitsphänomene, u. U. noch heftiger als zuvor, da nun auch noch das Trauma einer unbearbeiteten und verfrühten Trennung von dem Objekt heftiger libidinöser sowie aggressiver Regungen hinzukommt.
Читать дальше