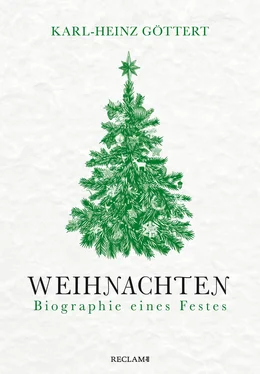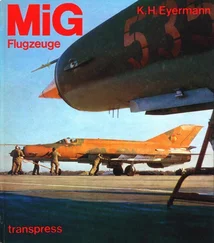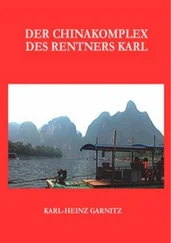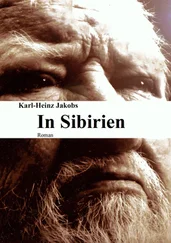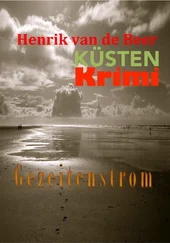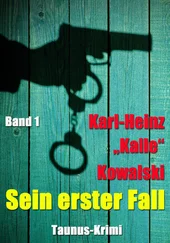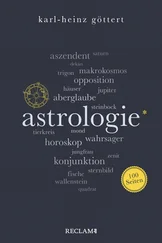Oder ist dies falsch gefragt? War sich Lukas sicher, dass seine Geschichte überzeugen würde, weil es der Sinn von Geschichten ist, die Wahrheit mit Erfindung zu mischen? Und Theophilus vielleicht ein Leser/Hörer war, der die Frage nach der historischen Wahrheit der Geburt überhaupt nicht verstanden hätte, weil er gar nicht wusste, wie man sie anders hätte darstellen sollen als mit einer erfundenen Geschichte? Wie hätte man da Augenzeugen beibringen können? Aber geboren worden war dieser Jesus Christus. Warum dann nicht diese Geburt so darstellen, dass sie »zeigte«, worauf alles ankam. Natürlich nicht in irgendeiner Unsinnsgeschichte à la Zeus und Co., sondern einer wahrscheinlichen. Die auch noch auf einer Voraussage beruhte, nämlich dem Geburtsort Betlehem. Da konnte man sich doch den Rest leicht ausdenken. Wahrscheinlich war es ohnehin so gewesen, jedenfalls so ähnlich. Wie denn sonst? Lukas, der gebildete Jude im 1. Jahrhundert n. Chr., weiß, dass es eine geschichtliche Wahrheit gibt, auf die alles ankommt – und eine Erzählung dieser Wahrheit, die durch Erfundenes gestützt wird.
Was ich noch einmal unterstreichen möchte: Lukas bietet in seinem Evangelium und seiner Apostelgeschichte Grundlagen des christlichen Glaubens. Dazu erzählt er: einerseits historisch Wahres, andererseits mythologisch Wahres. Die Trennlinie, auf die es uns heute oft ankommt, zieht er nicht. Mythologisches und Historisches gehen ineinander über, wie sie (im Alten Testament) schon immer ineinander übergegangen waren. Selbst der für das Judentum so wichtige Auszug aus Ägypten hält historischer Nachprüfung nicht stand, wie der israelische Archäologe Israel Finkelstein mit seinen Ausgrabungen belegt hat: Keine einzige Scherbe im Wüstensand ließ sich finden. Die anschließend in der Bibel genannten Städte existierten erst Jahrhunderte später, die Mauer von Jericho musste nicht durch den Klang von Trompeten zerstört werden, weil Jericho überhaupt keine Mauern besaß. Die biblischen Geschichten sind in der Regel überwiegend (aber eben nicht nur, was die Sache so schwierig macht) mythologisch, was für Finkelstein ihren Wert in nichts schmälert. Denn diese Geschichten dienten dem Glauben an Jahwe und sein auserwähltes Volk. Die Bibel ist kein Geschichtsbuch, sondern enthält anhand historischer Bezüge eine Anweisung für jüdisches Leben, vor allem für das immer wieder verlorene Vertrauen in diesen Jahwe, der dann stets zur Strafe schritt.
Ob nun Lukas selbst Jude war, ob er den mythologischen Charakter der alttestamentlichen Geschichten durchschaute oder nicht: Er trägt selbst die Wahrheit in Form von Geschichten vor, auch neben schlicht Historischem wie den Reisen von Paulus mit ihren vielen Widrigkeiten oder dessen Aufenthalt in einer römischen Mietswohnung. Letztlich gibt es für ihn nur ein Ziel: Er will sagen, dass mit diesem Jesus der Erlöser erschienen ist, Gottes Sohn, dessen Leben und Taten mittlerweile mit Recht verbreitet werden. Wie aber kann man so viel Unglaubliches glauben? Eben, normalerweise überhaupt nicht. Es muss also nachgeholfen werden. Und helfen können gut erdachte Geschichten, sehr gut erdachte. Die am allerbesten erdachte ist die Weihnachtsgeschichte, Lukas’ Meistererzählung, heute vielleicht diejenige biblische Geschichte im Rahmen des Neuen Testaments, die als einzige noch nicht untergegangen ist. Martin Walser hat sie im für ihn typischen Überschwang einmal als die »schönste, beste Geschichte« bezeichnet, »die je von Menschen ersonnen und formuliert wurde«. Und so viel stimmt ja auch: Viele bekommen bei »Es begab sich aber zu der Zeit …« immer noch eine Gänsehaut.
Lukas fand in seinen Vorlagen nichts bzw. kaum etwas für die Geburtsgeschichte Verwertbares. Von Markus hat er sie nicht, denn der beginnt sein Evangelium mit dem Heuschreckenesser Johannes, der Jesus »von Nazaret« tauft, worauf dieser in die Wüste geht und unter »wilden Tieren« lebt, bis sein Wirken in Galiläa einsetzt. Matthäus, der ausführlichste aller Evangelisten, hat die Weihnachtsgeschichte auch nicht oder jedenfalls nur in Teilen. Denn Matthäus berichtet zwar von der Geburt in Betlehem, fokussiert aber den Auftritt der Weisen aus dem Morgenland, der den Kindermord durch Herodes auslöst. Und Johannes springt wieder sogleich zur Taufe, als wäre ihm, der ohnehin das intellektuellste Evangelium abliefert (»Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott …«), die allzu »realistisch« ausgemalte Geburt peinlich. Lukas geht also deutlich über das von ihm Vorgefundene – eigentlich nur die beiden Städte Nazaret und Betlehem – hinaus, erfindet eigenständig. Und er fällt dabei nicht mit der Tür ins Haus. Er erzählt nämlich nach der Ankündigung der Geburt durch den Engel Gabriel nicht gleich die erfolgte Geburt Jesu (Lk 1,26–38), sondern wendet sich ausführlich Johannes dem Täufer zu.
Bei dieser Szene verkennt man das mythologische Arrangement vielleicht leichter, weil die Umstände ausgesprochen realistisch ausgeführt sind (und dann doch nicht wirklich »stimmen«). Es gibt also einen Priester namens Zacharias und dessen Ehefrau Elisabet, beide besonders gottesfürchtig, aber trotz inständiger Gebete kinderlos und in einem Alter, in dem eine Empfängnis ausgeschlossen scheint. Da geschieht ein Wunder. Während Zacharias im Tempel mit einem kultischen Opfer beschäftigt ist, erscheint der Engel Gabriel und kündigt ihm an, dass seine Frau einen Sohn gebären werde, den er, bitteschön, Johannes nennen möge. Dieser Sohn werde »groß sein vor dem Herrn«, keinen »Wein und berauschende Getränke« trinken – eine im Alten Testament häufige Bemerkung in Bezug auf herausgehobene Persönlichkeiten. Zacharias hat Nachfragen wegen der Unwahrscheinlichkeit, wird von Gabriel dafür zur Strafe mit Stummheit belegt. Das führt später zur großen Überraschung, weil Elisabet den Sohn vor dem Volk auftragsgemäß Johannes nennt, obwohl kein Verwandter dieses Namens existiert, und der stumme Ehemann dies auf einem Schreibtäfelchen sofort bestätigt. Daran schließt sich ein Lobgesang an, das Benedictus (›Gepriesen sei der Herr‹), das schon deshalb aus der Tradition stammen dürfte, weil es zur Situation schlecht passt, spricht Zacharias doch in düstersten Tönen von all dem Unheil, aus dem Jahwe das Volk Israel erlösen musste.
Sagen wir zuletzt noch, dass Geburtsankündigungen in der antiken Literatur geradezu eine eigene literarische Gattung bilden. Sie kommen in Homers Odyssee (11,248 f.) ebenso vor wie in Euripides’ Iphigenie in Aulis (V. 1962 ff.), im Alten Testament sowieso – etwa angesichts der Geburt von Ismael (Gen 16,11 f.), Isaak (Gen 17,15 ff.) oder Simson (Ri 13,3 ff.). Weshalb aber erzählt Lukas diese Geschichte, und was stimmt in ihr nicht? Jeder Kenner des Alten Testaments sieht sofort den Wiederholungscharakter. Ein altes Ehepaar bekommt noch ein Kind – wie der Stammvater Abraham mit 100 Jahren und Sara mit über 90 ihren Sohn Isaak (Gen 21,1 ff.). Eine unfruchtbare Frau wird schwanger – wie Isaaks Frau Rebekka mit den Zwillingen Esau und Jakob (Gen 25,21). Jakobs Frau Rahel ist ebenfalls lange kinderlos, ehe Gott »ihren Mutterschoß« öffnete (Gen 29,31). Und auch Hanna bekommt ihren Samuel erst nach göttlichem Eingreifen. Schließlich folgt der Kommentar der Elisabet auf die Überraschung fast wortgleich dem von Rahel, der die unverhoffte Geburt von Josef (den später seine Brüder verkauften) angekündigt wird (Gen 30,23).
All das kann nur gewollt sein. Der Leser soll denken, dass er sich immer noch im Alten Testament befindet, dass dieses Alte Testament nur fortgesetzt wird – womöglich mit dem Nebengedanken, wie schrecklich doch angesichts von so viel Gemeinsamkeit die Trennung von Juden und Christen ist. Und was stimmt an der Geschichte nicht? Lukas kennt offenbar die Abläufe im Tempel nicht genau, lässt Zacharias ins Innere, hinter den Vorhang, gehen, was nur dem Hohepriester, und zwar einmal im Jahr am Laubhüttenfest, zukam, aber auf Zacharias deshalb nicht zutrifft, weil er mit dem Opfer »an der Reihe« war. Er versah also den normalen Priesterdienst – vor dem Vorhang, so dass die Szenerie mit dem Engel gar nicht möglich gewesen wäre. Wer glaubt, die »Parallele« mit dem Alten Testament sei im Falle von Maria unvollkommen, weil Maria keine alte und deshalb unfruchtbare Frau war, übersieht, dass diese Unvollkommenheit das Geschehen nur steigert. Denn diesmal handelt es sich um eine noch viel unwahrscheinlichere Geburt, weil kein menschlicher Erzeuger nötig ist, sondern das Kind vom Heiligen Geist stammt und von einer Jungfrau geboren werden soll. Der ausdrückliche Hinweis darauf, dass schon Elisabet gegen jede Wahrscheinlichkeit schwanger wurde, zeigt deutlich, dass es um eine Art Überbietung geht.
Читать дальше