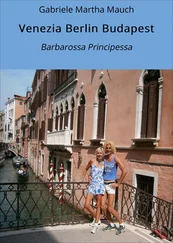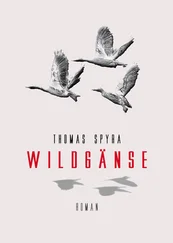Thomas Mann war mit der Familie Lukács bekannt; József Lukács verwaltete die Honorare seiner gerade in Ungarn weitverbreiteten Werke. Eine Geschäftsbeziehung, die übers rein Geschäftliche hinausging: Der Bankdirektor lud den Dichter und seine Familie in sein Budapester Haus ein. Der revanchierte sich auf seine Weise, ein Dichterdank, und nahm die Familie in sein Werk auf. Deren Schilderung im Zauberberg ist nicht frei von Stereotypen, mit denen man zu jener Zeit Juden wahrnahm. Wir finden deutliche Züge der Lukács in seinem Roman, wenn Thomas Mann den frommen Vater beschreibt, Leos christlich geprägte Schulausbildung, protestantisch bei Georg, katholisch-jesuitisch im Zauberberg , oder das frühe Studium von Marx und Hegel, das Leo und Georg teilen. Die dichterische Freiheit verschafft sich viel Raum in den Gesprächen über Gesundheit und Krankheit, die Leo Naphta auf einem der langen Schneespaziergänge zu einem Existenzial erhebt. »Im Geist also, in der Krankheit beruhe die Würde des Menschen und seine Vornehmheit; er sei, mit einem Worte, in desto höherem Grade Mensch, je kränker er sei, und der Genius der Krankheit sei menschlicher als der der Gesundheit.«
Aber kehren wir vom Zauberberg in die historischen Ebenen von Budapest zurück: Im Sommer 1902 legt Georg das Abitur ab, veröffentlicht früh Theaterkritiken und macht sich auf die erste Auslandsreise nach Skandinavien mit einem Besuch bei Henrik Ibsen, einem der damals führenden Dramatiker.
Sosehr Leben und Werk von Georg Lukács vom 20. Jahrhundert geprägt sind und Kunst wie Literatur dieses Jahrhunderts haben neu sehen lassen, so wenig sind ihm Historiker bislang gerecht geworden. Es gibt keine umfassende Biographie über ihn.
In Berlin und in Budapest schreibt Lukács an einem Buch über das moderne Drama, genauer: über die Soziologie des modernen Dramas. Den größten Fehler in der soziologischen Kunstbetrachtung sieht er darin, dass sie zwischen dem Kunstwerk und »bestimmten wirtschaftlichen Verhältnissen eine gerade Linie ziehen« wolle. Darauf folgt der Satz, der zum Grundsatz von Lukács’ ganzer Ästhetik werden wird: »Das wirklich Soziale aber in der Literatur ist: die Form.« Erst die Form – und ihre Analyse – macht das »Erlebnis« des Dichters – und Erlebnis ist der Schlüsselbegriff der Philosophie jener Zeit – aus, indem es die Wirkung des Kunstwerks freisetzt. Auf Wirkung setzte vor allem das naturalistische Drama, die Stücke von Tschechow, Gorki, von Strindberg und Ibsen, von Gerhart Hauptmann, die die Theater damals zeigten. Die Premiere von Hauptmanns Die Ratten , einem spätnaturalistischen Drama, könnte Lukács 1911 in Berlin gesehen haben. Gerade 19-jährig, hatte er 1904 in Budapest die Thália-Gesellschaft mitbegründet, in der, wie in der Berliner Freien Bühne oder dem Théâtre Libre in Paris, die Stücke der damaligen dramatischen Avantgarde aufgeführt wurden.
1911 erscheint in Berlin eine Sammlung von Essays unter dem Titel Die Seele und die Formen . Ihr Verfasser Georg von Lukács hatte einige der Aufsätze vorab schon auf Ungarisch in der Zeitschrift Nyugat veröffentlicht, der Westen . Genau in diese Himmelsrichtung strebten die Zeitschrift wie Lukács’ Beiträge. Sie handeln von Novalis, von Stefan George, der Wiener Moderne, von Kierkegaard, Theodor Storm, von allem, was von Budapest aus gesehen westlich lag. Und an den Anfang stellte der junge Autor einen Brief an seinen früh verstorbenen Freund Leo Popper, in dem er über die Form der nachfolgenden Beiträge meditiert: den Essay. Lukács nennt ihn eine Kunstform: »In der Wissenschaft wirken auf uns die Inhalte, in der Kunst die Formen; die Wissenschaft bietet uns Tatsachen und ihre Zusammenhänge, die Kunst aber Seelen und Schicksale.« In den Schriften des Essayisten, also seinen, schreibt Lukács, werde die Form zum Schicksal. Die Seele nimmt in den Formen der Kunst Gestalt an. Der Essay, so heißt es am Schluss der Einleitung, »ist eine Kunstart, eine eigene restlose Gestaltung eines eigenen, vollständigen Lebens. Jetzt erst klänge es nicht widerspruchsvoll, doppelsinnig und wie eine Verlegenheit, ihn ein Kunstwerk zu nennen und doch fortwährend das ihn von der Kunst Unterscheidende hervorzuheben: er steht dem Leben mit der gleichen Gebärde gegenüber wie das Kunstwerk, doch nur die Gebärde, die Souveränität dieser Stellungnahme kann die gleiche sein, sonst gibt es zwischen ihnen keine Berührung.«
Gegen diese Form des Essays erhob die Schulphilosophie erhebliche Einwände, Max Weber riet dem Autor, »in rein logischer, sozusagen juristisch-praeciser Form den Sinn Ihrer Grundbegriffe« zu entfalten, ein »Skelett straffen Denkens«. Genau das wollte aber Lukács nicht. Er hielt an der Kunstform fest, die den Inhalt vorgibt.
Immer nämlich geht es in seinen Essays um seelische Zustände, die zu ästhetischen Formen kristallisieren, zu erkennbaren Aggregatzuständen der historischen Wirklichkeit. Der Essayist stellt sie deutlich heraus: Es sind der typische Dichter und der Platoniker bei Rudolf Kassner, ein bedeutender Kulturphilosoph jener Zeit, die Trennung als entscheidende Geste und Gebärde bei Sören Kierkegaard, der sich von seiner Verlobten lossagt, die Bürgerlichkeit bei Theodor Storm, Einsamkeit und Kälte als ein Zusammenhang bei Stefan George, die Sehnsucht bei Charles-Louis Philippe, der Tod bei Richard Beer-Hofmann als ein Grundmotiv von dessen Epoche, die Rolle von Gott in den Tragödien von Paul Ernst.
In jedem dieser Essays sind es die ersten Sätze, die wirkungsvoll und kräftig das Folgende orchestrieren: »Denn immer und überall bin ich Menschen begegnet, die außerordentlich gut ein Instrument spielten, ja in ihrer Weise auch komponierten und im Leben dann, draußen von ihrer Musik nichts wußten. Ist das nicht merkwürdig?« Mit dieser Frage von Rudolf Kassner hebt der erste Aufsatz von Lukács an und stellt Kassners Grundzug heraus, das Wesentliche zu sehen:
»Er vermag mit so suggestiver Kraft, Dinge nicht zu sehen, daß sein Blick die Menschen aus ihrer Hülse schält und wir von dem Augenblick an die Hülse als Spreu empfinden und nur das als wichtig, was er als Kern betrachtet. Eine der Hauptkräfte Kassners liegt darin, daß er so vieles nicht sieht. Die Kategorien des täglichen Lebens und der schablonenhaften Geschichtsschreibung existieren für ihn einfach nicht.«
Oft stellt Lukács eine Frage, die, wie in seinem Essay über Richard Beer-Hofmann, im Grunde auf eine ganze kurz gefasste Skizze der Wiener Moderne hinausläuft:
»Jemand ist gestorben, was ist geschehen? Nichts vielleicht, und vielleicht alles. Vielleicht wird es nur der Schmerz von ein paar Stunden, Tagen, vielleicht Monaten, und dann ist alles wieder ruhig und das alte Leben geht weiter. Vielleicht zerreißt etwas in tausend Fetzen, das einmal wie Zusammengehörigkeit aussah, vielleicht verliert ein Leben mit einem Schlage all seinen hineingeträumten Inhalt, oder es blühen vielleicht neue Kräfte aus unfruchtbaren Sehnsüchten. Vielleicht fällt etwas zusammen, vielleicht baut sich etwas anderes auf, vielleicht geschieht keines von beiden und vielleicht beides. Wer weiß es? Wer kann es wissen?
Jemand ist gestorben. Wer war es? Es ist einerlei. Wer weiß, was er dem Andern war, dem Jemand, dem Allernächsten, dem ganz Fremden? Ob er ihnen jemals nahe war? Ob er darin war in ihrem Leben? Ob er in Jemandes Leben war, in irgend jemandes wirklichem Leben? Oder war er nur der mutwillig umhergeschleuderte Ball seiner verspielten Träume, nur das Sprungbrett, das einen irgendwohin aufschnellt, nur die einsame Mauer, an der sich eine ewig fremde Pflanze empor rankt? Und wenn er Einem wirklich etwas war, was war er ihm, wie und womit? Mit seiner Eigenart Gewicht und Wesen, oder durch Gaukelbilder geschaffen, durch ein unbewußt gesprochenes Wort oder eine zufällige Geste? Was kann ein Mensch dem andern Menschen sein?«
Читать дальше