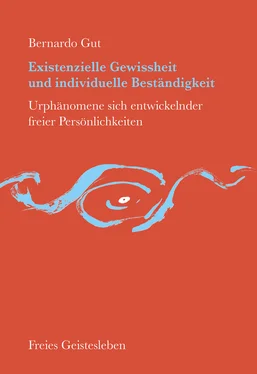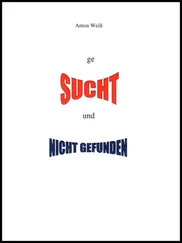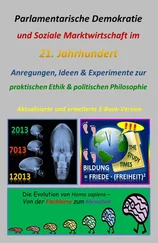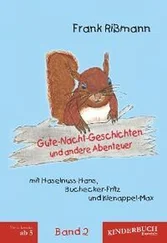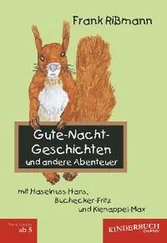13Vgl. Marten, R., Heidegger lesen. – München: Fink, 1991. Siehe besonders S. 85 ff.
14Vgl. Kant, I., Werke in zehn Bänden, herausgegeben von W. Weischedel. – Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1956. Bd. 6: Schriften zur Ethik und Religionsphilosophie. In der Grundlegung der Metaphysik der Sitten heißt es zum Beispiel: «Die Handlung, die mit der Autonomie des Willens zusammen bestehen kann, ist erlaubt; die nicht damit stimmt, ist unerlaubt ». (S. 74.)
15‹Ethischer Individualismus› ist eine Wendung, die Steiner folgendermaßen geprägt hat: «Die Summe der in uns wirksamen Ideen, den [sic!] realen [sic!] Inhalt unserer Intuitionen, macht das aus, was bei aller Allgemeinheit der Ideenwelt in jedem Menschen individuell geartet ist. Insofern dieser intuitive Inhalt auf das Handeln geht, ist er der Sittlichkeitsgehalt des Individuums. Das Auslebenlassen dieses Gehaltes ist die höchste moralische Triebfeder und zugleich das höchste Motiv dessen, der einsieht, dass alle anderen Moralprinzipien sich letzten Endes in diesem Gehalte vereinigen. Man kann diesen Standpunkt den ethischen Individualismus nennen» ( Philosophie der Freiheit, S. 160).
16Zu den erkenntnistheoretischen Ansätzen Steiners siehe besonders: Steiner, R., Wahrheit und Wissenschaft. Vorspiel einer Philosophie der Freiheit (1892). – Dornach: R. Steiner Verlag, 1980, 3. Aufl. – Solov’evs Darstellung in dem Fragment Theoretische Philosophie ist kongenial zu Steiners Auffassung. Siehe dazu: Solov’ev, V., Theoretische Philosophie, in: Deutsche Gesamtausgabe der Werke von W. Solowjew, Bd. VII, übersetzt von W. Szylkarski. – Freiburg i. Br.: Wewel, 1953.
17Für die folgenden Betrachtungen beziehe ich mich in freier Weise auf den Ansatz, den Adolf Reinach (1883–1917) in seiner epochalen Schrift Die apriorischen Grundlagen des bürgerlichen Rechtes (1913) entworfen hat. Bestimmte Gesichtspunkte werde ich dabei immanent-kritisch analysieren und um einige Aspekte erweitern. Siehe dazu: Reinach, A., Sämtliche Werke; textkritische Ausgabe in 2 Bänden, herausgegeben von K. Schuhmann und Barry Smith. – München: Philosophia, 1989.
18Reinach, Sämtliche Werke, Bd. 1, S. 141.
19 Schweizerisches Zivilgesetzbuch und Nebenerlasse (ZGB), herausgegeben von A. Büchler. – Basel: Helbing Lichtenhahn, 2011, 3. Aufl., S. 58.
20 Schweizerisches Zivilgesetzbuch (ZGB), hrsg. von H. Aeppli (25., überarb. Aufl. der von W. Stauffacher begründeten Ausgabe). – Zürich: Orell Füssli, 1989, S. 509.
21ZGB, 25. Auflage, 1989, S. 509.
22Reinach, Sämtliche Werke, Bd. 1, S. 147 ff.
23Reinach, Sämtliche Werke, Bd. 1, S. 158 ff. und S. 169 ff.
24Reinach, Sämtliche Werke, Bd. 1, S. 173 ff.
25Shakespeare, W., The Merchant of Venice / Der Kaufmann von Venedig. Englisch und Deutsch; übersetzt, kommentiert und herausgegeben von B. Puschmann-Nalenz. – Stuttgart: Reclam, 1992, Act I, Scene III, Verses 140 ff.
26 The Merchant of Venice, Act IV, Scene I, Verses 302 ff.
27 The Merchant of Venice, Act IV, Scene I, Verses 344 ff.
28Zu den rechtlichen Aspekten des Prozesses um den Vertrag zwischen Antonio und Shylock vgl. insbesondere Jhering, R. v., Der Kampf um’s Recht. – Wien: Manz, 1872. Ihering weist u.a. auf Folgendes hin: «Gerade darauf beruht in meinen Augen das hohe tragische Interesse, das Shylock uns abnötigt. Er ist in der Tat um sein Recht betrogen. So wenigstens muss der Jurist die Sache ansehen. Dem Dichter steht natürlich frei, sich seine eigene Jurisprudenz zu bilden, und wir wollen es nicht bedauern, dass Shakespeare dies hier getan oder richtiger die alte Fabel beibehalten hat. Aber wenn der Jurist dieselbe einer Kritik unterziehen will, so kann er nicht anders sagen, als der Schein war an sich nichtig, da er etwas Unsittliches enthielt; ließ der weise Daniel [Portia] ihn aber einmal gelten, so war es ein elender Winkelzug, ein kläglicher Rabulistenkniff, dem Manne, dem er einmal das Recht zugesprochen hatte, vom lebenden Körper ein Pfund Fleisch auszuschneiden, das damit notwendig verbundene Vergießen des Bluts zu versagen. Man möchte fast glauben, als ob die Geschichte von Shylock schon im ältesten Rom gespielt habe; denn die Verfasser der zwölf Tafeln hielten es für nötig, in bezug auf das ‹Zerfleischen des Schuldners› (in partes secare) ausdrücklich zu bemerken, dass es auf etwas mehr oder weniger dabei nicht ankomme. (Si plus minusve secuerint, sine fraude, esto!)» (S. 64 f.). – Sehr aufschlussreiche Konsequenzen aus der elenden Gerichtsfarce sowie dem erbärmlichen Benehmen der «christlichen» Gegenspieler Shylocks hat David Henry Wilson in seinem Theaterstück Shylock’s Revenge dramatisch verarbeitet. Abgedruckt ist Wilsons Theaterstück in: Schwanitz, D., Shylock. Von Shakespeare bis zum Nürnberger Prozess, mit einem Abdruck von «Shylock’s Revenge» by D. H. Wilson. – Hamburg: Krämer, 1989.
29Reinach, Sämtliche Werke, Bd. 1, S. 238 f.
30Reinach, Sämtliche Werke, Bd. 1, S. 239.
31Reinach, Sämtliche Werke, Bd. 1, S. 240 ff.
32ZGB, 3. Aufl., 2011, S. 17.
33ZGB, 25. Auflage, 1989, S. 3.
URPHÄNOMENE DER RECHTSSPHÄRE II
Korrelative Rechtsrelationen und fundamentale Menschenrechte
Abstract
1.In the first essay on fundamental phenomena inherent to the Realm of Rights and Justice , I started the investigation by looking at the manifold consequences following from a promise a person A clearly expressed to an addressee B who consciously took it in, and understood what it meant. It is a basic example of a relative legal structure. A has bound himself by what he offered to do and can only bring the undergone relation to an end if he fulfils the promise. The addressee B , on the other hand, is entitled to claim A to meet what he promised, but he is also privileged to renounce his claim – if he chooses –, exerting a typical negative absolute right which dissolves the relation between him and A.
At the end of the article, I raised two questions on which I have – to a certain extent – dealt with in the present second essay on fundamental legal phenomena :
(i) Can we conceive absolute rights having a positive social character?
(ii) Can we establish absolute legal structures, essential for an individual person, which are completely independent of the various, mutually differing legal communities?
2.In contrast e.g. to a mathematician who investigates the objective implications and laws which follow from postulates and axioms, and also in contrast to a natural scientist who analyses the processes of anorganic and organic appearances in the sense perceptive world – a researcher devoted to the study of the Realm of Rights and Justice finds himself confronted with events, facts, dilemmas, processes, riddles that only come into being, i.e. appear, develop, and manifest themselves, when at least two human individuals enter in contact with each other. Wesley Newcomb Hohfeld (1879–1918) tried to peel off typical legal patterns that emerge when two human beings establish a relationship with one another and agree to mutually accept certain rules to be applied in their relation.
Hohfeld found four pairs of Jural Correlatives :
| (a)claim ( right sensu stricto ) |
vs. |
duty; |
| (b)privilege ( liberty to ) |
vs. |
no-right (no-claim); |
| (c)power |
vs. |
liability; |
| (d)immunity ( exemption from ) |
vs. |
disability. – |
Looking above all at the positive four poles of the jural correlatives, we can summarise:
Читать дальше