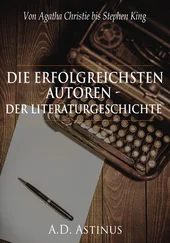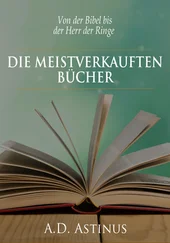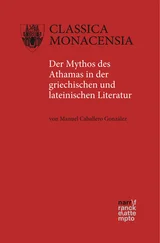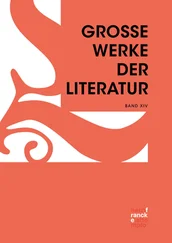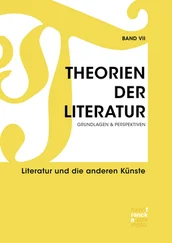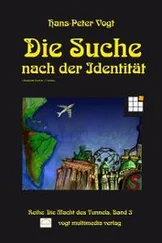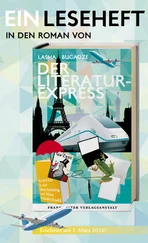1 Eine hermeneutische Lesart, die das Narrativ der Karte befragt.
2 Eine medientheoretische Lesart, die den „subjektkonstituierenden Charakter“42 der Karte befragt, was sich vielleicht auch mit dem Begriff der Agency verstehen lässt.
3 Ein phänomenologisch-grammatologischer Ansatz, der die Topographie nicht in „die Intentionen eines kulturell prädisponierten Bewusstseins, sondern auf eine Rhetorik [hin übersetzt]. […] Mögliches Handeln schreibt sich immer schon in die Bewegung eines Textes ein, der unablässig neu gewebt und wieder aufgeknüpft wird.“43
Was lässt sich hieraus für die regionale Literaturgeschichtsschreibung gewinnen? Dem hier vorgestellten Forschungsdiskurs zwischen dem Begriff der Kulturtopographie als methodischem Zugriff sowie der Frage nach der Relevanz der Literatur darin und vice versa dem Input in die Öffentlichkeit sind in diesen Perspektiven neue Möglichkeiten gegeben. In einem Selbstverständnis, das dem universitären Forschungsdiskurs neben der Wissensproduktion und -vermittlung auch die Aufgabe des Wissensmanagements gibt, ermöglichen z.B. die citizen science neue Ansätze der Kartographie. Damit ist nicht nur die Erhebung von Daten gemeint, sondern ein partizipativer Wissenschaftsbegriff, der die regionale Literaturgeschichtsschreibung aus ihren institutionen- und wissenschaftsgeschichtlichen Kontexten lösen kann und den Literaturbegriff mit dem „Kit“ eines transkulturellen Regionenverständnisses aktualisiert. Dazu bedarf es eines Netzwerks der regionalen Literaturgeschichtsschreibung, das sowohl die verschiedenen, z.B. institutionell verankerten Literaturbegriffe – zwischen Literaturarchiven, Schreib- und Lesezirkeln, Universitäten, Forschungsprojekten und Museen – verbindet als auch regionenvergleichend arbeitet.
II.
Herders neue Anthropologie: Identitätsbildung im Zuge der Verwirklichung von Humanität
Gerhard Sauder, Saarbrücken
Sprache hielt Herder für das Medium, das Identität verwandelt und sie zu reflektieren erlaubt. Er fühlte sich den Menschen zugehörig, die mit ihm eine Sprache gebrauchten, aber mitten unter ihnen als einmaliges Individuum. Doch eine konstante Sich-Selbst-Gleichheit und Kontinuität einer Person in der Zeit betrachtete er aus der Perspektive seiner Geschichtsphilosophie durchaus kritisch.
In zwei „Reflexionsgedichten“ von 1797 hat er sich dem „Ich“ und dem „Selbst“ zugewandt. Das Gedicht Das Ich. Ein Fragment greift in zentralen Argumenten auf Formulierungen zurück, die sich bereits in den Ideen finden. Wie dort gründet er seine geschichtliche Reflexion auf die Naturgeschichte. Ich beschränke mich auf diesen Text. In Selbst. Ein Fragment werden Gedanken variiert, die in Das Ich auftreten – aber das „Selbst“ lässt sich „als die geleistete, aus den Kräften des Ganzen und im Blick auf das Ganze selbstgeschaffene Individualität betrachten, mit der der Mensch sich zum Abbild des göttlichen Selbst und zum Schöpfer seiner selbst macht.“1
Das Ich umfasst 147 Zeilen in 14 Strophen von unterschiedlicher Länge – zwischen vier und 25 Zeilen sind in je fünfhebigen Jamben angeordnet. Auffällig ist ein typographisches Mittel, mit dem Herder die Pronomina – v.a. Du, Dich, Dir, Dein – gelegentlich durch Großschreibung akzentuiert.
Der verdienstvolle Herder-Forscher Wilhelm Dobbek hielt im Ersten der fünfbändigen Herder-Ausgabe des Aufbau-Verlags diese Hervorhebungen wohl für unbedeutend und verzichtete auf sie. Beide Gedicht-Fragmente sind zuerst in Herders zweiter Gedichtsammlung Gedichte und Reime in der sechsten Sammlung der Zerstreuten Blätter (Gotha 1797) erschienen.
Der Herausgeber des Dritten Bandes der Frankfurter Ausgabe, Ulrich Gaier, versammelt Gedichte dieser Art unter „Reflexionsdichtung“. Mit ihren philosophischen Sujets sind diese langen Gedichte auch typische Lehrgedichte. Ich zitiere zunächst die beiden ersten Strophen und gebe dann Zusammenfassungen der Strophen 3 bis 12; die beiden Schlussstrophen 13 und 14 zitiere ich wieder wörtlich.
Willst du zur Ruhe kommen, flieh, o Freund,
Die ärgste Feindin, die Persönlichkeit .
Sie täuschet dich mit Nebelträumen, engt
Dir Geist und Herz, und quält mit Sorgen dich,
Vergiftet dir das Blut, und raubet dir
Den freien Atem, daß du, in dir selbst
Verdorrend, dumpf erstickst von eigner Luft.
Sag’ an: was ist in dir Persönlichkeit?
Als in der Mutter Schoß von Zweien du
Das Leben nahmst, und, unbewußt dir selbst,
An fremdem Herzen, eine Pflanze, hingst,
Zum Tier gediehest, und ein Menschenkind
(So saget man) die Welt erblicktest ; Du
Erblicktest sie noch nicht; sie sahe Dich,
Von deiner Mutter lange noch ein Teil,
Der ihren Atem, ihre Küsse trank,
Und an dem Lebensquell, an ihrer Brust
Empfindung lernete. Sie trennte dich
Allmählich von der Mutter, eignete
In tausend der Gestalten Dir Sich zu,
In tausend der Gefühle Dich Ihr zu,
Den immer Neuen, immer Wechselnden. […]
Nach der Kritik an der „Persönlichkeit“, die das „Ich“ mit „Nebelträumen“ täuscht und es „von eigner Luft“ ersticken lässt, wird die Genese der „Persönlichkeit“ aus dem Embryo, der Mutter, der Trennung von ihr, bis zur Erfahrung von „immer Neuen, immer Wechselnden“ Gefühlen erzählt.
1 Weiter geht es mit dem Wachstum des Kindes zum Knaben, Jüngling, Mann und Greis. In jedem Alter ist kein Teil des Körpers noch derselbe.
2 Die „innre Welt / Der Regungen, der lichten Phantasei, / Des Anblicks aller Dinge“ verändert sich in jedem Alter.
3 Die Strophe beginnt mit der Aufforderung „Ermanne Dich. Das Leben ist ein Strom / Von wechselnden Gestalten.“
4 Will das Ich „einer Wahngestalt / Gedanken, Wirkung, Zweck des Lebens weihn?“
5 Mit Wiederholung der Aufforderung „Ermanne Dich.“ wird auf das gedankliche Zentrum des Gedichts zugesteuert: „Nein, du gehörst nicht Dir; / Dem großen, guten All gehörest Du.“ „Jedwedes Wort der Lippe, jeder Zug / Des Angesichtes ist ein fremdes Gut , / Dir angeeignet , doch nur zum Gebrauch, / So , immer wechselnd, stets verändert schleicht / Der Eigner fremden Gutes durch die Welt.“
6 Was ist von Deinen zahllosen Empfindungen Dein Eigentum? „Das Ich erstirbt, damit das Ganze sei.“
7 Was willst Du mit Deinem „armen Ich“ der Nachwelt hinterlassen? Deinen Namen?
8 Dein Ich? Wie lange wird die Nachwelt Deinen Namen nennen?
9 Nur wenn über Dein enges Ich hinaus „Dein Geist in allen Seelen lebt“, bist du „Ein Ewiger“.
10 Die kleinliche Persönlichkeit, die man „den Werken eindrückt“, vertilgt den „ewgen Genius , Das große Leben der Unsterblichkeit.“
11 So lasset dann im Wirken und GemütDas Ich uns mildern, daß das beßre Du ,Und Er und Wir und Ihr und Sie es sanftAuslöschen, und uns von der bösen UnartDes harten Ich unmerklich-sanft befrein.In allen Pflichten sei uns erste Pflicht Vergessenheit sein selber ! So gerätUns unser Werk, und süß ist jede Tat,Die uns dem trägen Stolz entnimmt, uns freiUnd groß und ewig und allwirkend macht.Verschlungen in ein weites LabyrinthDer Strebenden, sei unser Geist ein TonIm Chorgesang der Schöpfung, unser HerzEin lebend Rad im Werke der Natur.
12 Wenn einst mein Genius die Fackel senkt,So bitt’ ich ihn vielleicht um Manches, nurNicht um mein Ich . Was schenkt er mir damit?Das Kind? Den Jüngling? Oder gar den Greis?Verblühet sind sie, und ich trinke frohDie Schale Lethens . Mein Elysium Soll kein vergangner Traum von MißgeschickUnd kleinem, krüpplichten Verdienst entweihn.Den Göttern weih’ ich mich, wie Decius ,Mit tiefem Dank und unermeßlichemVertrauen auf die reich belohnende,Vielkeimige, verjüngende Natur.Ich hab’ ihr wahrlich etwas KleineresZu geben nicht, als was sie selbst mir gab,Und ich von ihr erwarb, mein armes Ich.2
Читать дальше