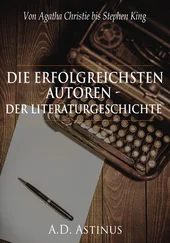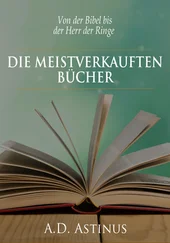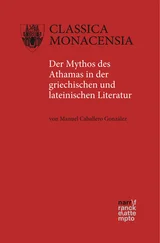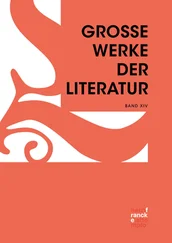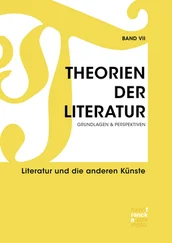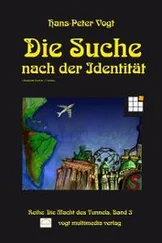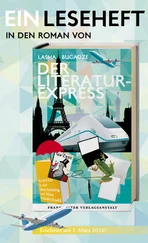Regionen dieses Typs reagieren auf jene Transformationsprozesse, die im Kontext des alten Regionalitätstyps und seiner Fixierung auf Heimat und Nation, auf Familie, Brauchtum, Sprachnormen und vor allem Herkunft nicht mehr bewältigt werden können. Als flexible Rahmungen rechnen sie grundsätzlich mit einer heterogenen Population mit gestreuten Milieus, pluralen Lebensstilen, Migrationskulturen oder Transnationalitäten. Sie kommen also einem Zugehörigkeitsbedarf entgegen, der weniger an überkommenen Traditionen als vielmehr an Routinen und Normalitäten orientiert ist, d.h., sie haben transitorischen Charakter und setzen auch die Austauschbarkeit sogenannter regionaler Identitäten voraus.32
Mit der Befragung zweier Texte – Stefan Thomes Grenzgang (2009) und Frank Goosens Sommerfest (2012) – nach der Übertragbarkeit dieses fluiden Regionenbegriffs in die Literatur schließt Amann und zeigt, dass es schwierig bleibt:
Den zitierten Vorwurf des Protagonisten [in Frank Goosens Sommerfest ], die Kulturhauptstadtkampagne arbeite mit Verklärung, muss sich der Roman selbst gefallen lassen. Dieser performative Widerspruch würde dann auch den Stellenwert von Goosens Roman in einer Literaturgeschichte der Region bestimmen, wohingegen der mit einem ähnlichen Handlungsgerüst arbeitende Roman von Thome unspektakulär über die Kontingenz regionaler Lebensräume erzählt und zu einem zeitgemäßen Verständnis des Regionalen beiträgt.33
Grundlegend für diesen kritischen Blick auf das Potenzial zweier Beispiele der Gegenwartsliteratur für die regionale Literaturgeschichtsschreibung ist dabei der Literaturbegriff und die Nähe zwischen Forschung und Forschungsobjekt sowie Moderne und Antimoderne.
Wo zuvor nach der politischen Relevanz des Faches gefragt wurde, geht es nun um die Realitätsrelevanz des Mediums. Während die Differenzierung von Regionenbegriffen in der interdisziplinären Perspektive abhängig von der Verabschiedung überkommener positivistischer Raum- und Wissensbegriffe ist sowie dem Austausch zwischen den Fächern, steht die Literatur in einem Spannungsverhältnis von Rezeptionsästhetik34 und Modernität im Sinne ihres Potenzials, zeitgemäß auf den diskurstheoretischen state of the art zu reagieren.
Drei Punkte können aus dem Forschungsdiskurs zur regionalen Literaturgeschichtsschreibung an dieser Stelle notiert werden:
1 In der Arbeit an einer regionalen Kulturgeschichtsschreibung dominiert die Germanistik.
2 Die Frage nach einer regionalen Literaturgeschichte ist fachkonstitutiv für die Germanistik.
3 Regionale Literaturgeschichtsschreibung stellt in ihrem Bezug auf politische und gesellschaftliche Entwicklungen eine Möglichkeit dar, die Sichtbarkeit und Realitätsrelevanz der Forschungsdisziplin und der Literatur zu erhöhen.
Mit der Titelmatrix der „Moderne im Rheinland“ ist nicht nur der regionale und zeitliche Zugriff vorgegeben – Moderne und Rheinland –, sondern über diese auch die Frage nach dem Verhältnis von Subjekt, Objekt und Theorie. Ausgehend von dem Verständnis, dass Forschung eine Möglichkeit der Wissensproduktion ist, wie auch Literatur und Kunst Wissen produzieren, geht es hierbei um Distanz und Nähe. Mit dem Begriffsfeld der Moderne ist die Frage nach der Konstruktion und Auflösung von Spannungsfeldern wie Natur/Kultur, Anfang/Ende, Ich/Wir35 verbunden. Diesem Denken in Gegensätzen haben die epochemachenden Protagonist:innen z.B. im Monismus widersprochen:
Dieser Einheit der Natur entspricht vollständig die Einheit der menschlichen Naturerkenntnis, die Einheit der Naturwissenschaft, oder was dasselbe ist, die Einheit der Wissenschaft überhaupt. Alle menschliche Wissenschaft ist Erkenntnis, welche auf Erfahrung beruht, ist empirische Philosophie, oder wenn man lieber will, philosophische Empirie. Die denkende Erfahrung oder das erfahrungsmäßige Denken sind die einzigen Wege und Methoden zur Erkenntnis der Wahrheit.36
Der Monistenbund hat mit Louise Dumont, Hedda und auch Herbert Eulenberg, dem Mitbegründer der Künstlervereinigung „Das junge Rheinland“ wichtige Vertreter:innen, die in der Region lebten und diese gestalteten. Die Rekonstruktion von Wissensprozessen hat auch in den transcultural studies Relevanz. Dabei verstehe ich Transkulturalität ausgehend von Kultur als differenztheoretischem37 Begriff als Möglichkeit, Regionen nicht nur aus dem Kontext ihrer Grenze, sondern in der umgekehrten Denkbewegung, ihres komplexen Miteinanders zu verstehen. So hat der Literaturwissenschaftler und Japanologe Naoki Sakai für die Area Studies einen Forschungsansatz entwickelt, der mit der Matrix der „Filter of translation“ nach den Transferprozessen zwischen Begriffen und Theorien in der Wissenschaftsgeschichte fragt.38 Ausgehend von der Frage, welche Filter jede Übersetzungsleistung, sei es eine sprachliche, sei es eine regionale, sei es eine zeitliche, einzieht, und welche Inhalte hierbei verloren gehen, zeigt Sakai auf, dass der Begriff des Westens als Trope eine Denkbewegung animiert, die mit dem Westen das meint, was nicht der Rest ist: „The west and the rest“.39 Der Westen ist ein nur scheinbar geographischer Begriff, denn tatsächlich lässt sich sein geographischer Raum nur über die Abgrenzung zum ‚Rest‘ bestimmen und dieser ‚Rest‘ generiert sich aus der jeweiligen Redesituation, nicht als fester Bestand. Insofern ist Westen eine Trope, die Machtbewegungen konzipiert und die Basis hierfür bildet eine Geisteswissenschaft, die sich selbst im ‚Westen‘ verortet und diejenigen, die nicht Teil dieses Westens sind, im Forschungsfeld der Ethnologie zusammenfasst. In diesem Zugriff besteht ein qualitativer Unterschied darin, dass der Westen die Theorien und Methoden, um über sich selbst zu forschen ebenso entwickelt wie die Methoden, die benötigt werden, den ‚Rest‘ zu erforschen. Während der Westen im Bereich der Geisteswissenschaften also sowohl Subjekt der Forschung als auch Objekt ist, ist der Rest ausschließlich Objekt. Die „spectres of the west“ sind somit z.B. koloniale Selbstverständnisse als Basis in den methodischen und rezeptionsästhetischen Gedächtnissen sowie Ritualen unserer Geisteswissenschaften. Mit seinem Zeitschriftenprojekt Traces geht Sakai seit 2001 diesen Zusammenhängen nach und lädt neben weiteren Autor:innen auch Künstler:innen ein, sich dem Themenfeld zu nähern. Für das hier skizzierte Forschungsfeld der regionalen Literaturgeschichtsschreibung erscheint Sakais Ansatz zunächst zu stark im Kontext der amerikanischen Area Studies angesiedelt, die nach 1945 aus der politischen Situation des Kalten Krieges als interdisziplinäres Forschungsfeld aus Wirtschaftswissenschaft, Politikwissenschaft und Kulturwissenschaft gegründet wurden und Herrschaftswissen über andere Regionen und Nationen generieren sollten. Für die regionale Literaturgeschichtsschreibung können bei Sakai jedoch neben der Hantologie die Aushebelung der Distanznahme zwischen forschendem Subjekt und zu erforschendem Objekt übertragen werden; oder anders, die Frage, aus welcher Perspektive der Zugriff auf die Kulturtopographien erfolgt. Wissenschaftstheoretisch ist die Fragestellung brisant, macht sie doch den Transfer von Wissensproduktion und -transfer aus der Universität in andere Institutionen und in die Öffentlichkeit, z.B. Wikipedia, sichtbar und findet aktuell z.B. in Ansätzen und Begriffen wie artistic research, ästhetisches Denken, TheoryPractice oder der Transgression im Kontext von Avantgarde statt. In Mieke Bals Trias der Kulturanalyse – „kulturelle Prozesse, Intersubjektivität und Begriffe“40 – spiegelt sich die Befragung des Objektes und das notwendige Vermittlungspotential im Begriff der Intersubjektivität wieder. Wenn Gertrude Cepl-Kaufmann ihren Band 1919 – Zeit der Utopien. Zur Topographie eines deutschen Jahrhundertjahres als „Wimmelbild“ bezeichnet, so zielt sie damit auf eben dieses Miteinander von Theorie und Weiterschreibung ab. Bernhard Siegert hat in seiner Einleitung in das Cluster „Repräsentationen diskursiver Räume“41 drei mögliche Lesarten von Karten als Topographien gelistet:
Читать дальше