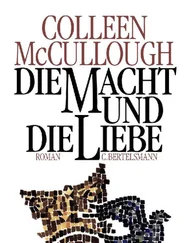Keti Ruadse ist eine perfekt runde Frau. Strahlend wie der Mond gibt sie Tina die mopsige Hand.
»Ich hatte wirklich nicht die Absicht, es zu lesen. Das ist keine Rechtfertigung, aber in der Nacht ist mir etwas passiert, was –«
»Die biographischen Daten sind so verzerrt, dass sich die Betroffene selbst nicht wiedererkennen würde. Die Erstellung von Fallstudien wird als eigenes Fach gelehrt. Wussten Sie das?«
»Wirklich? Nein … Also sind einige Beispiele ausgedacht?«
»Nicht ausgedacht. Die hier aufgezählten Fälle beruhen alle auf realen Biographien.«
»Alle?«
»Sie meinen den Sklaverei-Fall, nicht wahr? Das ist der wahrste von allen.«
Ruadse setzt sich im Innenhof des »Las Magas« mit dem Rücken zum ornamentverzierten Eisentor auf einen Stuhl. Über der Klimaanlage haben sich Tauben ein Nest zusammengekleistert. Gurrend flattern sie herum und der Tbilisser Staub rieselt von ihren Federn in den Cappuccino.
»Neun Fälle, schreiben Sie. Neun Fälle von Sexsklaverei gebe es in Georgien.«
»Das sind nur meine Fälle. Weiß Gott, wie viele es sonst noch gibt.«
»Ich schreibe unter anderem über Frauen; aber eher in internationalen Zeitschriften als in lokalen.«
»Von Journalisten werden wir meistens gemieden, ich weiß nicht, weshalb. Als unsere Fallzahlen stiegen, hat sich das Rehabilitationszentrum mit den Produzenten verschiedener Morgenmagazine in Verbindung gesetzt, aber nur Klatschmedien waren interessiert. Würden Sie sich als Journalistin mit diesem Thema auseinandersetzen? Eine der Betroffenen ist bereit, ein Interview zu geben. Sie lebt nicht mehr in Georgien und möchte den Vorfall, der lange zurückliegt, öffentlich machen.«
»Hmm…«
»In der Fallstudie ist sie als Natia aufgeführt.«
»Keine juristischen Probleme, oder?«
»Bei Natia?«
»Nein, generell.«
»Natia ist die Einzige, die sich dazu entschlossen hat, zu reden. Über so etwas wird normalerweise nicht gesprochen, wie Sie ja auch wissen.«
»Ist sie auch mit dem rechtlichen Teil einverstanden?«
»Tina, Natias Fall ist zwanzig Jahre her. Das kommt nicht mehr vor Gericht. Ich habe mich auf der Konferenz mit Juristen unterhalten, und ohne Beweismittel lägen die Chancen bei null, meinten sie. Wieso, wissen Sie mehr?«
»Ich weiß gar nichts, um ehrlich zu sein, ich habe mich noch nie damit auseinandergesetzt, aber … eine alte Freundin von mir ist Ermittlerin. Ich kann sie fragen, wenn Sie wollen.«
Der Stubentiger, ein »Las Magas«-Original, hatte sich längs auf dem Tisch ausgebreitet und seinen Schwanz in den braunen Aschenbecher getunkt. Teenager hatten einen Wald auf die Ziegelwand gemalt, der kaum von einem echten zu unterscheiden war. Ruadse flüstert, obwohl niemand außer ihnen im Hof ist.
»Macht Ihnen das nicht zu schaffen, sich jeden Tag so etwas anhören zu müssen?«
Die Psychotherapeutin rollt als Zeichen der Verwunderung ihre Augen gen Himmel; richtet ihren Blick nach einigen Sekunden aber wieder gerade:
»Ich mache Yoga«, entgegnet sie mit einer großen Geste, als würde sie einer Touristin eine Sehenswürdigkeit zeigen. Danach lässt sie ihren Blick noch einmal über den Innenhof schweifen und ergänzt: »Jeden Morgen.«
3. UNCHRISTLICHE BEDÜRFNISSE
In der Morgendämmerung kam der 16-jährige, spärlich bekleidete Lascha Tsertswadse grün und blau geprügelt in die erleuchtete Polizeistation am Stadteingang von Rustawi. Sein Vater habe ihn aus dem Haus geschmissen und er bräuchte Hilfe. Sozialarbeiter Berdia Mikiaschwili wurde um 7 Uhr früh in die Polizeistation bestellt. Der Notarzt hatte Lascha bereits untersucht. Trotz der Empörung der Polizisten weigerte sich der Junge, Anzeige zu erstatten. Stattdessen bat er um zwei Dinge: neue Socken sowie ein Gespräch mit seiner Mutter. Die Socken waren innerhalb von fünf Minuten aus dem benachbarten Hypermarkt besorgt; doch es gelang nicht, sich mit der Mutter in Verbindung zu setzen. Berdia telefonierte herum, aber in keiner Anlaufstelle für häusliche Gewalt war Platz. »Wir rufen zurück«, bekam er sechsmal zu hören. Niemand rief zurück. Lascha hatte sich bis über den Kopf in die Decke eingewickelt, die ihm der Inspektor gegeben hatte, und jedes Mal, wenn er sich eine Träne abwischte, fiel ihm ein Deckenzipfel aus der Hand – auch wenn er die zweite Hand zu Hilfe nahm. So litt er zwei Stunden lang, bis Berdia vorschlug, den Vater anzurufen und die persönlichen Gegenstände des Jungen abzuholen. Lascha fuchtelte mit den Armen, er werde niemals dorthin zurückkehren, lieber sollten sie ihn hier auf der Stelle umlegen. Berdia rief bei den Tsertswadses an, ein Mann nahm ab.
»Hallo, spreche ich mit Herrn Gega Tsertswadse?«
»Ja, bin dran.«
»Ich bin Berdia Mikiaschwili, der Sozialarbeiter Ihres Sohnes, Lascha Tsertswadse. Lascha befindet sich auf der Polizeistation, er ist außer Lebensgefahr. Allerdings hat er nichts zum Anziehen, bis auf seine Unterwäsche. Wäre es in Ordnung, wenn wir in etwa zehn Minuten vorbeikommen und seine persönlichen Gegenstände abholen?«
»Lascha Tsertswadse war mein Sohn, er ist heute Morgen gestorben. Rufen Sie hier nicht mehr an.«
Berdia hört dem Signalton nach dem Auflegen noch eine Weile zu. Das ist normal beim ersten Anruf, redet er sich zu und wählt noch einmal. »Die gewählte Rufnummer ist zurzeit nicht erreichbar.« Es vergeht eine weitere Stunde und Berdia fährt den in die Decke des Inspektors eingewickelten Lascha zu sich nach Hause. Die Großmutter öffnet die Tür. An ihrem Gesichtsausdruck lässt sich ablesen, dass sie es gewohnt ist, rausgeworfene Menschen zu beherbergen. Sie setzt Lascha auf das Sofa und lässt ein Bad ein. Kurz darauf hockt er eingeschrumpelt im schaumigen, heißen Wasser und schluchzt bitterlich. Die Tür zum Bad bleibt einen Spalt offen. So ist die Regel; von ihren Familien verstoßene junge Homosexuelle hegen manchmal unchristliche Bedürfnisse. Die Großmutter schenkt Tee ein, während sie aufgeregt mit ihrem Enkel schnattert:
»Den Hintern müsste man solchen Eltern versohlen! Noch nie habe ich jemanden mehr verabscheut als Putin, aber sogar den würde ich nicht mitten im Winter auf die Straße setzen! Haben diese Leute ihr Herz mit den Mandeln entfernt bekommen, mein Schatz?«
Das Frauenhaus weigert sich – sie wollen keine Jungen annehmen. In der Familien-Notunterkunft bringt Lascha es auf eine Woche, bis ihn der älteste Sohn einer von ihrem eigenen Mann herausgeworfenen Frau als »Arschwichser« verprügelt. Durch Lascha lernt Berdia die Schwierigkeiten schwuler Ästhetik kennen. Tasja beispielsweise, die die Gemeinde Vater Jakobs im ewigen Feuer des Kriegerdenkmals von Tbilissi verbrennen wollte, war zwar lesbisch, sah einem Jungen aber dermaßen ähnlich, dass sie auf der Straße höchstens mit »Hast du Feuer, man ?« angesprochen wurde. Transgender Andro Kuchianidse wurde von jedem für den Vater eines Betreuten gehalten; er war älter, breit und stämmig.
Laschas Verhängnis bestand darin, dass er genau in der Mitte zwischen den sozial anerkannten männlichen und weiblichen Geschlechtern stand. Seine Existenz erweckte nicht nur Misstrauen, sondern vor allem Irritation. Und da sich georgische Männer nicht unbedingt durch ihre Toleranz Irritationen gegenüber auszeichnen, hält ihre fragile Psyche diesem Druck nicht stand und sie müssen ihren Seelenfrieden geifernd wiederherstellen.
Jedes Monatsende bringt Berdia seine fünfhundert Lari, Münze für Münze, heim und nimmt sich davon jeden Tag ein kleines Taschengeld. Bei seinem Vorstellungsgespräch als Sozialarbeiter hatte er gelogen, er sei queer. Er dachte, so seien seine Chancen größer. Was hätte er sonst sagen sollen? Dass er weder mit einer Frau noch mit einem Mann je etwas gehabt hatte und außer seiner Großmutter mit niemandem etwas zu tun haben wollte? Er interessierte sich nun Mal nicht für Sex und damit basta. Er hatte auch nie Schmetterlinge im Bauch und überhaupt beschwerte ihn das körperliche Leben sehr. Er wartete sehnsüchtig auf die Ära, in der der Mensch digitalisiert würde und die Energie, die sein Hirn für körperliche Leistungen verschwendete, der Bewusstseinserweiterung widmen könnte. Er trug stets ein Portrait von Ray Kurzweil in seiner Hosentasche. Wenn der Alltag den Sozialarbeiter stärker plagte als gewöhnlich, griff er zu seinem Portemonnaie und rief dem Visionär des Transhumanismus zu: »Ray, wieso zur Hölle braucht das alles so lange?« Mit »das alles« meinte er die künstliche Intelligenz. Sie wird seiner sowie Kurzweils Meinung nach die Menschheit auf eine neue Evolutionsstufe hieven. Sozialarbeiter Berdia Mikiaschwili, Sohn des Solomon, plagt sein Körper sehr.
Читать дальше