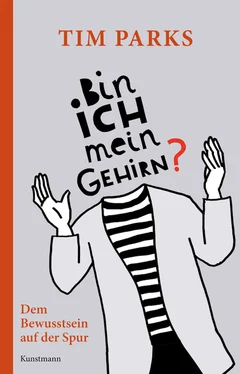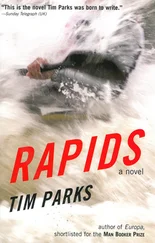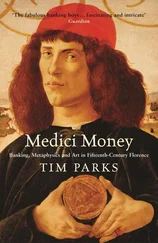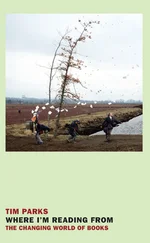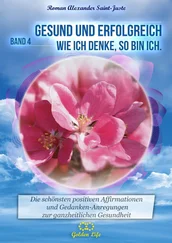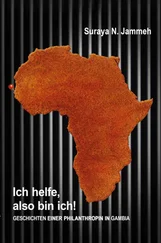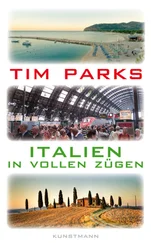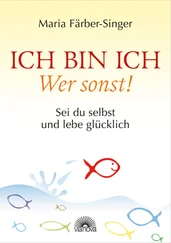1 ...6 7 8 10 11 12 ...17 Im Wesentlichen hat mir Pauen drei wissenschaftliche Forschungsberichte geschickt, einen über Gesichtserkennung bei Babys im Alter von neun Monaten, einen darüber, wie Kleinkinder sich Wissen über Werkzeuge und Utensilien aneignen, und einen, der untersucht, ob Einjährige anders reagieren, wenn ihre Reaktion auf einen Menschen oder ein Objekt durch einen Erwachsenen angeleitet wird. Die Terminologie ist teilweise beängstigend. Das Gesichtserkennungsexperiment wirkt anfangs ganz einfach, scheint kaum mehr zu umfassen als Babys, denen man Fotos zeigt, aber wenn man genauer hinschaut, wird es unheimlich komplex. Die Babys müssen im gleichen Alter sein, in etwa die gleiche ethnische Zugehörigkeit haben und der gleichen sozialen Schicht entstammen, und beide Geschlechter sollen gleich stark vertreten sein. Die Fotos müssen standardisiert und gründlich geprüft sein, sie zeigen ausschließlich weiße Gesichter von ähnlicher Form und Größe, mit neutralem Gesichtsausdruck, in ähnlicher Helligkeit und Farbgebung.
Die Abfolge ist entscheidend. Sollen die Babys »vorbereitet« werden, das heißt, soll ihnen ein Bild gezeigt werden, bevor der eigentliche Wiedererkennungstest beginnt, um die Testerfahrung von der vorhergehenden Erfahrung abzugrenzen? Wenn ja, soll dieses Vorbereitungsbild ebenfalls ein Gesicht zeigen, oder ein anderes Objekt, oder ein geometrisches Muster? Sollen den Babys gleich viele Männer und Frauen gezeigt werden? In welchem Alter? Abwechselnd oder zufällig gemischt? Sollen extrem hässliche oder extrem schöne Gesichter darunter sein, solche, die von der Konzentration auf männlich/weiblich ablenken? Wie lange soll jedes Foto gezeigt werden? Ein paar Millisekunden, eine Sekunde, zwei Sekunden? Wie oft sollen sich die Gesichter wiederholen, und sollen Wiederholungen in regelmäßigen Abständen oder zufällig erfolgen? Usw. usf.
Alle Babys müssen vor gleich großen Bildschirmen sitzen, im selben Abstand, auf dem Schoß der Mutter, aber die Mutter muss darauf achten, nicht mit dem Baby zu interagieren. Lässt sich das leicht gewährleisten? Während des Tests muss jemand überprüfen, ob das Baby tatsächlich auf den Bildschirm schaut, und wenn nicht, dann muss das notiert werden. Das Baby trägt dabei ein mit Elektroden gespicktes Haarnetz auf dem Kopf, damit in einem EEG die elektrischen Ströme unter der Schädeloberfläche aufgezeichnet werden können. Die Aufmerksamkeit liegt auf den mit der Gesichtserkennung verbundenen Wellenlängen, die übrigens nicht die gleichen sind wie bei Erwachsenen. Das Enzephalogramm wird mit der Diashow synchronisiert, sodass es hinterher leichtfällt, die Reaktionen den einzelnen Bildern zuzuordnen. Wenn das Kind nicht aufmerksam war, wird das Einzelergebnis ignoriert. Manchmal passiert auch noch etwas anderes, ein Schluckauf oder ein Juckreiz, und auch dann muss das Ergebnis verworfen werden. Manche Babys sind so wenig aufmerksam, dass die seltenen Momente, in denen sie es doch waren, nicht gewertet werden können, denn wie soll man die Gesamtwirkung der Bilderfolge, inklusive der Wiederholungen und so weiter, beurteilen, wenn das Baby nur einen Bruchteil davon angeschaut hat? Die Ergebnisse von 60 Prozent der getesteten Babys werden verworfen.
Sobald die Tests vorbei sind, beginnt die eigentliche Arbeit. Welche Wellenlängen wurden gemessen? Wie lange genau nach dem Zeigen jedes Fotos traten sie auf? Mit welcher Amplitude? Ist die Reaktion eine andere, wenn das Kind vorbereitet wurde? Ist die Reaktion auf männliche und weibliche Gesichter dieselbe? Bleibt die Reaktion gleich, wenn ein Bild wiederholt wird? Ist die Veränderung in der Reaktion bei männ lichen und weiblichen Gesichtern gleich? Hängt sie davon ab, ob das Kind männlich oder weiblich ist?
Um das alles erfassen zu können, musste ich mich einlesen in die Anatomie des Gehirns und die Enzephalografie – was genau kann ein Enzephalogramm uns sagen, wo sind die Grenzen seiner Aussagekraft – und mich dann an einige statistische Berechnungsmodelle erinnern, was die Aufzeichnung von Ergebnissen betrifft. Das war anspruchsvoll, aber auch faszinierend. Die wahnsinnige Detailgenauigkeit und die heiklen Voraussetzungen des Experiments an sich – ein Baby überhaupt dazu zu bringen, aufmerksam zu sein, die Mutter hinsichtlich der Elektroden am Kopf des Kindes zu beruhigen – sind schon außergewöhnlich. Und was, wenn die Person, die überprüft, ob die Augen des Babys auf die Fotos gerichtet sind, selbst einmal kurz wegschaut?
Das ist Wissenschaft. Die beharrliche Suche nach geregelten, vergleichbaren, wiederholbaren Bedingungen, damit man etwas immer wieder testen und schließlich mit hinreichender Sicherheit bestätigen kann. Man stellt eine Hypothese auf, die so formuliert wird, dass sie bewiesen oder widerlegt werden kann; in diesem Fall die Hypothese, dass Babys zwischen Männern und Frauen unterscheiden können, oder es jedenfalls tun, und daher schon vor dem Spracherwerb ein Bewusstsein für Kategorien besitzen; und weiterhin die Hypothese, dass Babys sich an ein Foto, das sie einmal gesehen haben, erinnern, und dass sich das an der Reaktion ihres Gehirn ablesen lässt, wenn sie das Foto zum zweiten Mal sehen.
Und so weiter. Hunderte, wenn nicht Tausende von Stunden sind in diese Studien geflossen, von denen jede einzelne auf einer Fülle vorhergehender Studien basiert, die in diesen neuen Studien alle gewissenhaft und wiederholt erwähnt werden, und von denen jede einzelne ein Team engagierter, hochgebildeter Mitarbeiter und teure, hoch entwickelte technische Geräte erfordert. Als ich mich auf den Weg zu meinem Interview mache, bin ich plötzlich verunsichert. Professor Pauen ist eine Autorität. Ich bin bloß ein Typ, der zwar selbst drei Kinder hat, sich an deren kognitive Fähigkeiten im Alter von neun Monaten, oder achtzehn Monaten oder zwei Jahren aber so gut wie gar nicht erinnern kann. Wie können wir normalen Menschen je dahinterkommen, worauf die Wissenschaftler in Sachen Gedächtnis, Wahrnehmung und Bewusstsein tatsächlich hinauswollen? Wäre es nicht besser, sich einfach ihrer Kompetenz zu beugen und sich von ihnen erklären zu lassen, wie das alles zusammenhängt?
Es regnet in Strömen. Meine frühmorgendliche Intuition war also richtig. An der Hotelrezeption stellt man mir freundlicherweise einen Regenschirm zur Verfügung. Ich hatte mir den Weg zum Interview auf Google Maps angesehen, aber jetzt scheinen die Straßen von Heidelberg nicht mit meiner Erinnerung übereinzustimmen. Ich habe kein Smartphone, aber ich habe die Karte auf meinem Computer gespeichert, der sich in meinem Rucksack befindet, eine Strategie, die der Philosoph Daniel Dennett gern als »outsourcing intelligence« (die Auslagerung von Informationen) bezeichnet und für eine der größten Errungenschaften der menschlichen Evolution hält; man übergibt Informationen an eine Reihe von Hilfsmitteln – Bücher, Einkaufslisten, Straßenschilder –, um nicht selbst an alles denken zu müssen und sein Gedächtnis dadurch zu überladen. »Supersizing the mind« (das Gehirn überdimensionieren) nennt es ein anderer Philosoph, Andy Clark.
Also bleibe ich unter einer Ladenmarkise stehen, klappe meinen Schirm zu, hole den Computer hervor und schalte ihn ein. Ich muss ihn mit einer Hand halten, um mit der anderen das Passwort einzugeben. Es dauert ewig, bis er hochfährt. Mir wird bewusst, dass mein rechter Schuh undicht ist. Ich habe diese Schuhe schon ziemlich lange. Ich gehöre zu den Menschen, die nur ungern Sachen austauschen. Mein Fuß wird nass. Dann klingelt mein Telefon. Einiges Jonglieren ist nötig, um es aus meiner Jeanstasche zu ziehen. Jetzt käme mir ein nicht-virtuelles Hilfsmittel gelegen, eine Krücke zum Beispiel. Es ist die Universität von Mailand. Mein Arbeitgeber. Soll ich rangehen? Nein. Komme ich zu spät zu meinem Interviewtermin? Höchstwahrscheinlich. Es gibt Philosophen und Neurowissenschaftler – viele –, die bestreiten, dass subjektive Gehirnzustände existieren. Angst, Schuld, Freude sind nur Wörter, die wir mit verschiedenen Verhaltensweisen verknüpfen. Wenn dieser sogenannte subjektive Zustand nicht mit einem beobachtbaren Verhalten oder zumindest mit einer mittels eines Enzephalogramms oder eines hoch entwickelten Prozesses der Gehirnabbildung objektiv verfolgbaren neuronalen Aktivität in Zusammenhang gebracht werden kann, dann können wir sicher sein, dass er nicht wirklich existiert. Dennoch, während ich mich weiterhin so verhalte, wie die meisten von uns es unter diesen Umständen tun würden, die Karte studiere, meinen Fehler finde – ich bin eine Ecke zu früh links abgebogen –, unter meinem Schirm weiterhaste und meinen undichten Schuh verfluche, ist mir sehr bewusst, dass ich gerade einen unangenehmen Gefühlscocktail erlebe, einen zermürbenden Mix aus Verwundbarkeit, Dummheit und schlechtem Gewissen. Warum ein schlechtes Gewissen? Weil es anmaßend von mir war, zu glauben, ich könnte diese ganzen Sachen je wirklich durchschauen. Und Zorn. Ich verschwende meine Zeit. Ich hätte mich nie darauf einlassen sollen.
Читать дальше