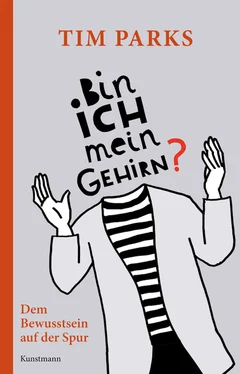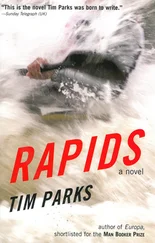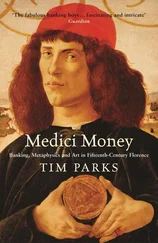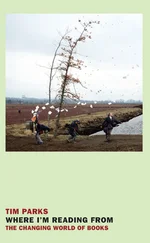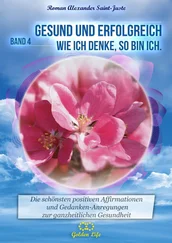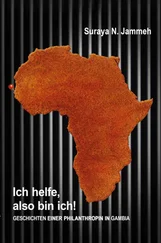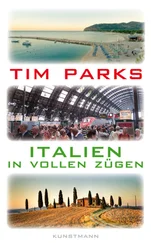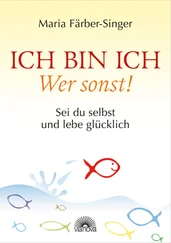Auch wenn es wenig überrascht, dass ein Pixar-Film nicht unbedingt das Nonplusultra in Sachen Psychologie, Ontologie oder Metaphysik ist, finde ich es doch interessant, dass Alles steht Kopf so breite Anerkennung fand und als innovativ, einsichtsvoll und lehrreich gepriesen wurde, und das, obwohl die arme Riley kaum mehr als eine Marionette zu sein scheint, die den Launen ihrer fünf inkompetenten Puppenspieler hilflos ausgeliefert ist. Entspricht das wirklich der Vorstellung, die die meisten Menschen von der Beziehung zwischen Körper und Geist haben? Noë bemerkt dazu:
Descartes (1596–1650) formuliert den Gedanken, den er allerdings nicht unterstützt, der Körper sei ein Schiff und das Ich hause im Körper wie der Lotse in diesem Schiff. Hume (1711–1776) brachte die Vorstellung voran, dass es kein Ich gibt, dass das, was wir das Ich nennen, tatsächlich nur ein Bündel von Wahrnehmungen, Gefühlen und Gedanken ist. Die zeitgenössische Kognitionswissenschaft verknüpft diese beiden Konzepte zu einer äußerst unbeholfenen Synthese: Wir sind das Gehirn, das wiederum nicht in Gestalt eines Ichs daherkommt, sondern als riesiges Heer von kleinen Ichs oder Instanzen, deren kollektive Handlungen das erzeugen, was von außen betrachtet so wirkt, als sei es ein und dieselbe Person.
Beim Lesen dieses Textes kann ich nicht umhin, Noë um seine synthetischen Fähigkeiten zu beneiden, die alles andere als unbeholfen sind, und ich frage mich, ob Sabina Pauen wohl Alles steht Kopf gesehen hat und bereit wäre, über die darin angesprochenen Themen zu reden, vor allem über die Frage, ob das bewusste Erleben tatsächlich im Kopf eingeschlossen ist und dadurch zustande kommt, dass kleine Menschen im Innern der Menschen einander wie durch Periskope betrachten (ein Effekt, der in Alles steht Kopf erzeugt wird, indem die Homunkuli ihre Augen benutzen, um Bildschirme anzuschauen, die das Material, das Rileys Augen wie Kameras einfangen, aufzeichnen). Oder ob es, das bewusste Erleben, irgendwie auch außen ist, oder zumindest aktiv aus Innen und Außen zusammengesetzt wird, aus der Person, die etwas erlebt, eine Erfahrung macht, und der Sache, die erfahren wird? Denn obwohl ich offiziell hier bin, um für Herrn Köllhofer einen Beitrag zu verfassen, der auf dessen Fragestellung eingeht, ob die Wissenschaft in den Köpfen der Menschen die Religion ersetzt – dafür erhalte ich die ansehnliche Summe von 10.000 Euro –, besteht mein tieferes Interesse doch darin, zu hören, was die Wissenschaftler, die ich treffen werde, von dieser Innen-Außen-Thematik halten, die im Grunde nichts anderes beschreibt als das Wesen unserer Verbindung zur Welt und das große Rätsel unserer Wahrnehmung in jedem einzelnen Augenblick: dass alles, was außen ist, wenn ich morgens die Augen aufschlage – die Wand, der Schrank, das Bettzeug, meine Partnerin –, sozusagen auch in mir ist, oder zumindest mir gegenwärtig, mir irgendwie eigen, und folglich an zwei Orten zugleich existiert, der Schrank im Zimmer und der Schrank in meinem Kopf. Wie kann das sein und was geschieht hier eigentlich konkret? Diese Frage beschäftigt mich, ist Thema meines langen Austauschs mit Riccardo Manzotti, Gegenstand unend licher Lektüre und in gewisser Hinsicht auch die Frage, die jeder Roman aufwirft: Wie passen das Erleben und die Erfahrungen der einzelnen Figuren mit der Welt als Ganzem zusammen, inklusive der Erfahrungen aller anderen Figuren? Wie stark sind wir voneinander getrennt, wie sehr miteinander verbunden? Inseln ganz für uns allein, oder Teile des Kontinents, Brocken des Festlands?
Bin ich also unter falschem Vorwand nach Heidelberg gekommen, oder greife ich zumindest die »ansehnliche Summe« quasi mit meiner ungelenken linken Hand ab, während meine (hoffentlich) kompetentere rechte mit etwas ganz anderem befasst ist? Nicht ganz. Denn nichts könnte wichtiger sein, wenn man sich die konkurrierenden Behauptungen von Wissenschaft und Religion anschaut, als die Frage, ob das Ich, der Geist, die Seele oder einfach das Bewusstsein, etwas Separates ist, das sich isoliert im Kopf befindet, oder ob es sich dabei um eine andauernde Zusammenarbeit zwischen dem Körper, dem Gehirn und der Welt handelt. Trifft Ersteres zu – ist der Geist abgetrennt und isoliert –, dann haben wir es mit dem Traum der Abstraktion zu tun, der Möglichkeit, dass das, was ich mir als »Ich« vorstelle, irgendwie vor dem letztendlichen, unvermeidlichen Verfall des Körpers gerettet werden kann, vielleicht gar in den Himmel aufzusteigen vermag, wie die Christen glauben, oder irgendwann in der Zukunft ganz einfach auf einen besonderen Computer hochgeladen werden kann, wie eine Reihe von Neurowissenschaftlern es für möglich halten. Wenn der Geist hingegen ein Phänomen ist, das von der Interaktion des Körpers mit der Welt abhängt, oder der Interaktion der Welt mit dem Körper, wenn er tatsächlich von dieser Interaktion abhängt und aufrechterhalten wird, dann endet zwangsläufig mit dem Tod des Körpers auch er.
Oder, wenn Ersteres zutrifft – der Geist von allem abgeschnitten im Kopf existiert, wo er Strippen zieht und Knöpfe drückt (allein oder im Team), um dem Körper Anweisungen zu erteilen –, dann wird unser Wissen über die Außenwelt immer Anlass für Misstrauen bieten. Wie kann ich eine Welt kennen, wenn ich nicht Teil von ihr bin, wenn ich in Platons Höhle gefangen und nicht in der Lage bin, die Realität draußen zu erleben, wenn ich Farben sehe, wo keine Farben sind, Gerüche wahrnehme, wo laut Galileo keine Gerüche sind? Ich mag auf das Paradies zusteuern oder potenziell auf Microchips unsterblich werden, aber meine Erfahrung wird, wie Christof Koch mir sagt, nichts als »Schwindel« sein. Ich bin eine Anomalie auf einem Plane-ten, der ganz anders ist, als ich ihn wahrnehme, ich bilde mir Sachen ein, die gar nicht da sind. Misstraue immer deinen Sinnen, rät uns Bacon. Es ist beunruhigend.
Aber wenn Letzteres zutrifft – wenn der Geist eine Folge der Begegnung zwischen Körper und Welt ist –, dann ist der Geist tatsächlich eins mit der Realität, denn dann ist der Geist das gemeinsame Geschehen von Körper und Umgebung, wobei die Umgebung natürlich auch andere Menschen mit einschließt; in diesem Szenario wird der Geist, der beileibe nicht isoliert und verblendet ist, zum Beweis einer realen Begegnung. In welchem Fall ich vielleicht nicht unsterblich bin, aber ebenso wenig einen Priester oder einen Neurowissenschaftler bräuchte, der mir sagt, was Sache ist. Meine Erfahrung ist das, was Sache ist. Sie geschieht tatsächlich.
Es hängt also einiges ab von Alva Noës vernichtender Kritik zu Alles steht Kopf , die, wie ich beim Downscrollen mithilfe des exzellenten WLANs im Hotel Panorama feststelle, von den meisten, die dazu einen Kommentar geschrieben hatten, gehasst wurde – zumeist Leute, die den Film charmant und unterhaltsam fanden und nicht verstehen, was der Philosoph für ein Problem damit hat; er ist ein Intellektueller, ein Langweiler, murren sie, obwohl die meisten aus dem Namen Alva schließen, dass es sich bei Noë um eine Sie und nicht um einen Er handelt. Sie stehen unter dem Einfluss kultureller Normen: Ausländische Vornamen, die auf »a« enden, sind normalerweise weiblich. »Die Frau braucht Hilfe!«, protestiert jemand. Und das, so wird mir klar, ist etwas, womit auch ich mich werde herumschlagen müssen, wenn ich behaupte, die derzeit gültige Standardsicht, nach der unsere bewusste Erfahrung im Kopf eingeschlossen ist, sei Unsinn. Die große Mehrheit der Leute scheint diese Vorstellung recht annehmbar zu finden. Sie besitzt den Status einer kulturellen Norm, wie die Sprache, die wir sprechen, oder unser Glaube an die Demokratie, oder schlicht und einfach gute Manieren. Dagegen anzukommen wird nicht leicht sein.
Aber die Zeit rast, und die guten Manieren verlangen jetzt von mir, zu meiner Verabredung um 10.30 Uhr nicht zu spät zu kommen. Laut Google Maps ist Sabina Pauens Büro nur fünf Minuten zu Fuß von hier entfernt, also gebe ich mir zehn. Folglich bleiben mir noch zwanzig, um meine Notizen durchzugehen.
Читать дальше