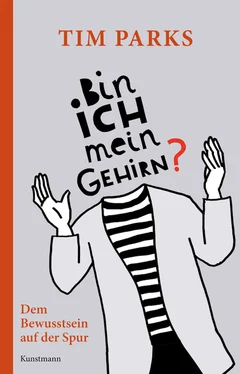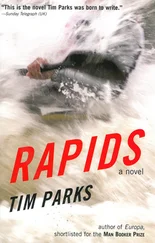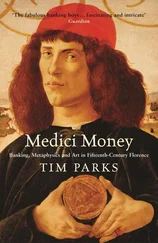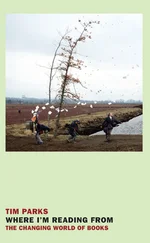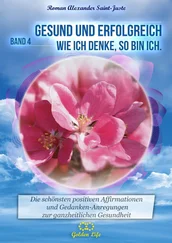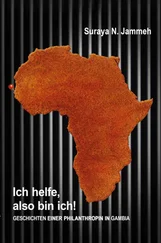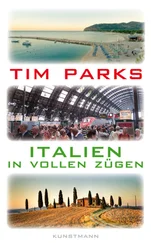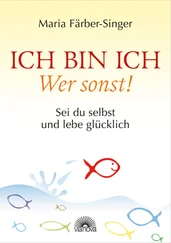1 ...7 8 9 11 12 13 ...17 Ist nun diese defätistische Stimmung, die mich beim Überqueren des Innenhofes eines ziemlich prächtigen alten Universitätsgebäudes plötzlich überfällt, ein reales Objekt in der materiellen Welt? Besitzt sie also eine physikalische Existenz, oder besitzt sie die nicht? Wenn ja, ist sie dann das Resultat des Zugriffs eines unseligen Homunkulus auf die Kontrollhebel in meiner Kommandozentrale da oben? Könnte man sie je mit einer schlauen Maschine an einer präzisen Stelle oder an mehreren präzisen Stellen in meinem Schädel verorten und messen? Oder besteht sie eher, wie der Philosoph David Chalmers meint, aus einem mysteriösen X-Faktor, der sich bisher noch jenseits unseres Wissenshorizonts befindet? Wie auch immer sich das verhält, dieses unselige, mit negativen Vorahnungen beladene Gefühl ist für mich jedenfalls äußerst präsent und real – ich fühle mich schlecht, also bin ich –, während ich die Treppe zum dritten Stock des Psychologischen Instituts der Universität Heidelberg hinaufsteige; und das, obwohl ich der Einzige bin, der je genau wissen wird, wie sich das Gefühl angefühlt hat, und obwohl es bis zum Mittagessen höchstwahrscheinlich wieder verschwunden sein wird. All das, und dazu noch mein feuchter Fuß. Ich hasse es, nasse Füße zu haben. Wie auch immer, ich werde mich durch diese miese Stimmung hindurchkämpfen müssen, wenn mein Interview erfolgreich verlaufen soll. Es gibt, so scheint es, ein Ich, oder ein Etwas, das jenseits defätistischer Stimmungen existiert und einfach weitermacht.
Zuerst eine breite alte Holztreppe, dann ein breiter Flur mit Holzboden. Geschliffene Dielen. Alles sehr deutsch. Pauens Tür liegt auf der linken Seite; ich bin sogar fünf Minuten zu früh da. Wie kann das sein? Folgt meine innere Uhr einer anderen Ordnung als die offizielle Uhr, ähnlich wie meine innere Temperatur nie mit der meiner Partnerin übereinstimmt? Der kleine Panikanfall mit dem Computer unter der tropfenden Markise kam mir ewig lang vor, hat aber in Wirklichkeit nur etwa ein oder zwei Minuten gedauert. Wenn das der Fall ist, war dann gar nichts real an meinem Eindruck, dass er lange dauerte?
Da ich das Gefühl habe, hinter der Tür Stimmen zu hören, setze ich mich auf eine Bank im Flur und ziehe noch einmal den Computer hervor, um einen letzten Blick auf meine vorbereiteten Fragen zu werfen. Eine junge Frau kommt und setzt sich neben mich. Ein Paar mit einem weinenden Baby tritt aus einer Tür gegenüber. »Dem Kleinen hat die Fotoerkennungs-Session wohl keinen Spaß gemacht«, sage ich zu der Frau neben mir. »Kann sein«, antwortet sie lächelnd. Es ist großartig, wie umstandslos die Deutschen bereit sind, Englisch zu sprechen. Stellen Sie sich mal vor, Sie sprechen in einer ähnlichen Situation eine englische Person auf Deutsch an und kriegen so eine prompte Antwort.
In den nächsten paar Minuten erzählt mir diese junge Frau davon, wie schwer es ist, die Babys dazu zu bringen, sich auf die Fotos zu konzentrieren. Aber es lohnt die Mühe, weil die Ergebnisse so faszinierend sind, die kleinen Gehirne so empfänglich. Als ein Paar mit einem Kleinkind auf dem Treppenabsatz erscheint, steht sie auf, um die Leute zu begrüßen, und führt sie zu einem Zimmer weiter hinten auf dem Flur. Um Punkt zehn Uhr, genau wie per E-Mail vereinbart, klopfe ich an die Tür, und eine Stimme bittet mich herein. Sabina Pauen ist allein im Zimmer. Hat sie vorhin mit sich selbst gesprochen? Oder war sie am Telefon? Oder habe ich mich getäuscht?
Sie ist eine attraktive Blondine im mittleren Alter mit einem freundlichen Lächeln. Ich setze mich, sodass wir uns über den Schreibtisch hinweg anschauen. Da wir beide nicht an solche Interviews gewöhnt sind, ist die Atmosphäre ein wenig gezwungen. Schon wieder flüchtige subjektive Gefühle; aber wie entspannt kann man sein, wenn man um zehn Uhr morgens mit einer völlig fremden Person eine Diskussion über das Bewusstsein führen möchte? Vielleicht wird jede ernsthafte Reflexion einem Erdrutsch gewöhnlicher Umstände abgetrotzt, kann das sein? Und jedes Buch gegen eine Flut von Ablenkungen geschrieben? Selbst die Wissenschaftler, die die objektive Existenz subjektiver Stimmungen bestreiten, wären gegen schlechte Laune aufgrund einer nassen Socke nicht immun. Obwohl mein eigenes Unbehagen jetzt vom Radar verschwunden ist, da ich mich dar auf konzentriere, eine freundliche Atmosphäre zwischen mir und dieser Frau herzustellen, teils in der Hoffnung, dass sie mir etwas Inter essantes erzählen wird, teils weil ich das immer tue, wenn ich mich mit jemandem treffe. Ich bemühe mich, freundlich zu sein. Das Deutsch-Amerikanische Institut hat sich da ein sehr ehrgeiziges Projekt einfallen lassen, sage ich zu ihr. Hat sie manchmal das Gefühl, dass die Menschen die Wissenschaft wie eine Religion behandeln?
»Auf jeden Fall hoffen sie immer, dass ich ihnen etwas Wichtiges sagen werde«, antwortet Doktor Pauen lachend.
»Vielleicht suchen sie nach Bestärkung durch eine Autorität?«
Fast ohne jede Vorrede sind wir schon mitten in unserem Thema. Pauen erzählt mir, dass verschiedene Verleger zum Beispiel scharf dar auf sind, dass sie ein Buch über ihre Arbeit schreibt, in dem sie erklärt, wie Kinder schon sehr früh im Leben Kategorien für Dinge, Tiere und Menschen einrichten.
»Sie möchten, dass ich ausformuliere, wie das Gehirn diese ersten Schritte hin zu Konzepten und Kategorien vollzieht.«
»Klingt gut.«
»Aber ich bin mir gar nicht so sicher, wie das genau geschieht. Wenn ich also ein Buch schreibe, dann nagele ich mich selbst auf eine Position fest, die sich sehr leicht widerlegen ließe. Ich würde dumm dastehen.«
War das nicht genau meine Sorge hinsichtlich des Samowars beim Frühstück gewesen?
»Die Leute wünschen sich von der Wissenschaft wasserdichtere Aussagen, als sie tatsächlich treffen kann«, vermute ich. »Ist es das?«
»Genau.«
Ich bin enttäuscht und ermutigt zugleich. Ermutigt, weil Sabina Pauen eine angenehme und gewinnende Art besitzt, mit der sie meine negative Stimmung schnell vertrieben hat, enttäuscht, weil sie mir offensichtlich nichts Bahnbrechendes darüber erzählen wird, wie Babys Konzepte entwickeln.
Sie fragt mich, ob ich die Texte gelesen habe, die sie mir geschickt hat, und ich sage, ja. Alle drei.
»Ich wollte Sie noch zum Gebrauch des Wortes ›Repräsentationen‹ fragen. Sie sagen in Ihrer Studie, dass Sie herausfinden wollen, wie lange ein Kind braucht, um ein Gesicht zu encodieren und eine Repräsentation dieses Gesichts zu etablieren.«
»Genau, das dauert länger als bei Erwachsenen. Erwachsene erkennen ein Gesicht innerhalb von Millisekunden; ein kleines Kind braucht dafür länger. Eine Sekunde vielleicht, oder anderthalb, im Alter von neun Monaten.«
»Aber in beiden Fällen gehen Sie also davon aus, dass es einen Code und eine Repräsentation gibt?«
Diese Frage erzeugt ein kurzes Schweigen. Dann sagt sie: »Das sind die Begriffe, mit denen wir die Tatsache beschreiben, dass das Kind von diesem Moment an anders auf das Gesicht reagiert, weil es das Gesicht schon einmal gesehen hat.«
»Aber es gibt keine Repräsentation im Kopf des Kindes. Ein Bild des Gesichts im Kopf, das vom Gesicht auf dem Bildschirm getrennt ist.«
»Nein, so meinen wir es nicht.«
Ich bin verwirrt. Was ist eine Repräsentation, wenn nicht ein Bild von etwas, das von diesem Etwas getrennt ist? Was ist ein Code, wenn nicht etwas, das dazu dient, eine verschlüsselte Version von etwas anderem zu erzeugen? Warum verwenden sie diese Worte, wenn das gar nicht gemeint ist?
»Es gibt also keinen Code und auch kein Bild, die im Gehirn abgespeichert sind?«
Dies wäre vielleicht der passende Moment, Alles steht Kopf zur Sprache zu bringen, wo Rileys Erinnerungen in verschlossenen, semi-transparenten Kugeln, jede so groß wie ein Krocketball, aber in verschiedenen Farben, die für verschiedene Gefühle stehen, aufbewahrt und in Regalen gelagert werden, die sich in einer Art riesigem, blitzsauberem Körperarchiv befinden. Aber ich fürchte, Professor Pauen könnte die Erwähnung des Pixar-Films als respektlos empfinden.
Читать дальше