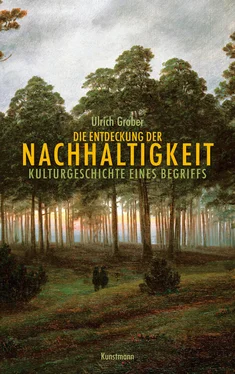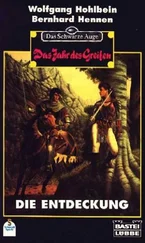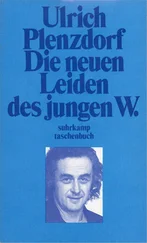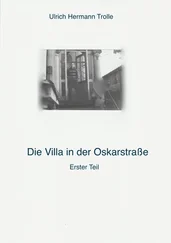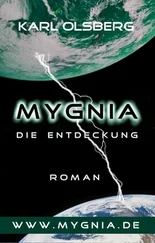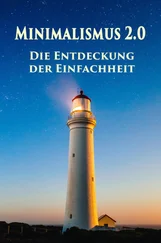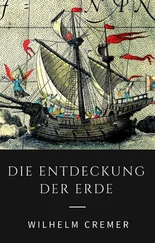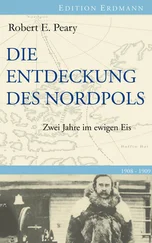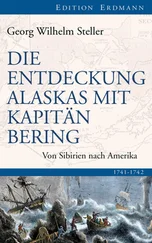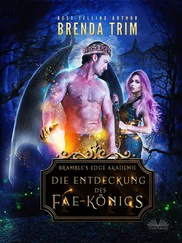Ein Jahr später, im August 1970, war ich nach einer mehrwöchigen Reise per Anhalter quer durch die USA, an der Westküste angekommen. Mit den Leuten, die mich aufgenommen hatten, fuhr ich am nächsten Abend von Berkeley über die Golden Gate Bridge nach San Francisco hinüber. In der lauen Sommernacht hörten wir Green River live von einer weit entfernten Bühne. Creedence Clearwater Revival spielten, wenn ich mich recht erinnere, ein Benefiz-Konzert zugunsten einer frisch gegründeten freien Drogenklinik, und ich lauschte atemlos ihrem Song: … you’re gonna find the world is smouldring / and if you get lost, come on home to green river . Wenn du das Gefühl hast, die Welt gerät in Brand, und du nicht mehr weißt wohin, dann komm heim an den grünen Fluss …
Meine Sternstunde als Rockfan hatte ich zwei Jahre vorher erlebt: Ich war – auch per Anhalter – nach Frankfurt am Main gekommen, um mich für das Wintersemester 1968/69 zu immatrikulieren. Abends spielten The Doors. Das Konzert in der Kongresshalle war kurz und ging tumultartig zu Ende. Nach dem provozierenden Song über den »Unknown Soldier« – mit einer dramatisch inszenierten, von Trommelwirbeln begleiteten Performance einer standrechtlichen Erschießung – verlangten ein paar der vielen anwesenden amerikanischen GIs wütend nach »Light my fire«. Als das Orgel-Intro einsetzte, drängte ein kleiner Trupp Soldaten zur Bühne und schwenkte seine Regimentsfahne. Jim Morrison riss sie ihnen aus den Händen und schleuderte sie mit einer obszönen Geste zerknüllt ins Publikum. Das war’s. Sofort nach dem Song ging das Licht an. Die Doors verließen die Bühne, das Publikum räumte den Saal. Ich blieb. Da ich noch keine Bude hatte und früh am nächsten Morgen nach Hause musste, wollte ich möglichst lange im Warmen bleiben. In der fast leeren Halle machten sich Beleuchter und Putzfrauen an die Arbeit. Doch dann kamen The Doors zurück auf die Bühne, nahmen ihre Instrumente wieder auf und begannen zu jammen.
When the music’s over . Im Mittelteil des Stücks ein sanfter Gitarrenlauf, ruhige Basslinie, verhaltener Gesang: Before I sink into the big sleep / I want to hear the scream of the butterfly. Hier ist nicht mehr wie bei Rachel Carson vom Lied des Rotkehlchens die Rede, sondern surrealistisch vom Schrei des Schmetterlings. I hear a very gentle sound, very soft, very clear. Und dann laut und klar die gesprochene Passage des Stücks: What have they done to the earth? What have they done to our fair sister? Den Krieg gegen die Natur imaginiert Jim Morrison auf der fast dunklen Bühne mal leise, fast verstummend, dann aufschreiend als Vergewaltigung der Erde. Was haben sie der Erde, unserer schönen Schwester, angetan? Ihr die Kleider vom Leib gerissen, sie gefesselt, zu Boden gezerrt, gebissen, ihr Messer in die Seite gestoßen, ihren Körper verwüstet und geplündert. Dann wieder leise: Ich höre einen ganz zarten Ton . Und wie ein Urschrei: We want the world and we want it … now. Now? Now! Gänsehaut pur!
Die Pyramide der Bedürfnisse
1970 erschien in den USA eine Neuausgabe von Abraham Maslows psychologischem Standardwerk »Motivation und Persönlichkeit«. Das Buch, schon in den 1950er Jahren in kleinen Kreisen berühmt, traf nun den Zeitgeist. Maslows Theorie der Grundbedürfnisse hat man in Form einer Pyramide abgebildet. Sie besteht aus fünf Ebenen, die von unten nach oben Bedürfnisse in eine durchlässige Hierarchie bringen. Die Basis bilden die unabweisbaren, das Überleben sichernden körperlichen Bedürfnisse: Nahrung, Wasser und Luft, ein Dach über dem Kopf, die Befriedigung der sexuellen Triebe. Sind diese grundlegenden Bedürfnisse angemessen befriedigt, ist das Grundvertrauen gelegt, sie stets angemessen befriedigen zu können, treten sie im Bewusstsein des Individuums zurück. In den Vordergrund rückt ein neues Bedürfnisensemble: das Streben nach Sicherheit und Geborgenheit, körperlicher Unversehrtheit, Stabilität und Angstfreiheit. Dann folgt die Ebene, auf der die soziale Akzeptanz des Individuums durch seine Umwelt höchste Bedeutung erlangt. Hier geht es um ein Netz liebevoller zwischen menschlicher Beziehungen, um Zuneigung, Zugehörigkeit zu einer Gemeinschaft und um deren Zusammenhalt. Im Anschluss daran wird der Wunsch nach Herausbildung eines stabilen Selbstwertgefühls mächtig. Respekt und Wertschätzung durch andere rücken in den Vordergrund. Wobei der Respekt, den man sich tatsächlich verdient hat, das Gefühl der Selbstachtung am sichersten stabilisiert. Das Bedürfnis nach Schönheit und das Interesse an Wissen und Erkenntnis kommen ins Spiel.
An der Spitze der Pyramide steht das Bedürfnis nach Selbstverwirklichung (self-actualization). Es wird zu einer wesentlichen Trieb kraft von Fühlen, Denken und Handeln und kann sogar alle anderen Bedürfnisse zurücktreten lassen. Es bezieht sich auf das zutiefst humane Streben nach einem erfüllten Leben. Mit Nietzsches Lebenskunst-Motto »Werde, der du bist« umreißt Maslow die Bedeutung des neuen Begriffs. Ein Musiker müsse Musik machen, ein Künstler malen, ein Dichter schreiben, um im Einklang mit sich selbst zu leben. Selbstverwirklicher seien Menschen, die sich und ihre Umwelt mit allen Schwächen und Stärken präzise wahrnähmen und grundlegend akzeptierten. Sie verfügten über innere Autonomie und ein stabiles Gemeinschaftsgefühl, über eine große Offenheit und die Fähigkeit, die Fülle des Lebens wahrzunehmen und zu genießen. Sie seien von überzogenen Scham- und Schuldgefühlen unbelastet und vom Urteil anderer unabhängig. Sie seien jedoch fähig, tiefe Bindungen zu anderen Menschen und zur Natur einzugehen. Der Widerspruch zwischen Selbstbezogenheit und Selbstlosigkeit verschwinde. Selbstverwirklicher widmeten ihr Leben der vollständigen Entwicklung und Ausschöpfung ihrer Anlagen, Möglichkeiten und Potenziale. Fremden und unbekannten Erscheinungen würden sie nicht mit dem Gefühl der Furcht und der Abwehr, sondern mit Neugier, Staunen und Ehrfurcht begegnen. Sie seien problemzentriert und an Lösungen interessiert. Das Geheimnisvolle, das Neue, das Fremde würde sie anlocken und begeistern. Sie folgten der inneren Stimme und einer Berufung, die in der Regel von außen, aus der Gesellschaft komme. Das Streben nach Exzellenz, nach Gipfelerfahrungen und dem Erlebnis der Einheit mit Natur und Kosmos seien wesentliche Elemente von Selbstverwirklichung.
Das Konzept war nicht neu. Maslow hatte es bei dem 1933 in die USA emigrierten deutschen Neurologen und Psychiater Kurt Goldstein gefunden. Der Grundgedanke aber war schon im Bildungsideal der deutschen Klassik angelegt. Wilhelm von Humboldt hatte ihn ausformuliert: Die Entwicklung aller Keime …, die in der individuellen Anlage eines Menschenlebens liegen, halte ich für den wahren Zweck des menschlichen Daseins.
In bewusster Abkehr von den klassischen Schulen der Psychotherapie richtete Maslow den Fokus auf die Faktoren, die seelische Gesundheit und ein gelungenes Leben ausmachen. Unter diesem Aspekt suchte er Versuchspersonen aus. Er ging in die Indianerreservate und interviewte Menschen, die noch nach dem traditionellen Wertekanon ihres Stammes lebten. Er untersuchte die Biografien starker Persönlichkeiten, unter anderem die von Albert Schweitzer, Spinoza und Goethe.
Alle fünf Ebenen seiner Pyramide erfassen Bedürfnisse, die jeder Mensch verspürt. Eine aufsteigende Linie führt zu den »Metabedürfnissen«. Die Stufe der Selbstverwirklichung sei zwar nicht allen möglich, für die Gestaltung einer »good society« sei jedoch entscheidend, dass jeder die gleiche Chance bekäme, einen Zugang zur jeweils höheren Stufe zu bekommen. Hier liegt das dynamische Prinzip in Maslows Hierarchie der Bedürfnisse. Im menschlichen Organismus und im menschlichen Geist existiere eine Tendenz zum inneren Wachstum, zur Verwirklichung aller seiner Fähigkeiten, zu Gipfelerfahrungen. Erst diese Art Wachstum »über sich hinaus« ermögliche Reichtum des inneren Lebens und tieferes Glück. Das gute Leben hängt nun nicht mehr von der Befriedigung der biologischen Grundbedürfnisse durch ein immer größeres Quantum an Waren ab. Entscheidend werden die sinnstiftenden immateriellen Güter, Aktivitäten und Ziele. Armutsbekämpfung ist nicht mehr nur die Beseitigung des Mangels an Gütern und Dienstleistungen. Es geht jetzt auch darum, die Vielfalt kultureller Ausdrucksformen und Identitäten zu erhalten und allen Menschen vielfältige Möglichkeiten zu eröffnen, ein erfülltes Leben zu führen.
Читать дальше