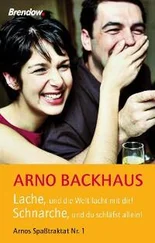Und dann passierte es doch noch: die Horrorbotanik fiel. Wie ist das, wenn ein Wunder geschieht? Unbeschreiblich, also halten wir uns an die Fakten: Es war ein schmuddeliger Tag früh im Jahr, als es hier plötzlich hell wurde. Der Himmel kam wieder in Sicht, es wurde buchstäblich Licht, und es wurde mit jedem fallenden Baum lichter. Einer der größten Tage meines Gartens – und wer hätte je gedacht, dass der ausgerechnet in den Februar fällt? Ich brauchte lange, um mein Glück zu fassen, und dem Garten schien es ganz ähnlich zu gehen: Es sah aus, als blinzelten die kahlen Obstbäume unter der ungewohnten Helligkeit. Wenn das schon im Winter so überwältigend war, wie strahlend würde wohl erst der Frühling ausfallen …? Prompt erwischte mich, was in dieser Lage wohl jeden Gärtner erwischt hätte: der dringende Impuls, zum Saisonstart eine botanische Großbestellung aufgeben – nun, wo ich doch endlich wieder einen Garten hatte! Allerdings: Es war einer, den ich so überhaupt noch nicht kannte und der jetzt sozusagen falsch herum lag. Die überlebenden Schattenpflanzen hatten nun die offene Südseite, die, die ich auf die letzten Lichtflecken in Ost und West umgesiedelt hatte, drängten sich plötzlich an den dunkelsten Stellen. Der Kompost lag mitten in der Sonne, das Gewächshaus im Apfelbaumschatten, der bisher der lichteste Fleck auf dem Grundstück gewesen war. Und wie alles aussehen, wie Licht und Schatten fallen würden, sobald die Obstbäume austrieben, konnte ich zunächst nur ahnen. So verschob ich den grünen Konsumrausch aus schließlich schierer Neugier: Bevor ich umzubauen begann, wollte ich einfach sehen, was passieren würde, wenn im Revier buchstäblich die Sonne aufging, wenn die Letzten plötzlich die Ersten waren.
Was dann geschah? So etwas wie das nächste Wunder: Alles startete durch, als gelte es, die verlorenen Jahre in einer Saison aufzuholen. Das erste Mal seit langer Zeit konnte ich mir wieder Tomatentöpfe auf die Südterrasse stellen, die sogar trotz eines nassen Sommers Früchte trugen. Die letzten Rosen blühten wie nie zuvor, und statt verpilzt zu schmollen, präsentierte der Weißwein an der Hauswand dicke süße Trauben. Mein kleiner Quittenbaum brachte nach acht Jahren Schattendasein die ersten samtigen Früchte. Die Hühner, ebenfalls jäh mit einem sonnigen Revier beglückt, besannen sich darauf, dass die Legeleistung von der Lichtintensität abhängt, und schütteten uns mit Eiern regelrecht zu. Sogar die Totgeglaubten kehrten zurück: Das arme Birnbäumchen, lange ein Muster für tapferen Überlebenswillen unter widrigsten Umständen, hatte den ungleichen Kampf aufgegeben, als der Nadelüberhang es regelrecht krummschubste. Seine Krone war bis auf zwei Rest äste abgestorben. Und jetzt, ganz unerwartet, hatte der jämmerliche Underdog in letzter Sekunde doch noch über die brutale Übermacht triumphiert. Seine beiden Äste badeten förmlich frei im Frühlingslicht, blühten duftig und trugen im Herbst sogar stolze drei Birnen. Der mickrige Stamm trieb kräftig neu aus, und so gibt es jetzt die begründete Hoffnung, dass das Bäumchen es mit der Zeit sogar schaffen könnte, noch einmal eine neue Krone aufzubauen.
Genau das ist das Tolle an diesem Privatwunder im Hinterhof: Träumen ist wieder erlaubt. Natürlich können viele dieser Blütenträume auf dem begrenzten Raum nicht reifen, aber es gibt endlich wieder Möglichkeiten, so, als hätte ich einen ganz neuen Garten geschenkt bekommen. Ich kann den Winter wieder mit vergnüglichem Plänemachen verbringen, und trotz aller Zurückhaltung: Zwei neue Rambler sind natürlich längst da und haben auch schon gut durchgetrieben. Wenn sie jetzt auch noch den Winter überleben, wäre das ein rundum perfekter Start in die neue Saison – mit einem Garten, der das Wichtigste endlich zurückbekommen hat: das grüne Prinzip Hoffnung.
Zwei Gartenhühnchen sind wunderbar, aber doch nur ein Anfang. Weshalb das so ist, hat meine goldbraune Chefhenne Henriette unüberhörbar deutlich gemacht: Sobald Schwester Hermine zum Eierlegen im Stall verschwand, schrie sie umgehend Zetermordio. Die Botschaft war klar: Alleinsein bedeutet Hühnerhölle pur. Also gab es hier Verstärkung, sobald der Züchter unseres Vertrauens Junghennen abzugeben hatte. Ich durfte unter mehreren »Gartenkandidatinnen« wählen, und eine stattliche Schwarze mit käfergrünen Glanzlichtern im blanken Gefieder erwies sich dabei als so etwas wie meine Liebe auf den ersten Blick.
Während die anderen Junghennen angesichts der Fremden nervös in ihren Trainingskäfigen zu trippeln begannen, kam diese eine einen Schritt vorwärts, richtete sich zu ihrer ganzen abgerundeten Wyandottenschönheit auf und musterte uns gelassen. In ihren glänzend orangefarbenen Augen lag dieses leicht spöttisch wirkende, distanzierte Interesse, das mich im mer vermuten lässt, dass Hühner auf unsere seltsame, riesige Spezies ebenso neugierig sein könnten wie wir auf ihre originelle kleine. Diese füllige, blanke Schönheit kam also als Gartenhuhn Hulda mit. Begleitet wurde sie von der blauen Hedwig. Die war etwas kleiner und schüchterner, aber ein bestechend hübscher Kontrast zu der Schwarzen, trug sie doch sanfte Rauch- und Taubenfarben zu einem feingezeichneten, fast schwarzen Spitzenkragen.
So entzückt ich von den beiden war, so entsetzt war Chefin Henriette. Als sie abends die Fremden in ihrem Stall – in ihrem Stall! – erblickte, reagierte sie wie von einem Schlag getroffen: Sie stoppte abrupt, ihr Gesicht lief tief kirschrot an, und sie kreischte, wie es nur Henriette kann. Sie schrie derart zornig, markerschütternd und anhaltend, dass vermutlich nicht nur die Nachbarschaft, sondern sogar ich sehnsüchtige Gedanken an Hühnersuppe kaum unterdrücken konnte. Es folgte ein kurzer, heftiger Schlagabtausch mit der dicken Hulda, während Hedwig eilends die Flucht ergriff. Henriette, immerhin ein Jahr älter, behielt leicht die Oberhand über die Junghennen, und auch ihrer Schwester Hermine mussten sich die Neuen sofort unterordnen. Damit war das Wesentliche ausdiskutiert, und nach einem Abend Gacker-Vollalarm saßen Hulda und Hedwig schon zur Nacht ruhig mit auf der Stange. Zwergwyandotten sind erstaunlich friedfertige Hühner, verschwenden nur ungerne unnütz Kalorien, und so war alles schnell geregelt: Das Quartett ging einander im Garten zunächst paarweise aus dem Weg, sonnte sich aber gemeinsam, und kam so reibungslos miteinander aus.
Hulda allerdings wollte mehr. Der angespannten »Ist-das-jetzt-endlich Beute?!«-Annäherung von Terrier Erbse begegnete sie auf eigenwillige Weise: Sie ernannte die überrumpelte kleine Hündin umgehend zu ihrer neuen besten Kumpanin. Was für Huhn Hulda durchaus lebensgefährlich war, denn es hatte mich Wochen gekostet, die weiße Jägerin von schierer Mordlust zu halbwegs selbstverständlicher Akzeptanz der neuen Gartengesellschaft zu bewegen. Dass die Aktion »Koexistenz statt Frikassee« hier überhaupt so erstaunlich gut klappt, ist nicht nur Erbses entgegenkommender Freundlichkeit zu verdanken, sondern auch der rassetypischen Gelassenheit der Wyandotten. Kommt ihnen der Hund zu nahe, weichen sie einfach ruhig aus. Kein großes Gackern, Flüchten und Flattern – bei solchen Reizen hätte sich Erbse wohl nur sehr schwer von einem Zugriff abhalten lassen.
Ein Privathuhn hatte allerdings keinesfalls auf dem Terrier-Plan gestanden. Aber genau das hatte Erbse jetzt, denn Hulda erwies sich als beharrlich: Wo im mer der Hund auftauchte, war der schwarze Schatten nicht weit. Die kleine, runde Henne kam sogar eilig die Treppe hoch, sobald sie Erbse hinter der Glastür sah, rannte ihr bis zur Gartenpforte entgegen, wenn wir vom Spaziergang zurückkehrten, und pickte zufrieden in ihrer Nähe, sobald sie sich draußen zum Sonnen ausstreckte. Was blieb meiner kleinen Hündin also übrig, als sich an ihre neue Rolle als Hühner-Vorbild zu gewöhnen? Inzwischen sitzt Erbse gern aufrecht wie ein stolzer Hütehund zwischen den beiden Jung hennen, und das Trio bettelt gemeinsam. Erbse verschlingt jetzt, wenn auch mit spitzen Zähnen, rohe Karottenstückchen, und die gefiederten kleinen Sauriernachkommen freuen sich über jedes Häppchen Fleisch.
Читать дальше