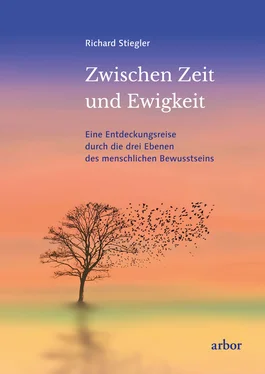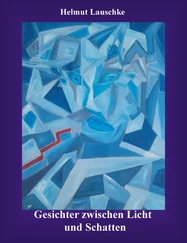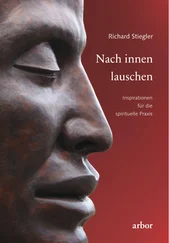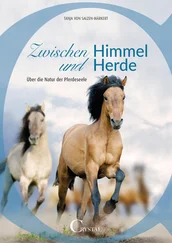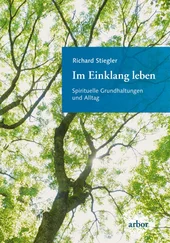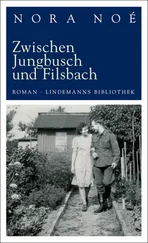So wie wir Bilder konstruieren und uns damit in der Welt »sehend« zurechtfinden können, erzeugt das Gehirn auf allen Ebenen durch seine vielfältigen Muster das Erscheinen einer geordneten Welt. In jedem Augenblick unseres Lebens setzen wir die verschiedenen Wahrnehmungen zusammen, ergänzen sie mit gedanklichen Zuschreibungen aus alten Erfahrungen und kreieren damit eine einheitliche Welt, die geordnet und damit handhabbar ist. Genau diese Fähigkeit unseres Gehirns, Muster auszubilden und damit eine solide, objekthafte und zusammenhängende Welt zu konstruieren und sich darin zu bewegen, ist die Grundlage für die Bewusstseinsebene der Alltagsrealität.
Geistige Muster zu erschaffen ist daher ein wunderbarer Mechanismus des Lebens, der es uns als Menschen überhaupt erst ermöglicht, zu existieren und unser Leben zu gestalten. Diese Muster können jedoch gleichzeitig immer mehr einrasten und zu Gehirnautobahnen werden, die uns zunehmend auf eine bestimmte Weltsicht einengen. Auch dazu ist unser Gehirn fähig. Wir können beobachten, dass manche dieser automatisierten Muster und gedanklichen Zuschreibungen uns so stark besetzen können, dass sie neue Erfahrungen oder aktuelle Wahrnehmungen teilweise oder sogar komplett überlagern.
Das hört sich dramatisch an, ist aber ein vollkommen gewöhnlicher Vorgang. In aller Regel nehmen wir zum Beispiel unsere Wohnung nicht mit neuen, unvoreingenommenen Augen wahr. Das Gehirn vergleicht jedes Objekt mit alten ähnlichen Erfahrungen und lässt nur das bekannte Bild bzw. das alte, automatisierte Muster unserer Wohnung im Bewusstsein auftauchen. Die gegenwärtigen, neuen und vielfältigen Erfahrungen werden dabei weggefiltert. Für einen gewöhnlichen Alltagskontakt, bei dem eine oberflächliche Bezugnahme genügt, ist dies vollkommen ausreichend. Mehr noch: Für eine schnelle Bezugnahme oder Handlung sind zu viele Informationen kontraproduktiv.
Wenn wir zum Beispiel beim Autofahren die Details einer Landschaft und die Wolkenstimmung bewundern und zusätzlich dabei noch das Atmen und die subtilen körperlichen Empfindungen genießen würden – so, als würden wir sie zum ersten Mal spüren –, wäre unser Gehirn überlastet und die Funktionalität beim Fahren stark eingeschränkt. Erst wenn das Gehirn alle unwesentlichen Eindrücke für eine Aufgabe herausfiltert und unser Geist sich auf die bekannten und für das Autofahren relevanten Wahrnehmungs- und Handlungsmuster bezieht, sind wir effektiv.
Die Problematik dabei ist jedoch, dass diese Filterfunktion des Gehirns kaum mehr neue Erfahrungen zulässt. So kann es schleichend geschehen, dass die bekannten Muster und Bilder immer mehr unser Erleben bestimmen und wir uns dadurch nur noch scheinbar auf eine Außenwelt beziehen. In Wirklichkeit sind wir in einer Innenwelt von bekannten Bildern, Zuschreibungen und Mustern – in einer Gedankenwelt – gefangen. Diese hausgemachte Isolation beschreibt Martin Buber anschaulich als eine »Ich-Es-Beziehung«, in der keine unmittelbare, echte Begegnung mehr stattfindet. Wir treffen hier nur noch auf eine geistige Reflexion, die wir auf das Gegenüber projizieren. Dadurch fühlt sich der Kontakt zwar vertraut und sicher an, gleichzeitig wird er aber auch ein wenig schal, wie abgestandenes Wasser.
Erst wenn ein Ereignis stark genug ist und uns emotional berührt, sodass es uns aus unserer Gedankenwelt wieder aufweckt oder vielleicht sogar aufrüttelt, wird das Ereignis im Gehirn als neu behandelt und die unmittelbaren Eindrücke dazu dringen wieder zu uns durch. Für einen Augenblick treten die geistigen Filter zurück und die Pforten der Wahrnehmung öffnen sich. Dabei können neue Verknüpfungen im Gehirn entstehen und das kreative Potenzial – seine Fähigkeit zur Umstrukturierung – tritt in Aktion. Erst hier können wir von einer echten Begegnung sprechen, oder wie Martin Buber es nennt: einer »Ich-Du-Begegnung«. Erst dann erreicht uns nämlich wieder die Einzigartigkeit des Augenblicks und wir erfahren den Kontakt als frisch und neu.
Müssen wir nun darauf warten, dass ein emotional aufwühlendes, dramatisches Ereignis uns aufweckt und die Filter im Gehirn zur Seite schiebt? Oder sollten wir die Dramatik lieber selbst erzeugen? Vielleicht durch eine abenteuerliche Fernreise in ein exotisches Land, einen bewegenden Film auf Großleinwand oder durch extreme Verausgabung im Sport? Oder gibt es noch andere Möglichkeiten, aus der Hypnose einer Alltagsrealität mit all ihren bekannten Mustern und gedanklichen Zuschreibungen auszusteigen?
Wenn wir uns der hypnotischen Dynamik der Alltagsrealität bewusst sind und ihre Symptome kennen, können wir mithilfe unserer Aufmerksamkeit die Bewusstseinsebene wechseln und in die kreative Innenwelt der Seelischen Realität oder in die Stille der Absoluten Realität eintauchen. Die Pforte der Gegenwart steht uns in jedem Augenblick zur Verfügung, und jedes Mal, wenn wir sie durchschreiten, um in die Tiefendimension unserer Seele oder in die Weite und Offenheit des absoluten Bewusstseins einzutauchen, lassen wir die Alltagsrealität mit all ihren schalen Zuschreibungen und funktionalen Mustern zurück. Wenn wir uns dann wieder dem alltäglichen Leben mit seinen Pflichten und Anforderungen zuwenden, fühlen wir uns im wahrsten Sinne des Wortes »beseelt« und innerlich erfüllt. In der Folge entsteht auch im gewohnten äußeren Umfeld wieder eine neue Wachheit.
Ich und die Ich-Identität
In der Alltagsrealität leben wir in einer äußeren einheitlichen Welt mit vielen konkreten, handhabbaren Objekten, in der wir uns orientieren und bewegen können. Diese Fähigkeit unseres Gehirns, eine strukturierte, geordnete Realität zu konstruieren, richtet sich aber nicht nur nach außen, sondern auch auf uns selbst. So wie wir eine handhabbare äußere Wirklichkeit erschaffen, konstruieren wir parallel dazu eine Ich-Identität, die unsere Innenwelt strukturiert. Sie ist genauso ein Teil der Bewusstseinsebene der Alltagsrealität und wird ebenso wenig hinterfragt wie die Muster und Zuschreibungen, die unsere Sinneswahrnehmungen überlagern und eine kohärente äußere Welt erzeugen.
In beiden Fällen ist die grundlegende Motivation die gleiche: Wir müssen den komplexen und chaotischen Dschungel aus Sinneswahrnehmungen, Gefühlen und Gedanken, dem wir ausgesetzt sind, bändigen und strukturieren. Erst dadurch kann eine Ordnung entstehen, die uns Halt und Sicherheit vermittelt und eine gewisse Orientierung und Kontrolle ermöglicht. Zu keinem anderen Zweck bilden wir in den ersten Jahren unseres Lebens ein Ich aus, das dann zeitlebens im Mittelpunkt unserer persönlichen Welt steht.
Wie bedeutsam die Ich-Identität ist, können wir nur ermessen, wenn wir uns bewusst machen, dass sie das Zentrum unserer Innenwelt darstellt. Solange wir uns auf der Bewusstseinsebene der Alltagsrealität bewegen, wird jede Erfahrung mit dem Ich in Beziehung gesetzt. Die Erfahrung zum Beispiel des Gehens oder des Hörens wird automatisch dem Ich zugeschrieben. Folglich denken wir »ich gehe« und »ich höre«. Obwohl normalerweise die Funktion des Gehens vollkommen automatisiert abläuft und das Hören ohnehin eine Fähigkeit des Körpers ist, die wir weder herstellen noch abschalten können, werden beide Erfahrungen mit dem Ich verknüpft. Mehr noch: Sie werden regelrecht von der Ich-Identität okkupiert.
Umgekehrt werden viele Sinneseindrücke, die im Grunde genauso Teil unserer Innenwelt sind wie die Erfahrung des Gehens, nach außen projiziert und bestärken auf diese Weise im negativen Sinne das Ich. Wir sehen einen Vogel und denken: »Dieser Vogel ist ein äußeres Objekt. Das bin ich nicht.« Jedes Element, das ich nicht bin, bestätigt indirekt den Bereich, der ich bin. Es entsteht eine Innenwelt, mit der ich mich identifiziere, und eine Außenwelt, die von mir getrennt ist. Dabei sind die Worte »Innenwelt« und »Außenwelt« keinesfalls so klar definiert, wie sie im ersten Moment erscheinen, denn, wie wir noch sehen werden, gibt es durchaus viele Dinge im Außen, wie zum Beispiel unser Besitz, mit dem wir genauso identifiziert sind wie mit unserem Körper.
Читать дальше