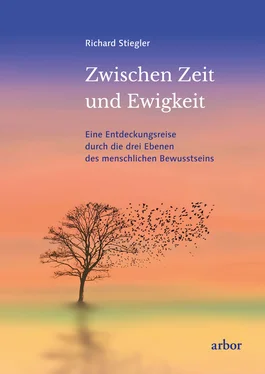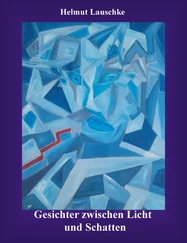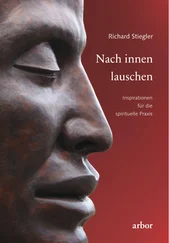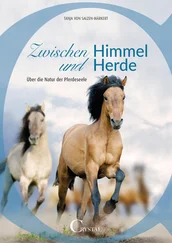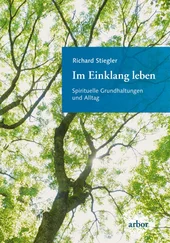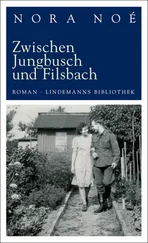Kontrolle und Selbstüberschätzung
Eine weitere Schwierigkeit, die sich automatisch aus der Alltagsrealität ergibt, ist eine Ausrichtung auf Kontrolle. Wie bereits benannt, ist die Grundmotivation der Konsensusrealität auf Funktionalität ausgerichtet. Aus diesem Grund erschafft sie eine objekthafte Wirklichkeit, die wir oberflächlich immer besser handhaben können. Das erzeugt aber gleichzeitig das Gefühl, dass wir die Dinge im Griff haben. Wir verfallen immer mehr der Illusion von Kontrolle und erheben dabei unsere Ideen und Vorstellungen über das tatsächliche lebendige Geschehen.
So wird irgendwann das Hilfskonstrukt einer Gedankenrealität, mit der wir ursprünglich die Gegebenheiten abbilden wollten, damit wir uns darin organisieren und zurechtfinden können, zu einem Diktat, dem der Lebensverlauf folgen soll. Das entspricht einer völligen Umkehrung der Verhältnisse. Das Denken und unsere Vorstellungen dienen uns dabei nicht mehr als Werkzeuge, um uns dem Leben anzunähern, sondern erheben sich zu einer herrischen Gottheit, die das Leben unterwerfen will. Das kann nicht gut gehen.
Bei dieser Haltung einer chronischen Selbstüberschätzung muss es nicht verwundern, dass sich daraus viele Schwierigkeiten ergeben und uns die Lebensumstände oft als feindlich erscheinen. Wir erfahren Enttäuschungen und Schicksalsschläge, und viele Pläne im Kleinen wie im Großen werden im Laufe unseres Lebens durchkreuzt. Aber anstatt unser gewohntes Festhalten an Kontrolle aufzugeben oder die Überzeugung, dass wir wüssten, wo es langgehen muss, zu überdenken, klammern wir uns an unsere Vorstellungen und fühlen uns als Opfer.
Bei genauer Betrachtung machen uns nicht die Umstände oder andere Menschen zum Opfer, sondern unsere Überzeugung, dass unsere Pläne und Vorstellungen richtig sind. Solange wir unserer Ideenwelt mehr Glauben schenken als dem tatsächlichen Leben, erzeugen wir unbewusst einen Leidenskreislauf, da wir uns über die Schöpfung erheben und dabei scheitern müssen. Selbst wenn wir unsere Konzepte und unsere Funktionalität immer mehr optimieren, werden wir über kurz oder lang an die Grenzen der Machbarkeit stoßen, denn das Leben ist ein schöpferisches und damit nicht lineares, also komplexes Geschehen, das sich nicht berechnen oder kontrollieren lässt.
Erst wenn wir das anerkennen und uns damit wieder in die Schöpfung einordnen und demütig werden, wenn das Denken vom Olymp der Götter herabsteigt und zum einfachen Werkzeug wird, das uns dient, werden wir uns wieder auf eine natürliche Weise einfügen und sind nicht mehr in ständiger Kampfbereitschaft. Dadurch können wir dem Lebensfluss wieder folgen und es entsteht eine Grundhaltung, die von Vertrauen geprägt ist.
Wir werden überrascht sein, wie viele unserer gefühlten Schwierigkeiten durch eine Veränderung unserer Lebenshaltung von Kampf in Richtung Vertrauen von selbst verschwinden, denn den meisten sogenannten Problemen liegen Vorstellungen und Überzeugungen zugrunde, an denen wir krampfhaft festhalten. Wir verhalten uns dabei wie jemand, der sich in einem reißenden Fluss an einem Ast, der ins Wasser ragt, anklammert. Die ganze Kraft der Strömung zieht und zerrt an uns und erscheint uns als feindlich und höchst bedrohlich. Doch kaum lassen wir los, fügen wir uns wieder in den Strom des Lebens ein und fühlen uns dadurch getragen. Das Einzige, was wir dabei opfern, sind ein paar lieb gewonnene Vorstellungen.
Ein kurzer Ausflug ins Gehirn
Bei all den Schwierigkeiten, die sich aus einer Identifizierung mit der Alltagsrealität ergeben, dürfen wir nicht vergessen, welch ungeheure Leistung das Erschaffen einer gemeinsamen Wirklichkeit ist und welches Wunderwerk dem zugrunde liegt. Das menschliche Gehirn, das den Verstand und damit die Bewusstseinsebene der Alltagsrealität erst möglich macht, ist so ungeheuer komplex und gleichzeitig kreativ, dass es alle Maßstäbe sprengt und wir nur staunen können, über welches Potenzial ein einziges menschliches Gehirn verfügt. Dabei sind zwei Dinge besonders erwähnenswert: seine Fähigkeit der Verknüpfung und der Neustrukturierung.
Die Komplexität, zu der ein Gehirn fähig ist, ergibt sich aus seinem Potenzial, mit dem sich die Gehirnzellen untereinander verbinden können und damit komplexe Verschaltungen möglich machen. Nach neuesten Schätzungen hat das Gehirn etwa eine Billion Gehirnzellen (= Neurone), die sich mit ihren Nervenästen jeweils mit einer anderen oder mit mehreren Gehirnzellen vernetzen und über elektromagnetische Impulse Informationen in Sekundenbruchteilen austauschen. Wenn wir uns vergegenwärtigen, dass ein Brettspiel wie Schach mit 64 Feldern auskommt und dabei trotz eingeschränkter Spielregeln die Zahl der möglichen Stellungen auf 2,28 mal 10 hoch 46 geschätzt wird, dann ist die Vernetzungsmöglichkeit des Gehirns, bei dem eine Billion Gehirnzellen miteinander agieren, so ungeheuer groß, dass sie jede Vorstellungskraft sprengt.
Die zweite Besonderheit des Gehirns besteht darin, dass seine Verknüpfungen niemals endgültig festgelegt sind. Oder anders formuliert: Wir sind zeitlebens fähig, neue Verbindungen auszubilden und damit durch neue Erfahrungen zu lernen. Wissenschaftlerinnen, die das Gehirn erforschen, nennen diese grundlegende Eigenschaft des Gehirns die »Neuroplastizität«. Es bezeichnet die Fähigkeit des Gehirns, nicht nur unterschiedliche Netzwerke zu befeuern und diese damit zu stärken oder zu schwächen, sondern die grundsätzliche Möglichkeit, die Struktur des Gehirns mit ihren zahlreichen Nervenzellen und Verknüpfungen umzubauen. Die Nervenzellenäste können wachsen und neue Verbindungsstellen (Synapsen) entstehen lassen.
Um deutlich zu machen, wie einzigartig dieser Vorgang ist, können wir noch mal einen Blick auf das Schachspiel werfen. Auch Schach ermöglicht eine ungeheure Kreativität von Spielzügen, aber das Regelwerk, die Figuren und die Felder bleiben determiniert, also immer gleich. Das Gehirn dagegen ist ein Spiel, das in jedem Augenblick seine Regeln und Figuren wieder ändern kann. Es hat die grundsätzliche Fähigkeit, sich immer wieder kreativ umzustrukturieren und damit quasi ein völlig neues Spiel entstehen zu lassen. Können wir uns vorstellen, was es bedeutet, ein Spiel zu spielen, das sich während des Spielens fortwährend verändert?
Genau das aber beschreibt die menschliche Situation. Das Leben ist ein Spiel, das lebendig und kreativ sich jederzeit umstrukturieren und verändern kann – nicht nur im äußeren Ablauf, sondern auch in unserem Gehirn. Wir können nicht darauf hoffen, dass die Spielregeln gleich bleiben, und auch die Spielfiguren, also zum Beispiel für uns wichtige Menschen, können jederzeit eine neue Gestalt annehmen. Das menschliche Gehirn mit seiner Fähigkeit zu lebenslanger struktureller Veränderung kann auf diese Herausforderung optimal eingehen.
Wenn wir bis jetzt jedoch nur auf die Komplexität des Gehirns schauen und seine Flexibilität und Kreativität bewundern, ist das nur die eine Seite der Medaille. Flexibilität alleine genügt nämlich nicht. Das Gehirn braucht als Gegenpol die Fähigkeit, Muster und feste Strukturen auszubilden. Nur dadurch entsteht eine gewisse Ordnung im Dschungel des Lebens. Mit jeder Verknüpfung – oder besser mit jedem Netzwerk, das im Gehirn entsteht – bildet sich ein Muster aus, das innere körperliche Abläufe, aber auch Wahrnehmungen, Gedanken und Handlungen strukturiert. Ohne diese Muster könnten wir weder wahrnehmen noch denken oder absichtsvoll handeln.
Sogar unsere sinnliche Wahrnehmung entsteht erst durch komplexe Verschaltungen in unserem Gehirn, die zum Beispiel einen visuellen Eindruck entstehen lassen. Ohne dass unser Gehirn die sensorischen Reize aus dem Auge auf eine bestimmte Weise verarbeitet und zu einem Bild zusammenfügt, würden wir trotz Lichteinfall und den Rezeptoren im Augenhintergrund nichts sehen. Das, was wir also sehen, ist eine Bildkonstruktion des Gehirns und nicht eine unabhängige äußere Welt.
Читать дальше