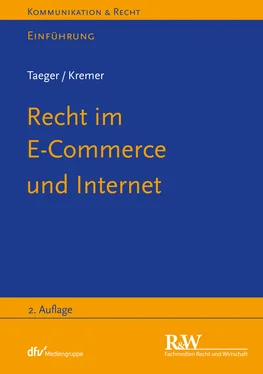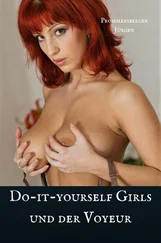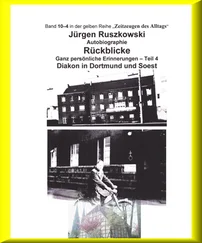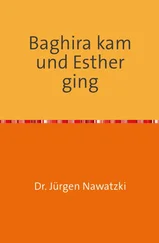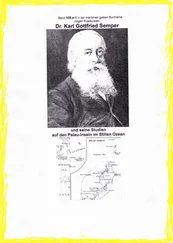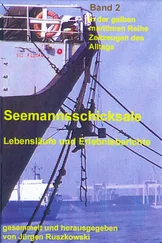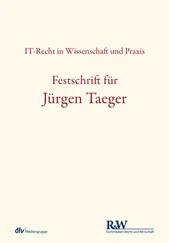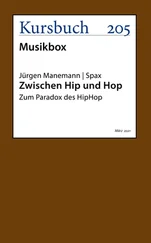b) Elektronischer Vertragsschluss und herkömmliche Auslieferung
37
Bei dieser Variante der Nutzung des Internet erfolgt die Leistungspräsentation per Website, im sozialen Netzwerk oder mittels einer App auf einem smarten Device (Smartphone, Tablet, Watch). Gleichzeitig bietet der Anbieter dem Kunden die Möglichkeit, unmittelbar aus der digitalen Präsentation heraus das Produkt oder die Dienstleistung seiner Wahl zu bestellen. Nach Eingabe der erforderlichen Daten schickt der Kunde die Bestellung ab. Die Bezahlung erfolgt über Kreditkarte, SEPA-Lastschrift oder einen speziellen Online-Zahlungsservice. Waren werden dann über einen Versandservice (Logistikunternehmen wie DHL, DPD, GLS, UPS oder Hermes) geliefert, Dienstleistungen nach Absprache erbracht.
38
Typische Leistungsinhalte sind dabei materielle Waren wie Bücher, Hardware (Computer, Tablets, Smartphones), Software (soweit noch auf Datenträger bereitgestellt) oder Kleidung, zunehmend aber etwa auch Lebensmittel. Dienstleistungen werden vornehmlich dort angeboten, wo diese standardisiert erbracht werden können, z.B. das Aufziehen der neuen Reifen auf einen Pkw nach der Onlinebestellung der Reifen durch den ausliefernden Händler.
c) Vollständig elektronischer Vertrieb
39
Beim vollständig elektronischen Vertrieb wird die gesamte Leistungsbeziehung vom Anbieter via Internet abgewickelt. Die Ware/Dienstleistung wird online präsentiert, der Vertragsschluss erfolgt online, und auch die Leistungserbringung, soweit sie die Lieferung der Ware/Dienstleistung betrifft, erfolgt per Internet. Schwerpunkte sind dabei immaterielle Waren und Dienstleistungen, da nur diese sich auch digital abbilden lassen. Typische Leistungsinhalte sind daher Datenbanken, z.B. juristische Datenbanken zur Urteilsrecherche, Software-Downloads, bei denen die Software mittels Internet auf den Kundenrechner überspielt wird, und die Erbringung von Cloud Services. Aber auch Dienstleistungen, die in das Umfeld der Software gehören, sind hier einzuordnen, so etwa Hotlines und die standardisierte Geltendmachung von Rechtsansprüchen (Erstattungsansprüche bei Verspätungen beispielsweise). Die elektronische Rechtsberatung fällt ebenfalls in diese Kategorie.23 Auch hier wird die Ware „Information“ elektronisch, zumeist per E-Mail oder über eine Onlineplattform, übertragen.
40
Neben diesen drei Konzepten beim Einsatz des Internet im Rahmen der Werbung, der Vertragsanbahnung und ggf. der Vertragsabwicklung gibt es auch Geschäftsmodelle, welche die neuen Kommunikationsmöglichkeiten des Internet dazu nutzen, neue Konzepte zu verwirklichen. Zu nennen wären dabei zunächst Internetversteigerungen. Bei der Internetversteigerung handelt es sich nicht um eine Versteigerung i.S.d. § 156 BGB, bei der herkömmlich abgegebene Gebote auf einer Versteigerung nur durch eine elektronische Kommunikation ersetzt werden. Vielmehr erfolgt die Warenpräsentation auf einer Website, und nach Ablauf einer festgesetzten Angebotsdauer wird der Höchstbietende zum Erwerber der angebotenen Ware. Es handelt sich demnach um einen Kauf gegen Höchstgebot. Dabei wird das Prinzip der Auktion meist im Rahmen einer unternehmensübergreifenden Handelsplattform verwendet.24 Dieses ist die elektronische Abbildung eines Marktplatzes, auf dem Unternehmen Einkauf und Vertrieb abwickeln können (Einkaufsportale). Neben Auktionsmodulen werden auch weitere Dienstleistungen angeboten, z.B. Unterstützung bei der Warenlogistik.
41
Auch andere Modelle haben sich etabliert: So z.B. die wegen der damit häufig einhergehenden Urheberrechtsverletzungen umstrittenen Tauschbörsen, auf denen beispielsweise Musikwerke getauscht werden können, oder aber auch das Application-Service-Providing (ASP) und das sog. Software as a Service (SaaS), bei dem nur die Softwarenutzung per Internet Vertragsgegenstand ist.
42
Last not least sind noch die neuen Geschäftsmodelle des „Web 2.0“ zu erwähnen. Hinter dem Schlagwort des „Web 2.0“ verbergen sich unterschiedliche Geschäftsideen, deren Gemeinsamkeit in der Einbeziehung von Inhalten durch die Nutzer gesehen werden kann. Zu nennen sind hier insbesondere Plattformen wie z.B. YouTube oder aber soziale Netzwerke wie Facebook, Instagram und TikTok, bei denen die Diensteanbieter den Nutzern die Möglichkeit eröffnen, die Inhalte der Plattform im Rahmen des vom Anbieter verfolgten Zwecks mitzugestalten. Hier treten regelmäßig haftungsrechtliche Fragen, aber auch marken- und urheberrechtliche Problemstellungen auf.25
Fragen und Aufgaben
1. Gibt es ein „Internet-Gesetzbuch“?
2. Welche unterschiedlichen Gesetzesquellen bestehen? Nennen Sie jeweils ein Beispiel.
3. Zwischen welchen drei Ebenen kann man in technischer Hinsicht differenzieren?
4. Nennen Sie bitte einzelne Gesetze, die einen Bezug zum Internet aufweisen, und geben Sie jeweils ein Beispiel.
5. Wo liegen die ökonomischen Vorteile des Internet?
6. Was versteht man unter One-to-One-Marketing?
15Grundlegend Seiler, Verbraucherschutz auf elektronischen Märkten, 2006. 16Alternativ wird auch der Begriff Informations- und Kommunikationstechnik genutzt (abgekürzt „ITK“ oder „IuK“). 17Vgl. Zerdick u.a., Internet-Ökonomie, 2001, S. 149ff. 18Vgl. Beck/Prinz, Ökonomie, 1999, S. 50. 19Ausführlich Zerdick u.a., Internet-Ökonomie, 2001, S. 157ff. 20Vgl. Zerdick u.a., Internet-Ökonomie, 2001, S. 191ff. 21Ausführlich dazu Golland, CR 2020, 186ff.; Künstner/Franz, K&R 2017, 688f. 22Ausführlich dazu Kap. 7 und 8. 23AG Hildesheim, Urt. v. 8.8.2014 – 84 C 9/14 m. Anm. Ernst, jurisPR-ITR 1/2015 Anm. 6; AG Offenbach, Urt. v. 9.10.2013 – 380 C 45/13 m. Anm. Spoenle, jurisPR-ITR 25/2013 Anm. 4; siehe auch Ernst, NJW 2014, 817, und zur Anwaltshotline auch Wendehorst, in: MüKo-BGB, 2019, § 312c Rn. 19. 24Ausführlich zu Internet-Versteigerungen Kap. 2, Rn. 59ff.; dazu auch Kremer, in: Heidel/Hüßtege/Mansel/Noack, BGB, 2021, Anhang zu § 156 Rn. 1ff. 25Zu Plattformen und den damit einhergehenden Haftungsfragen ausführlich Kap. 9.
Kapitel 2
Vertragsanbahnung und Vertragsschluss im Internet
Übersicht
|
Rn. |
| I. Vertragsanbahnung |
1 |
| 1. Elektronische Willenserklärungen und Computererklärungen |
3 |
| a) Elektronische Willenserklärung |
4 |
| b) Computererklärung |
5 |
| c) Mausklick oder Fingertipp als Erklärungshandlung |
8 |
| 2. Formbedürftigkeit |
11 |
| 3. Arten der Vertragsanbahnungen |
14 |
| II. Vertragsschluss im Internet |
18 |
| 1. Website oder App als Antrag oder invitatio ad offerendum |
19 |
| a) Grundregel: Websites oder Apps als invitatio ad offerendum |
20 |
| b) Ausnahme: Website oder App als Antrag |
24 |
| c) Sonderfall: Internet-Versteigerungen |
26 |
| 2. Zugang des Antrags |
29 |
| a) Zugang elektronischer Willenserklärungen unter Abwesenden oder Anwesenden |
30 |
| b) Machtbereich des Empfängers und Möglichkeit zur Kenntnisnahme |
33 |
| 3. Annahme des Antrags |
35 |
| 4. Bestätigung des Zugangs |
37 |
| III. Vertragsschluss per E-Mail |
39 |
| 1. Vertragsschluss per Massen-E-Mail oder individueller E-Mail |
40 |
| 2. Vertragsrechtliche Besonderheit: keine Bestellbestätigung |
42 |
| IV. Vertragsschluss über Smart Devices, Apps und über App Stores |
43 |
| 1. Begriffsbestimmung App, Smart Device und App Store |
43 |
| 2. Technische Grundlagen von Apps und App Stores |
45 |
| 3. Anwendbares Recht beim Bezug von Apps |
46 |
| 4. Vertragsschluss bei der Vermarktung von Apps |
50 |
| a) Apps von App Store-Betreibern |
50 |
| b) Lizenz- oder Nutzungsvertrag zwischen Anbieter und Anwender |
56 |
| V. Vertragsschluss bei Internet-Versteigerungen und Glücksspiel. |
59 |
| 1. Klassische Versteigerung gemäß § 156 BGB |
60 |
| 2. Formen von Internet-Versteigerungen |
61 |
| 3. Gewerberechtliche Zulässigkeit von Internet-Versteigerungen |
63 |
| 4. Wirksamkeit des Vertragsschlusses bei Internet-Versteigerungen |
68 |
| a) Willenserklärung des Anbieters |
71 |
| b) Willenserklärung des Käufers |
79 |
| 5. Löschung und Rücknahme von Angeboten und Geboten, Unwirksamkeit, Anfechtung |
82 |
| 6. Pflichten im elektronischen Geschäftsverkehr |
88 |
| 7. Preisangabenverordnung |
91 |
| 8. Der Sonderfall: Rückwärtsversteigerungen |
92 |
| 9. Der Sonderfall: Bietagenten |
94 |
| 10. Haftung bei Internet-Versteigerungen |
96 |
| 11. Glücksspiel |
98 |
| VI. Anfechtung des Vertrages |
107 |
| 1. Irrtümer des Bestellers oder des Anbieters |
109 |
| 2. Fehler bei der Datenübertragung |
111 |
| 3. Computerfehler |
113 |
| 4. Rechtsfolgen |
115 |
| 5. Anfechtung bei Fernabsatzverträgen |
117 |
| VII. Haftung für Handeln Dritter bei Missbrauch von Zugangsdaten |
122 |
| 1. Anscheinsvollmacht |
124 |
| 2. Voraussetzungen für eine Zurechnung |
127 |
| 3. Abgrenzung zur Halzband-Entscheidung |
128 |
| 4. Folgen für das Online-Banking |
129 |
Читать дальше