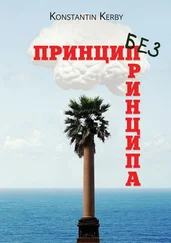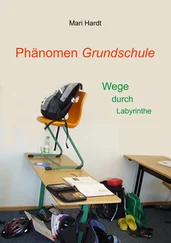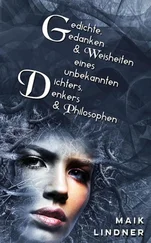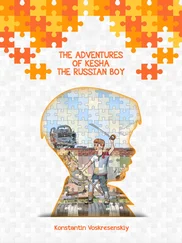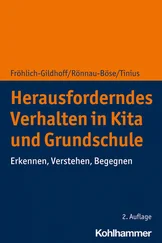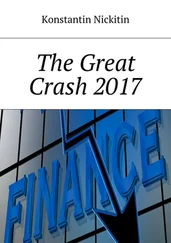Konstantin Lindner - Religionsdidaktik Grundschule
Здесь есть возможность читать онлайн «Konstantin Lindner - Religionsdidaktik Grundschule» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Religionsdidaktik Grundschule
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:3 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 60
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Religionsdidaktik Grundschule: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Religionsdidaktik Grundschule»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Mit seinen grundsätzlichen Klärungen und vielen didaktischen und methodischen Anregungen legt es das Fundament für einen guten Religionsunterricht.
Religionsdidaktik Grundschule — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Religionsdidaktik Grundschule», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Geschichtlich gesehen, hat der Religionsunterricht seit dem 19. Jahrhundert infolge seiner spezifischen Bindung an die Religionsgemeinschaften resp. Kirchen lange Zeit zweifellos eine gewisse Sonderstellung für sich in Anspruch genommen. Bis in die 1960er-Jahre hinein verstand er sich nämlich als ein verlängerter Arm der Kirchen bzw. des kirchlichen Lebens im Raum der Schule. Dementsprechend sah er sich den Gegebenheiten und Anforderungen schulischer Organisation und Didaktik nicht im gleichen Maße wie andere Fächer verpflichtet. Letzteres hat sich aber seit Mitte der 1960er-Jahre zunehmend geändert, sodass heute Religion als ein integraler Bestandteil der Schule und ihres Bildungsauftrags erscheint (vgl. u. a. EKD 1994; DBK 1996). Die Bestimmungen des Grundgesetzes für dieses zwischen Staat und Kirche angesiedelte Schulfach sollen im Folgenden in ihren wichtigsten Punkten angeführt werden.
2. Religionsunterricht als Schulfach
Ausdruck und Ausübung positiver Grundrechtsausübung
Der Staat, wie ihn das Grundgesetz versteht, achtet – obwohl zu weltanschaulicher Neutralität verpflichtet – gleichwohl auf die religiösen Willensbekundungen seiner Bürger und darauf, dass sie ihre Grundrechte auch ausüben können. Deswegen richtet er zur Wahrung der positiven Religionsfreiheit ein entsprechendes Schulfach Religionsunterricht ein. Da die Religionsfreiheit zu den »Grundrechten« (Art. 1–19 GG) zählt, ist der Religionsunterricht weder eine »großzügige Geste des Staates« noch ein kirchliches Privileg, er ist vielmehr zur »Sicherung der Grundrechtsausübung durch den Einzelnen« (EKD 1994, 86) im Raum der öffentlichen Schule eingerichtet. Kinder und Jugendliche sollen sich in dem dafür vorgesehenen Schulfach eigenständig und frei religiös orientieren können. Auch für den Staat selbst ist wichtig, dass sich die Heranwachsenden »mit den ihn tragenden Werten und ihrer kulturellen, weltanschaulichen und religiösen Herkunft« (EKD 1994, 86) auseinandersetzen, da er auf Überzeugungen beruht, die er selbst nicht schaffen kann (Ernst-Wilhelm Böckenförde).
In Verantwortung von Staat und Religionsgemeinschaften (Kirchen)
Die Besonderheit des schulischen Religionsunterrichts besteht nicht nur darin, dass er als einziges Fach im Grundgesetz genannt wird, sondern vor allem darin, dass er infolge von Art. 7 Abs. 3 Satz 2 von zwei Seiten verantwortet wird, nämlich vom Staat und den Religionsgemeinschaften resp. Kirchen, was so für kein anderes Fach der Fall ist. Der Staat verzichtet beim Religionsunterricht auf seine sonst in der Schule wahrgenommene bildungsmäßige und bildungspolitische Alleinzuständigkeit und greift zur inhaltlichen Ausgestaltung auf die Religionsgemeinschaften resp. Kirchen zurück. Dies ist aufgrund des Grundgesetzes auch unabdingbar: Da der Staat nach Art. 4 GG weltanschaulich neutral zu sein hat – auch im Raum der Schule –, darf er infolge von Art. 7 Abs. 3 nicht selbst die Inhalte für den Religionsunterricht festlegen bzw. dieses Fach in die eigene Alleinregie nehmen. Seine Aufgabe erstreckt sich im Wesentlichen darauf, die organisatorischen Voraussetzungen zu schaffen und die schulischen Rahmenbedingungen im Blick zu haben. Im Sinne einer »res mixta« sind »Ordnung und Durchführung des Religionsunterrichts staatliche Aufgabe und Angelegenheit« und gehören zugleich »in den Verantwortungsbereich der Kirchen bzw. Religionsgemeinschaften« (EKD 1994, 87), die für die inhaltliche Ausgestaltung zuständig sind. Die dafür notwendigen konkreten Vereinbarungen zwischen Staat und Kirchen sind durch Konkordate (katholisch), Staatskirchenverträge (evangelisch) und weitere Gesetze geregelt. Ferner ist darauf hinzuweisen, dass bei Einhaltung bestimmter praktisch erforderlicher Konditionen grundsätzlich jede Religionsgemeinschaft das Recht hat, mittels ausgebildeter Lehrkräfte für ihre Mitglieder ein entsprechendes Fach Religionsunterricht einzurichten.
»Ordentliches Lehrfach«
Nach Art. 7 Abs. 3 S.1 GG ist der Religionsunterricht »ordentliches Lehrfach«, was mit einer Reihe wichtiger Folgen einhergeht (vgl. ADAM 2012, 299 ff.; ZIEBERTZ 2010c, 210 f.):
Der Religionsunterricht unterliegt staatlichem Schulrecht und staatlicher Schulaufsicht . Von Staat und Kirchen (bzw. Religionsgemeinschaften) verantwortet, wird er vom Staat veranstaltet, ist also eine Veranstaltung des Staates, nicht der Kirchen.
Seine Einrichtung als Pflichtfach ist für Schulträger obligatorisch. Im schulischen Fächerkanon hat er damit seinen festen Platz, wird im Rahmen des Stundenplans erteilt und unterliegt denselben formalen Bedingungen wie die anderen Fächer.
Der Staat als Träger und Veranstalter des Schulwesens ist für den äußeren Ablauf des Faches verantwortlich, also für die Bereitstellung der entsprechenden Religionslehrkräfte, den Erlass der Fachlehrpläne Evangelische und Katholische Religionslehre sowie die Bereitstellung von Materialien.
Als ordentliches Lehrfach muss sich Religionsunterricht auch von den allgemeinen Erziehungs-, Lern- und Bildungsanliegen der Schule(n) her begreifen, wie sie in den einzelnen Länderverfassungen konkret formuliert sind. An ihnen hat er sich, da er nicht einfach kirchliche Katechese in der Schule ist, zu orientieren. Dies tut er, indem er sich zum einen an der Erfüllung der allgemeinen schulischen Erziehungs- und Bildungsaufgaben beteiligt und zum anderen die spezifisch religiöse Lern- und Bildungsaufgabe verfolgt.
Wie in jedem anderen Schulfach werden auch im Religionsunterricht Noten vergeben, wobei diese versetzungserheblich sind. Benotet werden dabei nicht Religiosität, Glaube oder Kirchlichkeit der Schülerinnen und Schüler, sondern ihre »messbaren Leistungen«, wie sie sie im Rahmen des Unterrichts oder häuslicher Vorbereitung erbringen. Dazu gehören Kenntnisse und »Fähigkeiten, Gelerntes zu verstehen und wiederzugeben, es in Zusammenhänge einzuordnen und selbstständig Fragen zu stellen, Probleme zu sehen und Lösungen zu erarbeiten usw.« (ADAM 2003, 170). Dabei kann und muss im Religionsunterricht – gerade der Grundschule – nicht alles gemessen und benotet werden (s. III.15).
3. Die Verantwortung und Mitwirkung der Religionsgemeinschaften (Kirchen)
Art. 7 Abs. 3 Satz 2 GG stellt den Religionsunterricht auch in den »Verantwortungsbereich der Kirchen bzw. Religionsgemeinschaften« (EKD 1994, 87) und sichert ihnen seine inhaltliche Ausgestaltung zu. In unserem Zusammenhang heißt dies: Die Kirchen sind personaliter an den entsprechenden Lehrplankommissionen ebenso beteiligt wie an der materialen Ausgestaltung der Lehrpläne, sie entscheiden mit über die Zulassung von Lehrmitteln, und staatliche (wie auch kirchliche) Lehrkräfte mit Fach Religion bedürfen der kirchlichen »Zustimmung« (Missio Canonica bzw. Vocatio), damit sie Religionsunterricht erteilen können.
»… in Übereinstimmung mit den Grundsätzen der Religionsgemeinschaften«
Infolge von Art. 7 Abs. 3 Satz 2 GG entscheiden die Kirchen resp. Religionsgemeinschaften entsprechend ihrer »Grundsätze« über Inhalte und Ziele des Unterrichtsfaches Evangelische bzw. Katholische Religionslehre. Wo menschliche Existenz (nicht nur religionsunterrichtlich) in ihren Grundsituationen und Grundfragen behandelt wird, geschieht dies im Kontext und auf der Basis bestimmter Grundannahmen, eines Referenzrahmens, genauer: einer konkreten Religion und Konfession (s. I.1). Nach katholischem Verständnis partizipiert das Bekenntnis des Einzelnen am Bekenntnis der Kirche, »indem der Christ dem zustimmt, was die Kirche durch ihr Lehramt als christlichen Glauben verbindlich verkündigt« (FRIELING 1999, 40; vgl. DBK 1996, 37 ff.). Evangelischerseits gibt es zwar auch ein »Kirchenbewusstsein, das die Konfession als Institution betont«, doch geht die Evangeliumsverkündigung »nie in der kirchlichen Lehre, in Dogmen und Bekenntnissen auf« (FRIELING 1999, 41). Gibt es dergestalt unterschiedliche Konfessionen, dann resultiert daraus und aus dem hier angeführten Passus des Grundgesetzes die Praxis des nach Konfessionen getrennten Religionsunterrichts (auch) in der Grundschule. Mit einem breiten theologischen und religionspädagogischen Konsens, aber auch nach herrschender juristischer Lehre spricht derzeit viel – nicht alles! (s. auch unter 4.) – für einen konfessionell verantworteten Religionsunterricht, nicht zuletzt deswegen, weil eine »allgemeine« Religion in Alltag und Lebenswelt nicht vorkommt und ein »allgemeines« Fach Religion von seinen Gegenständen her – gerade für Grundschülerinnen und -schüler – kaum überschaubar wäre. Demzufolge erscheint es der »Sache«, die eine Konfession bzw. Religionsgemeinschaft vertritt, »angemessen, dass sie von dieser Religionsgemeinschaft authentisch selbst interpretiert und im Unterricht dargestellt wird« (BITTER u. a. 2006, 15). Dies entspricht den Glaubensquellen der jeweiligen Konfession, dient aber auch den Heranwachsenden, weil sie die evangelische und katholische – ggf. auch jüdische und muslimische – Glaubens- und Lebenssicht »jeweils in eigenständigen Fächern aus erster Hand kennenlernen« (ebd.). Nachgerade in der Grundschule, welcher der Bezug zum gelebten Leben – und im Falle des Religionsunterrichts auch zum gelebten Glauben – wichtig ist, muss die Begegnung mit (Phänomenen) gelebter Religion breiten Raum einnehmen: Hier wird das Spezifische einer Konfession sichtbar (s. II.10). Dies meint einen Religionsunterricht in konfessioneller Gebundenheit und nicht in abstrakter Neutralität oder (pluralistischer) Beliebigkeit. Steht dergestalt eine Konfession im Zentrum des Religionsunterrichts, die so die Orientierung an und in einer Konfession bzw. Glaubensgemeinschaft ermöglicht, so ist damit gleichwohl das religiös Andere und Unterschiedene auch im Religionsunterricht der Grundschule nicht auszuschließen, eben weil sich religiöse Identität bei Schülerinnen und Schülern nur in der Begegnung mit der »eigenen«, aber auch im Kontakt mit anderen Konfessionen bzw. Religionen prozessual entwickelt. Dazu braucht es neben einer Kultivierung des Gemeinsamen und Einenden auch den wachen Blick für das Unterscheidende. Mit dem konfessionellen Religionsunterricht sollen die Schülerinnen und Schüler nicht autoritär in ein religiös-konfessionelles Korsett gezwängt werden, sondern lernen, sich – inmitten religiöser und weltanschaulicher Vielfalt – eigenständig zu orientieren. Dies aber ist durch die vom Grundgesetz bislang vorausgesetzte konfessionelle Gebundenheit des staatlichen Religionsunterrichts gerade nicht ausgeschlossen: Religiös orientieren können sich (nicht nur, aber gerade) Grundschülerinnen und -schüler einem breiten religionspädagogischen Konsens zufolge eher in einem bekenntnisbezogenen Religionsunterricht als in einem pluralen und allgemeinen Fach Religion. Solche Konfessionalität ist alles andere als Gesinnungszwang. Der von der Verfassung her nämlich »gebotene Schutz vor individuell unerwünschter religiöser Beeinflussung ist nicht durch eine Pluralisierung der Unterrichtsinhalte zu gewährleisten, sondern durch die Möglichkeit freier und sanktionsloser Abmeldung vom Religionsunterricht« (KÄSTNER 2003, 21).
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Religionsdidaktik Grundschule»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Religionsdidaktik Grundschule» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Religionsdidaktik Grundschule» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.
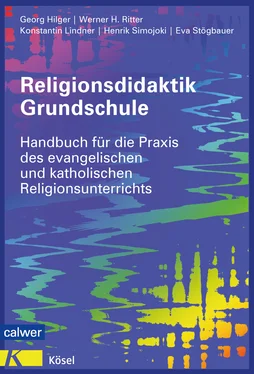
![Константин Бальмонт - Константин Бальмонт и поэзия французского языка/Konstantin Balmont et la poésie de langue française [билингва ru-fr]](/books/60875/konstantin-balmont-konstantin-balmont-i-poeziya-francuzskogo-yazyka-konstantin-balmont-et-thumb.webp)