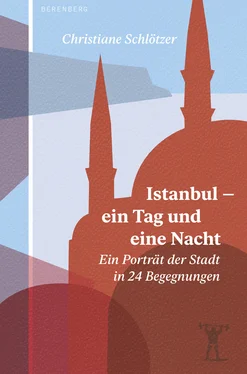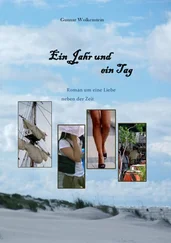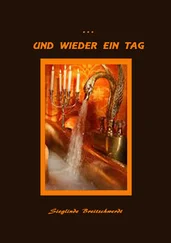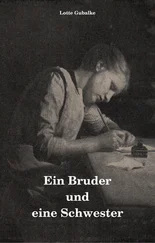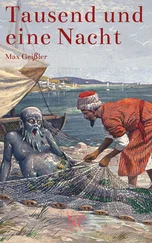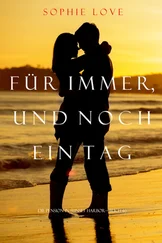Hat er noch einen Zukunftswunsch? »Ein Istanbul mit weniger Verkehr.« Und für das Meer? Dass der Bosporus so sauber wird, dass man darin schwimmen mag? So wie es alte Istanbuler erzählen, die an Wochenenden mit Picknickkörben ans Ufer zogen und in die Fluten sprangen. »Ich glaube, das werden wir schaffen, für das Meer, für unsere Kinder. Dass sie sagen können: Schau mal, da sind Delfine!« Auf Türkisch heißt der Delfin Yunus , also Jonas oder Jona – ein Prophet für Muslime wie für Christen. Der Legende nach wurde Jonas von einem Wal verschluckt und wieder ausgespuckt. Auch auf osmanischen Darstellungen sieht man die eleganten Tiere. Aslan strahlt jetzt, als hätte er gerade einen Delfin vor Augen: »Ich möchte ein Istanbul, in dem die Menschen Ruhe finden und lächeln.«
9 Uhr
Treppensteigen
Siebter Stock ohne Aufzug – Der Architekt Erdoğan Altındiş spricht über Aufgänge und Abstürze
Diese Treppen sind wie Schneckenhäuser, sie winden sich spiralförmig nach oben, himmelwärts. Erdoğan Altındiş setzt eine Krücke auf eine Steinstufe, dann die andere, zieht sich hoch. Stufe für Stufe. Der Architekt braucht zum Treppensteigen die Kraft seiner Arme, seine Beine gehorchen ihm nicht.
Dies ist die Geschichte eines Mannes, der sagt: »Ich habe viel Glück in meinem Leben gehabt.« Sie erzählt von Selbstüberwindung, Angst und Ehrgeiz, vom Aufstieg und vom Fallen, wie könnte es auch anders sein in den Schwindel erregenden Höhen, in denen sich Altındiş bewegt.
Siebter Stock ohne Aufzug. Oben angekommen steckt der Architekt einen Schlüssel in das Schloss einer Stahltür. Es empfängt einen taghelle Wärme. Das Licht fällt durch Fenster von allen Seiten und durch ein Stück Glas im Fußboden. Altındiş eilt voraus, vorbei an Kanapees mit Kissen in Rot und Orange, er öffnet die Terrassentür mit einem Ruck. Ein Schritt nach draußen und sofort stellt sich ein Gefühl von Schwindel ein. Es wird abgelöst von Ergriffenheit. Der freie, weite Blick auf den Bosporus und das Marmarameer nimmt einem für einen Moment fast den Atem. Am Horizont ragen unter leichtem Dunst die Prinzeninseln auf. Richtet man den Blick in die Tiefe, auf abenteuerlich in der Luft schwebende Balkone und Terrassen, voll mit Plastikstühlen und Blumentöpfen, dann weiß man, hier strebt alles zum Licht.
Altındiş atmet tief ein. »Schön«, sagt er. So oft kommt er nicht mehr hier herauf, aber er kann immer noch staunen, wenn ihm Istanbul zu Füßen liegt. Als er Mitte der 1990er Jahre diese Wohnung kaufte, weinte seine Mutter und sein Vater sagte: »Oh Sohn, warum schmeißt du dein Geld auf die Straße?« Wohnungen in den oberen Stockwerken galten als uninteressant, wegen der vielen Treppen, und die Gassen um den Galataturm hatten einen schlechten Ruf. »Es war schmutzig, eine No-go-Area.« Für die neunzig Quadratmeter in schlechtem Zustand bezahlte er 27.000 Mark. Ein Vierteljahrhundert später ist die Dachwohnung ein Vielfaches wert. Galata ist inzwischen touristische Kernzone. Wenn die alten liftlosen Häuser heute den Besitzer wechseln, wird nicht in türkischer Lira, sondern in US-Dollar gerechnet. Altındiş hat den Aufschwung miterlebt, »und ich muss sagen, wir haben ihn mitgeprägt«.
Wenn er »wir« sagt, meint er sich und seine Frau Gabi, mit der er ein Unternehmen gegründet hat, das den Ausblick, türkisch manzara , zum Markennamen machte. Sie haben Wohnungen in den obersten Stockwerken, die lange keiner haben wollte, langfristig gemietet, sie in bewohnbare Schmuckstücke verwandelt und an Touristen vergeben, die für den freien Blick das Treppensteigen in Kauf nahmen. Airbnb war noch keine Konkurrenz. Sie waren Pioniere, hatten bald Gäste aus New York, Berlin, Paris und Rom, viele Künstler, Architekten, Galeristen. Istanbul war da gerade zur Partyzone Europas geworden. Es war die Ära des Aufbruchs und die Stadt eine unbekannte, aufregende Schönheit, die es zu erobern galt. Altındiş war der Fremdenführer für seine Gäste durch das Abenteuer Istanbul. Es ist, als wäre das eine Ewigkeit her.
Er sperrt die Stahltür wieder ab und hangelt sich die steile Treppe hinunter. Auf der Straße sagt er: »Im Nachhinein muss ich sagen, ich bin glücklich, dass wir das erlebt haben, es war ein Geschenk.« Die Veränderungen waren schmerzhaft, und der Schmerz kam in Wellen. Erst die Niederschlagung der Gezi-Proteste 2013, da blieben schon die ersten Gäste weg. Dann Anschläge, der Putschversuch im Juli 2016. Verhaftungen, der Syrienkrieg – und dann noch die Pandemie. Da wollte oder konnte kaum noch jemand reisen. »Das hat mich traurig gemacht, wir wollten doch Brückenbauer sein, wir hatten so eine Art Mission im Kopf.« Um zu verstehen, was diesen Mann antreibt, muss man seine Geschichte kennen. Er eilt wieder voraus, setzt die Krücken auf das buckelige Straßenpflaster. Es ist nicht weit bis zu der Wohnung, in der er jetzt mit seiner Frau lebt. Wieder in einem alten Haus und ziemlich weit oben, aber hier wird gerade ein Lift gebaut.
Aus der Wohnung dringt Bratenduft. Erdoğan Altındiş sagt: »Wenn Gabi Heimweh hat, gibt es Spätzle.« Erst einmal aber gießt Gabi Kern-Altındiş Kräutertee in große Tassen und erzählt, wie sie aus dem Schwarzwald nach Istanbul kam. »Meine Eltern waren sehr konservativ, aber meine Mutter hat mir immer gezeigt, dass alle Menschen gleich sind.« Gabi und Erdoğan sind beide 1963 geboren. Auch in seiner Heimat, der zentralanatolischen Provinz Kayseri, sind die Menschen konservativ. Im Alter von einem Jahr erkrankte er an Kinderlähmung. Seine Mutter sagte ihm später, als Baby konnte er nur etwa einen Monat laufen. Damals wurde bereits gegen Polio geimpft, aber nicht überall. »Ich weiß nicht, warum ich nicht geimpft wurde, vielleicht lag es an den Umständen. Mein Vater war immer auf Baustellen unterwegs, meine Mutter war ein Mädchen vom Lande, abhängig von ihrem Bruder, der sie oft drangsaliert hat.« In der Türkei gab es damals noch viele Polio-Fälle.
Erdoğan ist in der Türkei ein Vor- und ein Nachname. Wörtlich übersetzt ist das der »tapfer Geborene« oder der »als Kämpfer Geborene«. Hört man Altındiş eine Weile zu, wirkt die Namenswahl seiner Eltern hellseherisch. »Meine Mutter hat mich auf ihrem Rücken in die Schule getragen, und sie hat den Schuldirektor überredet, dass mein Bruder ein Jahr früher eingeschult wird, damit er mich begleitet.« Aber der Bruder wollte nicht. »Irgendwann hat sich das dann so entwickelt, dass ich mit einer Krücke laufen konnte.«
Vier Jahre besucht er die türkische Volksschule und wird dann in die Sommerferien zum Vater nach München geschickt. Der ist nun Gastarbeiter in Deutschland und lebt mit anderen Bauarbeitern in einer Barackensiedlung am Stadtrand. Dort landet der Zehnjährige zwischen Stockbetten und Metallspinden. Die Arbeitskollegen des Vaters verwöhnen ihn mit Schokolade und Fernsehen, Lassie und Bonanza . »Ich hatte eine tolle Zeit.« Der Vater hat ihn nach München geholt, weil er hofft, Ärzte könnten ihm hier besser helfen als in der Türkei. Er wird in einer Münchner Kinderklinik dann zweimal operiert, erfolgreich, sagt er. Türkische Putzfrauen im Krankenhaus trösten ihn über das Heimweh hinweg. Mit einer Gipsschale für die Nächte wird er entlassen, ins Barackenlager. Dort erscheint eines Tages eine Mitarbeiterin des Jugendamts und sagt etwas wie: »Nix gut du hier sein.« Sie bringt ihn in die Landesschule für Körperbehinderte. »Ich hatte wieder Glück.«
Er lernt schnell Deutsch, und wenn ihn die Sehnsucht überwältigt, wählt er sich im Wohnheim die Finger wund, bis er die Stimme der Mutter hört. In der Münchner Stiftung Pfennigparade, die in den 1950er Jahren als Bürgerbewegung zur Polio-Bekämpfung entstand, besucht er eine Fachoberschule. Der »Mutige« gewöhnt sich bald an das Hin und Her zwischen der Schule in München und den Sommerferien in Kayseri. Weihnachten erlebt er im tief verschneiten Bayerischen Wald bei der Familie eines schwer körperbehinderten Wohnheimfreundes.
Читать дальше