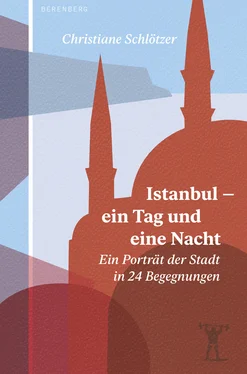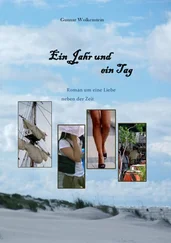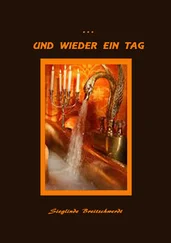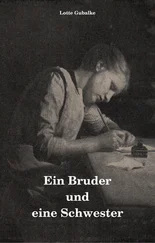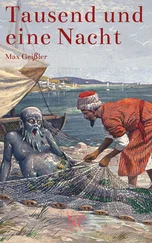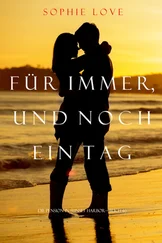Zwei Monate nach seinem Einzug ins Istanbuler Rathaus traf ich den neuen OB zu einem Interview. Da erzählte er von »Bankautomatenangestellten«, die nichts weiter taten, als regelmäßig ihr Gehalt abzuholen. Von religiösen Stiftungen, die Millionenzuwendungen erhielten, von üppigen Dienstwagenverträgen. Hunderte überflüssige Dienstwägen stellte die Stadt dann zur Schau. Geparkt in langen Reihen am Marmarameer, auf einem Riesengelände, das Erdoğan für seine Großauftritte hatte aufschütten lassen. Hier schwebte der Präsident im Wahlkampf mit dem Hubschrauber ein, wenn der Platz voll war. Eine ganze Flotte städtischer Busse brachte Beamte und Angestellte zu diesen Kundgebungen. Diese Busflotte kann Erdoğans Partei nun nicht mehr kommandieren.
»Istanbul, das bedeutet die Hälfte der Türkei«, sagt İlker Aslan. Ganz stimmt das nicht, denn die Türkei hat 83 Millionen Einwohner und Istanbul offiziell sechzehn, womöglich auch siebzehn Millionen oder mehr. So genau weiß man das nicht. Die Stadt ist das geschäftliche Zentrum des Landes. Und so ist Aslans Behauptung eine Abwandlung des Erdoğan zugeschriebenen Leitsatzes: »Wer Istanbul regiert, der regiert die Türkei.« İlker Aslan sagt, er wünsche sich, dass der 1970 geborene İmamoğlu auch einmal Präsident werde, wie der 1954 geborene Erdoğan, dessen Karriere ja auch in Istanbul begonnen hat. »Wir haben eine große Verantwortung«, sagt Aslan. Das heißt wohl auch: Es muss klappen mit dem Großreinemachen. Gar nicht so einfach.
Aslans Behörde ist auch für die Instandhaltung der Atatürk-Brücke zuständig, eine 477 Meter lange sechsspurige, viel befahrene Auto- und Fußgängerbrücke über das Goldene Horn. »Da waren Risse, verrostete Teile, als ich übernommen habe. Ich habe die Leute hier gefragt, warum habt ihr nichts gemacht, habt ihr geschlafen?« Tagelang habe man gearbeitet, um das Nötigste zu erledigen. Eine Generalsanierung der Brücke würde viele Millionen kosten, sagt Aslan, »und in der Stadtverwaltung bräuchten wir überall Geld«. Deshalb hat er einen Brief geschrieben, er zieht das Papier aus einer Schublade seines Schreibtischs.
Der Brief ist adressiert an Thyssenkrupp in Deutschland, das Istanbuler Wappen wieder oben links. In dem Schreiben heißt es, die Atatürk-Brücke sei 1937 in einer Partnerschaft der Stadt mit dem M. A. N. Werk Gustavsburg und Krupp entstanden, seither sei sie in Benutzung. Man hoffe auf eine erneute »Zusammenarbeit«, um die »Lebenszeit« des wichtigen Bauwerks zu verlängern. Es ist eine höflich formulierte Anfrage, man könnte sie auch als Hilferuf lesen. Beigelegt sind historische und aktuelle Fotos, eine handgeschriebene Konstruktionsanweisung von 1937, auf Deutsch und Französisch. Es geht um »Stützdrücke« und »Einsenktiefen der Pontons«. Aslan sagt, »ich denke, sie werden uns helfen, die Brücke ist ja von ihren Großvätern gebaut worden«.
İlker Aslans Familie stammt aus Sivas, das liegt etwa in der Mitte der Türkei. »Wir sind Anatolier.« Der Vater ging nach Istanbul, um ein besseres Leben zu finden, hier wurde İlker Aslan 1984 geboren. Der Vater hatte einen Lebensmittelladen. »Er öffnete um acht Uhr morgens und arbeitete bis abends, ohne Urlaub.« Als Kind half der Sohn im Laden mit. »Mein Vater hat mir gesagt, wenn du nicht studierst, wirst du ein Mann wie ich.« İlker Aslan studierte in Istanbul erst Ingenieurwissenschaften, nach seinem Militärdienst noch Betriebswirtschaft und erwarb einen Doktorgrad. »Ich bin sehr diszipliniert, manche Leute sagen, ich sei hart.« Auf einem stummen Diener in einer Ecke des Büros hängt Aslans blaues Jackett, darunter das Fantrikot eines Istanbuler Fußballclubs. Er ist Kickboxer, Schwimmer, keiner, der sich auf einem Bürostuhl ausruht. Das schwarze Haar trägt er straff zurückgekämmt. Er wäre gern zur Marine gegangen, aber er wurde Offizier bei einem Bergkommando. Es wäre ihm damals nicht in den Sinn gekommen, dass er noch auf dem Meer landen würde. »Man weiß ja nie, was das Leben bringt.«
Etwa 900 Leute hat er in seiner Behörde. Er hätte gern mehr. Manchmal, sagt er, wünsche er sich einen einfacheren Job, »denn hier kann ständig etwas passieren«. Zum Beispiel die Sache mit den Schmugglern. Da gibt es eine bekannte Stelle am Marmarameer, auf der europäischen Seite. »Dort passiert viel Illegales.« Menschenschmuggel, Drogenschmuggel auf Schiffen. »Da ist es einfach zu flüchten.« Er war noch nicht lange im Amt, da wollte er auch dort groß aufräumen. »Vier Tage bin ich nicht nach Hause gefahren.« Dann tauchten im Küçükçekmece-See am Rand von Istanbul plötzlich tonnenweise tote Fische auf. »Das war Sabotage, sie wollten mich loswerden.« Die toten Fische wurden im Fernsehen gezeigt, riesige Mengen. Gruselig. »Da fragten alle, wo ist der zuständige Mann?« Es ging um Korruption, sagt Aslan, »das ist wie ein innerer Krieg«. In der Verwaltung. »Aber wir machen weiter, ohne Angst.«
Fragt man İlker Aslan, was ihn motiviert, dreht er sich auf seinem Stuhl Richtung Fenster. Davor, auf einer Ablage, liegen wie Ausstellungsstücke Dinge, die ihn an sein früheres Leben erinnern, die Offizierskappe und ein dickes Buch: die auf 900 Seiten gedruckte Vermächtnisrede des Republikgründers Kemal Atatürk vor den Delegierten des zweiten Parteitags seiner Cumhuriyet Halk Partisi , der CHP, im Oktober 1927. »Das motiviert mich«, sagt Aslan, »ich will der nächsten Generation eine schönere Türkei hinterlassen.« Er nimmt sein Handy, zeigt ein Foto seiner kleinen Tochter. »Meine Frau ist in London geboren und aufgewachsen, sie ist auch Türkin und hat dort die Polizeiakademie absolviert. Sie ist also eine ehemalige Polizistin und ich bin ein ehemaliger Soldat.« Seine Frau arbeitet in Istanbul nun als Englischlehrerin. »Ich fahre meine Tochter zum Kindergarten, und wenn ich abends nach Hause komme, sind alle schon eingeschlafen.«
Im öffentlichen Dienst werde man nicht reich, sagt Aslan. Er nimmt wieder sein Handy, tippt auf dem Taschenrechner sein Monatsgehalt ein und rechnet es um: 1600 Euro. »In Deutschland würde ich wahrscheinlich dreimal so viel verdienen, also wegen des Geldes kann man diese Arbeit nicht machen.« Er lacht, sagt: »Ein Held zu sein hat seinen Preis.« Dann, wieder ernst: »Wir haben hier wirklich eine Ruine übernommen, wir tun das für unser Land, für die Fahne.« Manche Leute würden ihm nachsagen, er habe eine große Klappe. »Aber sie können nicht sagen, dass ich korrupt bin. Ich weiß, der Stuhl, auf dem ich sitze, gehört nicht mir. Es gibt viele Leute wie mich, die man gewöhnlich nicht kennt, wir sind jung, wir werden Stufe um Stufe aufsteigen.«
Wo in Istanbul ist er aufgewachsen? »In Küçükçekmece.« Dort, wo sie ihm die toten Fische ins Wasser gekippt haben. Ein Kleineleuteviertel. »Es ist eigentlich Provinz, mit der Bourgeoisie hat man dort nichts zu tun.« Den Bosporus hat er in seiner Jugend selten gesehen. »Der war weit weg und wir hatten nicht so viel Geld.« Im See von Küçükçekmece soll der »Zweite Bosporus« enden, den Erdoğan parallel zur natürlichen Wasserstraße bauen will. »Ein verrücktes Projekt«, hat Erdoğan diesen »Kanal Istanbul« einst selbst genannt, was ihn nicht davon abhält, die Idee seit Jahren zu verfolgen. Schon osmanische Sultane träumten vom kontinentalen Umbau, von Kanälen, die das Land durchstechen. Umweltexperten warnen, das Megaprojekt gefährde die ohnehin prekäre Wasserversorgung der Metropole, die Speicherseen in der Nähe der Kanalstrecke würden entweder vernichtet oder versalzen.
An den Schiffsanlegern in Istanbul liegt eine Broschüre der Stadtverwaltung aus, mit dem Bild des Bürgermeisters und Argumenten gegen den Kanal. Auch Aslan sagt: »Der Kanal ist falsch.« Erdoğan verweist auf die Gefahren durch den stetig wachsenden Schiffsverkehr. Seine Gegner dagegen sagen, der Regierung gehe es vor allem um neue Satellitenstädte entlang der künstlichen Wasserstraße. Viele Grundstücke seien längst an reiche Investoren aus den Golfstaaten verkauft. Ob der Kanal noch zu verhindern ist? Aslan sagt: »Wir tun unser Bestes.«
Читать дальше