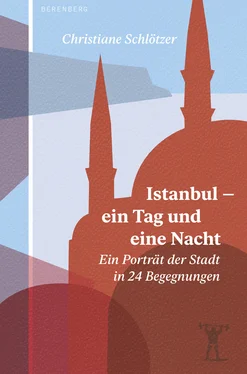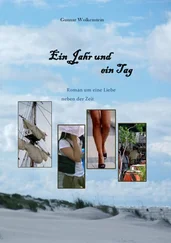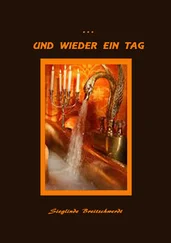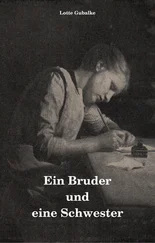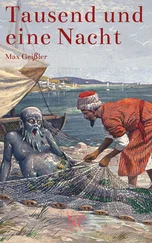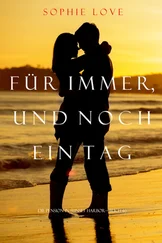Nun, es ist der 18. Februar 2020, wird erneut verhandelt, und diesmal ist einiges anders: Der Richter hat den Anwälten zuvor die Botschaft zukommen lassen, sie sollten ihre letzten Verteidigungsworte vorbereiten. Und der Europäische Gerichtshof hat schon im Dezember 2019 die sofortige Freilassung Kavalas verlangt. Die Straßburger Richter fanden in der Anklageschrift keinerlei Beweise für den Umsturzvorwurf. Immer wieder drängt der Richter an diesem Tag zur Eile, die Anwälte aber beklagen, dass alle von ihnen benannten Zeugen abgelehnt wurden. Als ein Anwalt sich das Wort nicht nehmen lassen will, weist der Richter ihn aus dem Saal. Polizisten versuchen, den Juristen mit körperlicher Gewalt hinauszueskortieren. Dagegen protestieren viele Zuschauer lautstark. Polizisten bauen sich vor dem Publikum auf, der Richter will die Besucherbänke räumen lassen. Einige Zuschauer stehen auf, bereit, den Saal zu verlassen, viele aber bleiben sitzen. Bevor die Situation eskaliert, verzichtet der Richter auf die Räumung.
Einer der Angeklagten – er ist selbst Anwalt – nennt in seinem »letzten Wort« die ganze Anklage ein »schmutziges Lügenbündel«. Er erinnert daran, dass die Vorwürfe von Ermittlern zusammengetragen wurden, die inzwischen selbst verurteilt sind, wegen Aktivitäten für die Gemeinde des Predigers Fethullah Gülen, der von Erdoğan für den Putschversuch vom Juli 2016 verantwortlich gemacht wird und nun Staatsfeind Nummer eins ist. So absurd ist das alles. Eine Angeklagte sagt: »Ich habe überhaupt nichts verstanden«, sie fühle sich in diesem Prozess »wie in einem Raumschiff«. Das Gericht zieht sich dann zurück, davor hat der Staatsanwalt noch einmal lebenslange Haft für Kavala und zwei weitere Angeklagte verlangt sowie mehrjährige Haftstrafen für viele der übrigen Beschuldigten.
Was dann passiert, ist eine Sensation. Die Pause ist kurz, die Angeklagten sind aufgestanden, um das Urteil entgegenzunehmen, und der Richter murmelt seine Entscheidung herunter, so hastig, als würde er auf das Luftholen verzichten. Es dauert einige Sekunden, bis die Botschaft auf den Zuschauerbänken angekommen ist, weil sie fast niemand erwartet hat, nicht an diesem Tag, nicht von diesem Gericht: Freispruch für alle! Aus Mangel an Beweisen. Im Saal bricht Jubel aus. Minutenlanger Applaus, Tränen, Umarmungen. In der Mitte der ersten Zuschauerreihe steht Ayşe Buğra, Kavalas Frau. Sie ist klein, schmal, dunkelhaarig. Sie hat an keinem Prozesstag gefehlt und musste diesen Saal bislang stets ohne Hoffnung verlassen. Nun strahlt sie, wird von Freunden umringt, umarmt, beglückwünscht. Osman Kavala hat sich da schon wieder zum Publikum umgedreht, auch er winkt, im Gesicht ein Leuchten. Dann führen ihn die Beamten erneut ab, über die Rampe in den Untergrund. Vor der Entlassung werden Häftlinge noch einmal ins Gefängnis gebracht, sie müssen ihre Zelle räumen, zusammenpacken.
Die Zuschauer strömen ins Freie, viele fallen sich erst draußen vor dem Saal in die Arme. Reporter sprechen in Kameras, ausländische Diplomaten geben Kommentare der Erleichterung ab. Kavala wird da schon zu einem Arzt außerhalb des Gefängnisses gebracht, der bescheinigen soll, dass er in der U-Haft keinen Schaden genommen hat. Auch das ist Routine. Dann müsste er eigentlich für die formelle Entlassung zurück nach Silivri. Doch der Minibus nimmt einen anderen Kurs – zur Anti-Terror-Polizei in Istanbul. Dort eröffnet ihm ein Staatsanwalt, dass ein neuer Haftbefehl gegen ihn vorliege und er erneut festgenommen sei. Diesmal wegen angeblicher Beteiligung am Putschversuch von 2016. Von Sympathien des Mäzens für den Prediger Gülen, der hinter dem Putschversuch stecken soll, ist nichts bekannt, im Gegenteil: Kavala hatte frühzeitig vor dessen Einfluss gewarnt. Die neuen Vorwürfe sind ebenso aus der Luft gegriffen wie die aus der Anklage, die sechs Stunden zuvor mit einem Freispruch vom Tisch gewischt worden ist. Kavalas Frau und seine Freunde erfahren das noch am selben Abend, nach ihrer Rückkehr nach Istanbul, von den Anwälten. Zwölf Stunden nachdem sie am Morgen nach Silivri aufgebrochen sind. Ob Freispruch oder Haftbefehl, nichts mehr ist berechenbar, die türkische Justiz ein Scherbengericht. So sagen es die regierungskritischen Kommentatoren. Kavalas Anwälte sprechen von einer »Form der Folter« durch die fortgesetzte Untersuchungshaft.
Von Regierungsleuten wird zur Rechtfertigung erzählt, die Türkei sei von Feinden umzingelt und ihre Gegner stünden im Westen. Ein Unternehmer und Mäzen, der mit westlichen Kulturinstitutionen kooperiert, gerät in diesem Gespinst aus Konspiration und Misstrauen unter Generalverdacht. Diejenigen aber, die da nicht mitmachen wollen und immer noch für eine pluralistische Türkei eintreten, sollen eingeschüchtert werden. Der Prozess gegen Kavala soll jene mundtot machen, die partout nicht den Mund halten wollen. In diesem Sinn war der Freispruch ein Unfall, ein nicht vorgesehenes Ereignis. Später erfährt man, dass dem Richter, der ihn fällte, beamtenrechtliche Untersuchungen drohen.
Im Dezember 2020 beginnt der zweite Prozess gegen Kavala. Dann wird im Januar 2021 auch der Freispruch von einem Berufungsgericht aufgehoben, über die erste Anklage soll erneut verhandelt werden. Schließlich werden beide Prozesse zusammengelegt. Da wird es sogar einem aus der Gründergeneration von Erdoğans Partei zu viel. »Nicht mal ein Kind« hätte die neue Anklage verfassen können, so lächerlich sei sie, schimpft Bülent Arınç, Ex-Parlamentspräsident und Präsidentenberater. Erdoğan distanziert sich sofort von seinem alten Mitstreiter, und Arınç tritt als Berater zurück. Mit einer Begründung für die Geschichtsbücher: »Unser Land muss sich entspannen und eine Lösung für die Probleme unserer Nation finden.«
In der Türkei gibt es viele Mäzene, meist Besitzer großer Industrie- und Handelskonglomerate. Sie stiften prachtvolle Museen, finanzieren Festivals und schmücken sich damit auch selbst. Kavala ist in diesem Kreis mit seiner Stiftung ein auffallend bescheidener Helfer. Statt Aufmerksamkeit fordernde Prestigeprojekte fördert er kleinteiliges zivilgesellschaftliches und kulturelles Engagement. Sein Interesse gilt den marginalisierten Kulturen, der kurdischen, der armenischen, den vertriebenen Griechen. Viele Kulturschaffende standen bei ihm Schlange, um ihn für ihre Projekte zu gewinnen. Sein Kunstraum »Depo« im einstigen väterlichen Tabaklager liegt in der Nähe der Hafenkais von Galata, ein Stück entfernt von der Vorzeigemeile İstiklal. Mütterlicherseits stammt die Familie aus osmanischem Adel. Wenn sein grauer Lockenschopf bei einer Vernissage oder einer Demo aus der Menge ragt, umgibt den Mann etwas Aristokratisches und gleichzeitig Studentisches. Kavala wurde 1957 in Paris geboren, in Istanbul besuchte er das renommierte Robert College, in Manchester studierte er Wirtschaftswissenschaften. Seine Frau ist eine angesehene Wirtschaftsprofessorin.
Anfang der 2000er Jahre traf ich beide zum ersten Mal, bei einem Frühstück von Freunden in Berlin. Die meinten, ich sollte Kavala kennenlernen, bevor ich nach Istanbul ginge. Was sie nicht sagten: Dass Kavala einer der wohlhabendsten und großzügigsten Mäzene der Türkei ist, und die beiden machten auch kein Aufhebens davon. Viele suchten später das Gespräch mit Kavala, europäische Regierungschefs, Kulturminister. Nicht lange vor seiner Festnahme hatten wir uns in Istanbul wieder einmal getroffen, zu einem Abendessen. Kavala sprach von einer Hetzkampagne, von Drohungen auch aus einer regierungsnahen Gruppe. Ob er nicht die Türkei verlassen wolle, fragte ich. Für einige Zeit? Er hätte in jedes europäische Land ausreisen können. Er sagte, er wolle in Istanbul bleiben, wo er gebraucht werde, von seiner Stiftung, von seinen Freunden.
Über seine Anwälte ließ Kavala im Januar 2020 der Süddeutschen Zeitung aus der Haft einen persönlichen Text zukommen. Darin schreibt er über eine globale Atmosphäre des »Postfaktischen«. Die Türkei sei nicht das einzige Land, in dem man damit leben müsse, dass Tatsachen nichts mehr gelten.
Читать дальше