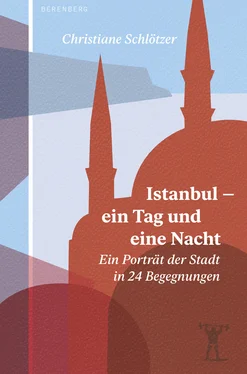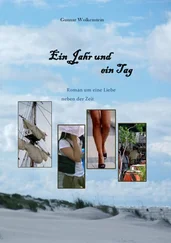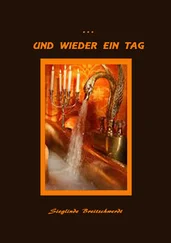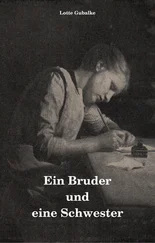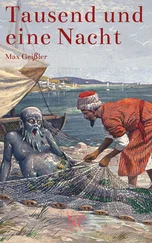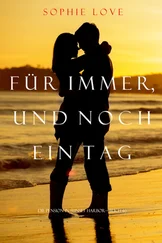Damit verbunden ist das Auslöschen der Erinnerung. In den Geschichtsbüchern kommen die zu Hunderttausenden vertriebenen und ermordeten osmanischen Armenier nicht vor, geschweige denn ihr enteigneter Besitz. Unter den 36 Sprachen, die ein automatisches Übersetzungssystem am futuristischen Istanbuler Airport beherrscht, fehlt das Kurdische. Aber es gibt die Unermüdlichen, die nicht aufhören, an die offizielle Vergesslichkeit zu erinnern. Die türkische Zivilgesellschaft überrascht trotz aller Drangsalierungen immer wieder durch kreativen Widerspruch und Mut.
Seit dem Militärputsch von 1980 sind vier Jahrzehnte vergangen. Bis Juli 2016 glaubten wohl die meisten Türken – ich auch –, es werde nie wieder einen Putsch geben. Und dann stoppten an einem Hochsommerabend Militärschüler den Feierabendverkehr auf einer Bosporus-Brücke. Die jungen Soldaten glaubten, es ginge zu einer Übung. So hatten es ihnen ihre Befehlshaber gesagt. Die wiederum erwarteten wohl, der unzufriedene Teil des Volkes werde ihnen nachlaufen, wenn sie nur den Präsidenten wegputschen. Womit sie nicht rechneten: Dass sich Menschen den Panzern entgegenstellen, dass die Älteren, für die 1980 ein Trauma geblieben ist, sich nie mehr von Generälen regieren lassen wollen. Und dass ein Militärregime im 21. Jahrhundert in der Türkei keinen Twitter-Sturm überleben würde.
Die Sommernacht 2016 spielt auch in diesem Buch eine Rolle, weil viele Menschen sie nicht vergessen haben, und egal welcher politischen Richtung sie angehören, sie machen Kader der Gülen-Sekte für dieses einschneidende Ereignis verantwortlich, aber nicht unbedingt allein. Es gibt noch immer Rätsel um diese Nacht. Erdoğan nannte den Putschversuch ein »Gottesgeschenk«, eine Verhaftungswelle rollte durchs Land. Andere bekamen danach die Posten in Polizei, Justiz und Militär. Auch unter ihnen soll es wieder Leute geben, für die religiöse Gruppen Karrierenetzwerke sind. Mein frommer Kapitän hätte mit solchen Männern und Frauen sicher nichts zu tun haben wollen. Der versuchte Coup war ein Unglück für die Türkei. Er hat sie um Jahre zurückgeworfen. Die Wirtschaft leidet, die Inflation ist zweistellig. Das gab es davor lange nicht mehr.
In den mehr als zehn Jahren, die ich in der Türkei gelebt habe, habe ich verstanden, was es heißt, »Ausländerin« zu sein. Auch davon ist in diesem Buch die Rede, denn fast jede türkische Familie hat deutsche Verwandte. Die Ersten, die mit dem Gastarbeiteranwerbeabkommen von 1961 kamen, kämpften mit vielem, was sie nicht kannten. Auch mich haben in der Türkei gelegentlich bürokratische Tollheiten ratlos gemacht. Aber das, was wir Ausländerfeindlichkeit nennen, habe ich in meinem Alltag so gut wie nie gespürt.
Istanbul ist eine Megacity, aber wer dort lebt, ist in der mahalle , der fußläufigen Nachbarschaft, zu Hause. Wo es noch an jeder dritten Ecke einen bakkal gibt, einen fast immer geöffneten kleinen Lebensmittelladen. Wo die Menschen den Straßenhunden Namen geben und den Katzen Häuser bauen, vor denen stets Futter liegt. Und wo sie auch mit ihren Geschichten so freigebig sind.
Was aus dem Kapitän geworden ist? Ich weiß es nicht. Aber wenn ich auf eines der alten Bosporus-Schiffe steige, schaue ich gelegentlich, wer auf der Kommandobrücke steht.
Im Kopf den Rausch vergangener Feste .
Eine Strandvilla mit halbdunklen Bootshäusern ,
Das Sausen der Südwinde legt sich .
Ich höre Istanbul, meine Augen geschlossen …
Orhan Veli (1914–1950)
6 Uhr
Erwachen
Satu Önder – Die Frau des Imams
Die Moschee macht sich so klein, als würde sie sich zwischen den umstehenden Häusern ducken. Der lindgrüne Anstrich der alten Mauern ist verblasst. Über dem Eingang steht: Makrizade Hüseyin Çelebi Camii und das Baujahr 1709. Jeden Morgen, noch vor Sonnenaufgang, wenn in der Dämmerung der neue Tag erst zu ahnen ist, macht die kleine Moschee sich bemerkbar. Dann ertönt der ezan , der islamische Gebetsruf, schwingt sich durch die Hinterhöfe auf dem Galata-Hügel. Allāhu akbar , Gott ist groß. So weckt der Imam die Gottesfürchtigen, die Zweifler und die Atheisten, erinnert die Gläubigen an ihre Pflichten und die Ungläubigen unsanft daran, dass die Nacht zu Ende ist.
Ein paar Jahre habe ich auf dem Galata-Hügel gewohnt. Viele Häuser hier haben sieben oder acht Etagen und in den obersten Stockwerken abenteuerlich zwischen Himmel und Erde aufgehängte Terrassen. Die sind oft illegal gebaut, weil Wohnungen, von denen man aufs Ballett der großen und kleinen Schiffe auf dem Bosporus schauen kann, viel mehr wert sind als solche ohne diesen betörenden Blick. Von meiner Terrasse in Flughöhe der Möwen konnte ich tief unten auch einen schmalen ummauerten Garten erspähen. Und aus dieser Tiefe ertönte jeden Morgen ein Hahnenschrei, und zwar stets unmittelbar vor dem Gebetsruf, so laut, als dulde das Tier keine akustische Konkurrenz. Es gab nur eine Erklärung: Der Hahn lebt im Garten des Imams. Nach ein paar Wochen war der vorlaute Kräher auf einmal wieder weg, und ich habe mich gefragt, wo ist der Hahn geblieben?
Satu Önder, die Frau des Imams, hat es mir erzählt, bei Tee, Teigtaschen und sohbet , wie das schöne türkische Wort für eine unterhaltsame Plauderei lautet. Satu Önder trägt ein Kopftuch in Pastelllila mit großem Blumenaufdruck, einen langen Rock und eine schwarze Wolljacke. »Der Hahn«, sagt sie und lacht, »ja, schade eigentlich.« Ein paar Nachbarn hätten sich beschwert. Und wenn die Nachbarn sich gestört fühlen, »dann bin ich auch unruhig, deshalb haben wir ihn weggebracht, ins Dorf«. War einfach zu laut, der Hahn. »Eine Ente hatten wir auch, und Hühner im Garten, mein Mann mochte die sehr«, sagt Satu über Mustafa, ihren Mann, den Imam.
Satu Önder sitzt auf einem Sofa in ihrem Wohnzimmer über der Moschee. Für den heißen Tee in Tulpengläsern hat sie kleine Tischchen herangerückt. Sie zupft an ihrer Jacke: »Ich friere immer, ich fürchte die Kälte.« Sie will die Heizung hochdrehen, aber die Tochter neben ihr auf dem Sofa sagt, ihr sei warm. Elif, achtzehn Jahre alt, in Jeans und weißem Pulli, trägt kein Kopftuch. Was Mutter und Tochter erzählen werden, ist eine typische Istanbuler Geschichte, sie handelt von verlassenen anatolischen Dörfern, zehn, zwölf Autostunden von der Metropole entfernt. Und von den Verlockungen der großen Stadt. Von verpassten Chancen und dem Wunsch, dass es den Kindern besser gehen möge als ihren Eltern. »Meine Kinder sind klug«, sagt Satu Önder, »ich bin es nicht.« Elif kennt das: »Das höre ich immer.«
Wo Satu Önder aufgewachsen ist, gab es kein wärmendes Stadtgas, das heute in Istanbul zu den selbstverständlichen Annehmlichkeiten gehört, geheizt wurde im Dorf mit Holz aus dem Wald. Aber allein wegen der bitteren Kälte im Winter wären Satu Önder und ihr Mann wohl nie aus einer fernen Schwarzmeerprovinz nach Istanbul aufgebrochen. »Ich wollte, dass meine Töchter studieren«, sagt die Frau des Imams, »weil ich das nie konnte.«
So erzählt diese Geschichte auch von gewaltigen sozialen Veränderungen in der Türkei, in nur einer Generation. Geboren wurde Satu 1972 in der Schwarzmeerprovinz Sinop. In welchem Monat sie Geburtstag hat, weiß sie nicht. »Meine Mutter hat gesagt, die Kirschen waren reif, also könnte es im Mai gewesen sein.« Die Mutter konnte wie der Vater weder lesen noch schreiben. Als der Vater krank wird, ist Satu drei Jahre alt, er kann lange nicht arbeiten. Daher ziehen sie in das Dorf der Mutter, ein Stück weiter im Landesinneren, in der Provinz Çorum. Dort geht Satu zur Volkschule, danach will sie in die Mittelschule, dazu rät auch ihr Lehrer, sie ist eine gute Schülerin. »Der Lehrer sagte meinem Vater, ich werde deine Tochter in der Mittelschule anmelden.« Da aber müsste sie jeden Tag in die nächste Stadt fahren. Das will der Vater nicht. »Was sollte ich tun?«, fragt Satu. »Mit sechzehn Jahren habe ich dann geheiratet.« Das kam ihr selbst zu früh vor. »Ich war jünger als meine Tochter jetzt.« Mutter und Tochter drehen die Köpfe zueinander. »So waren die Bedingungen damals eben«, sagt Satu Önder, kismet , Schicksal.
Читать дальше