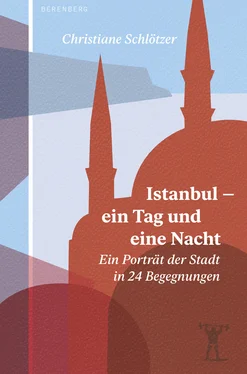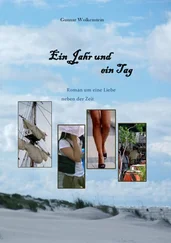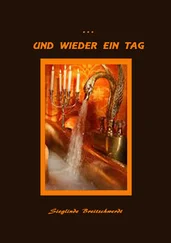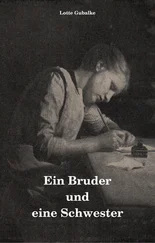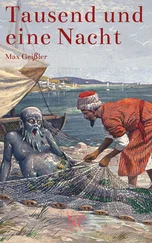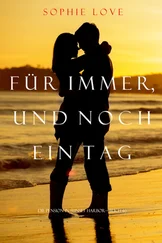In München studiert er später Architektur. »Ich bin ziemlich bayerisch geprägt.« Dem Vater ist er bis heute dankbar, dass er ihn nach Deutschland geholt hat. Daraus ist dann seine »Mission« geworden, Deutsche und Türken anzustecken mit seiner Neugier auf den jeweils anderen. »Nun hat sich leider die Welt komplett verändert«, sagt Gabi Kern, »es gibt ja keine Zwischentöne mehr, es gibt nur noch Schwarz und Weiß.« Sie hätten weggehen können, als kaum noch Gäste kamen, »aber wir haben ja eine Verantwortung übernommen, auch für unsere Mitarbeiter, und wir sehen immer noch das Potenzial, das es hier gibt«, sagt Gabi. Und ihr Mann fragt sich, »woher haben wir damals eigentlich die Energie genommen? Wir haben ja immer weitergemacht.« Sie sagt: »Wir haben uns gegenseitig Kraft gegeben.«
Gabi war Gast in einer Manzara -Wohnung, bevor sie sich kennenlernten. Sie fand, dass sie einen ähnlichen kreativen Stil haben, wenn sie alte Bausubstanz mit aufregender neuer Architektur verbinden. Auch Gabi Kern ist Architektin. Sie war jahrelang Bauleiterin in München. Man kann sich das so vorstellen: eine kleine Frau mit hellbraunen Haaren, die Männern auf Baustellen Befehle gibt. »Das kennt man ja, man muss als Frau oft das Doppelte bringen, um die halbe Anerkennung zu bekommen.« Auch das Kämpferische verbindet die beiden. 2008 haben sie geheiratet. Er sagt: »Ich habe als Kind in Kayseri immer diese mitleidigen Blicke gespürt. Ich wollte immer selbstbestimmt sein und es zu etwas bringen.«
Es gibt ein Kinderfoto, es zeigt sechs Jungs in Kayseri, auf dem Schutt alter armenischer Häuser. Ein Kind trägt ein T-Shirt mit türkischer Flagge. »Trümmer zu verkaufen« steht auf einer Mauer. Altındiş hat das Foto aus seiner Kinderzeit 2019 in einer Ausstellung in Istanbul gezeigt. Es ist für ihn »eine Mahnung für den Umgang mit Minderheiten«. Die Ausstellung war so etwas wie der Versuch, sich selbst aus einer Depression zu befreien. Er hat auch Papierdrachen gebaut und sie über einer Istanbuler Passage aufgehängt. Drachen steigen zu lassen im trockenen Wind Anatoliens ist ein beliebtes Kinderspiel. Ausstellungsbesuchern hat er einen Pinsel in die Hand gedrückt, sie zum Malen aufgefordert. Er malt auch, großformatige Bilder, in denen man bisweilen etwas von der Silhouette Istanbuls ahnt. Fantasie, sagt er, »kann mehr bewegen als direkte Konfrontation«.
Ihre Firma haben sie verkleinert. Gabi Kern gestaltet jetzt Sitzmöbel, lässt alte Sessel mit farbigem Samt überziehen, Türkis und Orange. Nur auf bessere Zeiten warten, das kann sie so wenig wie er. »Ich komme aus einer Handwerkerfamilie, ich bin mit Holz groß geworden.« In Istanbul hat sie sich vom rechten Winkel verabschiedet, sie lernte, »dass Wände rund sein dürfen und die Farbpalette schier unerschöpflich ist«. Anfangs, sagt sie, »musste ich auch schlucken und habe manchen Kulturschock erlebt«. Aber lebendig habe sie sich in diesen Kämpfen gefühlt. Die Blicke der beiden treffen sich. Sie hatten auch ihre Kämpfe miteinander.
Die Ausstellung hat er damals in einem Prachtbau an der Einkaufsmeile İstiklal gezeigt, der Suriye Pasajı . Das Gebäude heißt so, weil es 1908 ein gewisser Hasan Halbuni Paşa aus Syrien erbauen ließ. Eines der ersten Kinos der Türkei befand sich darin. Die beiden haben in dem Haus in einem der oberen Stockwerke schöne Räume gemietet, in denen sie früher Feste gefeiert und Gäste bewirtet haben. »Um 12 Uhr mittags halte ich dort immer einen Moment inne, dann höre ich den Glockenschlag der benachbarten Kirche. Wenn die Glocken einmal nicht mehr läuten sollten, würde ich mich fragen, ob ich hier noch richtig bin«, sagt Erdoğan Altındiş. Er macht eine Pause. »Aber sie läuten noch.«
2023 wird es hundert Jahre her sein, dass mehr als eine Million griechisch-orthodoxe Christen die gerade gegründete Türkei verlassen mussten. Im Gegenzug wurden fast eine halbe Million Muslime aus Griechenland in die Türkei umgesiedelt. Dieser »Bevölkerungsaustausch« wurde von den Großmächten besiegelt. Sie hofften, beide Nationen, die sich zuvor erbittert bekriegt hatten, zu befrieden. Gabi und Erdoğan Altındiş beschäftigt diese leidvolle Geschichte, von der sie vorher nicht viel wussten, seit sie beschlossen haben, sich außerhalb von Istanbul eine Rückzugsmöglichkeit zu schaffen. So ist das in der Türkei: Man geht auf die Suche nach einem ruhigen Ort und stößt auf ein unbewältigtes Stück Geschichte. Ayvalık, wo sie ein Haus suchten, liegt an der Ägäisküste. Die Stadt mit etwa 70.000 Einwohnern ist bei Istanbuler Künstlern und Kreativen beliebt. Wegen des milden mediterranen Klimas und auch, weil das politische Klima nicht so rau, liberaler ist. Die griechische Insel Lesbos liegt in Sichtweite vor der Küste. Diese Küste hat schon viele Flüchtlingsdramen gesehen.
In Ayvalık lebten bis 1923 fast nur griechisch-orthodoxe Christen. Als sie das Land verlassen mussten, zogen in ihre Häuser aus Griechenland vertriebene Muslime. Aber einige Häuser blieben ungenutzt, verfielen. »Als wir das erste Mal in Ayvalık waren, haben wir gespürt, da gibt es viel Unausgesprochenes«, sagt Gabi, »ich hatte das Gefühl, da klebt Blut an der Erde.« Ihr Mann sagt: »Wenn ich davon erzähle, merke ich, wie mich das mitnimmt.« Sie restaurieren jetzt mehrere alte griechische Häuser, ergänzen sie modern. Zusammen mit Erdoğans über achtzigjährigem Vater und einem nicht viel jüngeren Onkel haben sie in einem Haus einen Terrazzoboden gelegt. Seit der Antike ist diese Technik bekannt. Aus kleinen Steinchen werden schöne Fußböden erschaffen. »Wir haben die ganze Insellandschaft vor der Küste als Mosaik auf den Boden gelegt«, sagt Erdoğan. Er hat an dieser Küste erlebt, wie nah sich Türken und Griechen nicht nur geografisch sind, sondern auch in der Alltagskultur, beim Essen, in der Musik.
Sie haben auch den türkischen Vorbesitzer ihres Hauses kennengelernt. »Er wurde in diesem Haus geboren, aber seine Großeltern kamen aus der Nähe der griechischen Stadt Thessaloniki.« Sie waren Opfer des Bevölkerungsaustauschs. Als sie in Ayvalık ankamen, war der Tisch des Hauses noch gedeckt, die Menschen, die vor ihnen dort lebten, hatten keine Zeit zum Packen gehabt. »Dieses Bild des gedeckten Tisches geht mir nicht mehr aus dem Kopf«, sagt Erdoğan. Er hat den Vorbesitzer eingeladen, den ersten Stein für den Terrazzoboden zu legen.
Die beiden Architekten sagen, sie wollten immer noch »Brückenbauer« sein. »Vielleicht gründen wir eine Stiftung, wir haben ja keine Kinder«, sagt Erdoğan. Er will »Optimist« bleiben, er hat erlebt, wie schnell sich die Dinge ändern können. Er weiß noch, wie niemand eine Lira auf das alte Galata-Viertel in Istanbul setzte, als er seine Wohnung dort kaufte und seine Mutter deshalb weinte. Damals ging er zum Bezirksbürgermeister, zuvor hatte er 150 Unterschriften gesammelt. Er wollte die Stadt bitten, die Umgebung des Galataturms nicht so verkommen zu lassen. »Der Bürgermeister hat mich gefragt, wer bist du überhaupt? Der hat überhaupt nichts verstanden.«
Und nun gehört die Gegend um den fast 700 Jahre alten Befestigungsturm mit dem spitzen Dach zu den teuersten der Stadt. Vor dem Turmaufstieg bildet sich fast täglich eine Menschenschlange. Arabische Touristen haben zuletzt die europäischen ersetzt. Aber die arabischen Besucher wollen in Luxushotels übernachten und nicht in restaurierten Stadtwohnungen im siebten Stock ohne Aufzug.
Erdoğan Altındiş seufzt. Seine Frau schüttelt den Kopf, was wohl heißen soll: Unser Traum ist noch nicht geplatzt. »Dieser Teil Istanbuls ist mit einer großen Geschichte geerdet«, sagt sie, »er wird seine Seele behalten.«
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Читать дальше